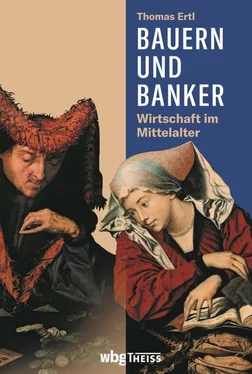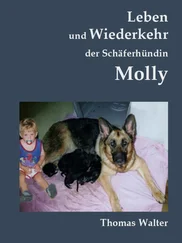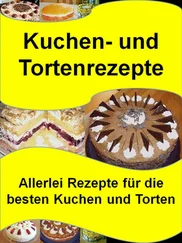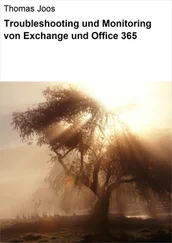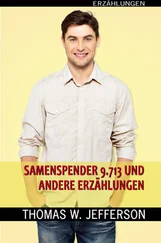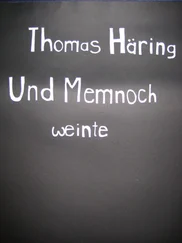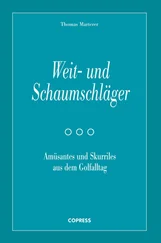»17. Für jeden Gutshof in seinem Amtsbezirk soll der Amtmann Pfründner bestellen, die Bienen für uns zu warten 18. Bei unseren Mühlen halte man der Größe der Mühle entsprechend 100 Hühner und 30 Gänse, auf den Vorwerken mindestens 50 Hühner und 12 Gänse 19. Bei den Scheunen auf unseren Haupthöfen halte man mindestens 100 Hühner und 30 Gänse, auf den Vorwerken mindestens 50 Hühner und 12 Gänse. 20. Jeder Amtmann lasse während des ganzen Jahres reichlich Gutserzeugnisse zum Fronhof bringen und besichtige sie außerdem drei- bis viermal im Jahr oder noch öfters.«
Ob dieses Kapitular ein unrealistisches Idealbild darstellte oder die Entwicklung der karolingischen Grundherrschaft wirklich beeinflusste, ist strittig.
Außerhalb des Kernbereichs fränkischer Herrschaft entwickelte sich die Struktur der Landwirtschaft jeweils abhängig von den topografischen, klimatischen und sozialen Verhältnissen. In Südfrankreich und Italien bewirtschafteten die Grundherren häufig kein eigenes Herrenland und die Bauern schuldeten keine Frondienste, sondern einen festen Anteil der Erträge (Teilbausystem) oder festgelegte Abgabemengen. Selbst in den Kernräumen des Frankenreichs nördlich der Alpen existierten neben den Villikationen Grundherrschaften, die vorrangig auf Abgaben abhängiger Bauern in Naturalien und Geld beruhten. Daneben gab es stets freie Bauern, die zwar kaum in den Quellen auftauchen, aber einen beträchtlichen Teil aller Bauern ausmachten. Einige von ihnen wurden von den adligen und kirchlichen Grundherren, die ihre Grundherrschaften ausdehnen wollten, bedrängt und unterdrückt. Die Klagen der Bauern wurden in unterschiedlichen Quellen überliefert. Insbesondere an den Rändern des fränkischen Reichs wie in Spanien oder Friesland, außerdem in abgelegenen Rodungs- und Gebirgszonen stellten die persönlich freien Bauern die Mehrheit der Bauernschaft. Die Ausbreitung der Landwirtschaft im südlichen Frankreich und in Katalonien erfolgte im 9. und 10. Jahrhundert durch solche freien Bauern, die in kleinen Siedlungen zusammenlebten. Bisher ungelöst ist die damit verbundene Frage, ob die landwirtschaftlichen Innovationen des frühen Mittelalters eher auf die großen bipartiten Grundherrschaften oder auf die kleineren Betriebe freier Bauern zurückgehen.
Der großen Bandbreite der persönlichen Rechtsverhältnisse entsprachen sehr unterschiedliche ökonomische Verhältnisse. Am unteren Ende der Skala standen rechtlose Sklaven, die auf den Herrenhöfen lebten und arbeiteten. Ihre Zahl nahm ab, weil viele von ihnen von den Grundherren eigene Bauernhöfe erhielten und so zu behausten Sklaven (servi casati) wurden. Mit ihrer wirtschaftlichen Teilautonomie verbesserte sich ihre Rechtsstellung und dieser Prozess näherte die ehemaligen Sklaven den persönlich freien, aber schollengebundenen Bauern (Kolonen) sowie den abhängigen Bauern (Grundholden, Hörige) an. Aus den Sklaven der Spätantike (lat. servus) wurden im frühen Mittelalter unfreie Bauern, in der deutschsprachigen Forschungsliteratur als Hörige oder Leibeigene (engl. serf) bezeichnet. Die Meinungen über diesen Prozess und die weitere Existenz rechtloser Sklaven im hohen und späten Mittelalter gehen jedoch auseinander. Obendrein stellt sich die Frage, ob zwischen Sklaven, unfreien und freien Bauern tatsächlich eine klare rechtliche Grenze vorhanden war oder doch eher ein sozialer Raum mit Zwischenformen. Weitgehender Konsens herrscht darüber, dass im frühen Mittelalter eine »Vergrundholdung« oder »Verbäuerlichung« einsetzte, die die unterschiedlichen sozialen Gruppen der abhängigen Personen bis zum 11. Jahrhundert in einem Bauernstand vereinte, wobei diese Entwicklung die rechtlichen, sozialen oder wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den bäuerlichen Haushalten niemals nivellierte. Ein Bauernstand mit einheitlichen Lebensformen existierte nur in den Köpfen von Gelehrten und Dichtern, wenn diese über die sozialen Stände schrieben und sich dabei – meist vorurteilsbeladen und zum Amüsement des adligen oder bürgerlichen Publikums – über die Bauern ausließen.
Die Beziehung zwischen Grundherren und Bauern wurde vom Gewohnheitsrecht geprägt, sodass der Grundherr die Abgaben nicht willkürlich festsetzen konnte, die Bauern hingegen in der Regel bereit waren, die vorhandene Abgabenlast zu akzeptieren. Probleme und Widerstände ergaben sich meist in Momenten, in denen in die herrschenden Verhältnisse eingegriffen wurde. So wird im Kapitular von Pîtres im Jahr 864 von Bauern berichtet, die gewisse Fuhrdienste verweigerten, weil diese nicht von alters her (ex antiqua consuetudine) gefordert worden waren. Die Stellung vieler Bauern erlangte spätestens im 9. Jahrhundert zudem größere Rechtssicherheit wegen der Erblichkeit von Nutzungsrechten. Bauern, die das ihnen übertragene Land rechtlich gesehen nur bis auf Widerruf des Grundherrn nutzten, konnten ihren Hof samt Ackerland in der Praxis nicht nur über Generationen innerhalb der Familie behalten, sondern ihr Land oder Teile davon verkaufen bzw. die eigene Landwirtschaft durch den Kauf weiterer Äcker erweitern. Meist setzte dies allerdings die Zustimmung des Grundherrn voraus. Bis in die Neuzeit hinein blieb das Verhältnis zwischen Grundherren und Bauern von dieser Suche nach für beide Seiten erträglichen Kompromissen bestimmt. Aufgrund des Wandels klimatischer, ökonomischer und regionaler Rahmenbedingungen saß mal die eine Seite und mal die andere am längeren Hebel.
Schon im frühen Mittelalter begann ein Prozess der landwirtschaftlichen Expansion, der sich unter anderem an Rodungen und einer Erweiterung der landwirtschaftlich genutzten Flächen erkennen lässt. Der Einsatz des schweren Pflugs (Räderpflug), der die gepflügten Schollen nicht nur ritzt, sondern umwendet, die Anschirrung von Pferden mit dem Kummet (Pferdehalsgeschirr) und die Dreifelderwirtschaft waren technische und organisatorische Hilfsmittel in manchen Grundherrschaften nördlich der Alpen. Die Überschussproduktion wurde bereits seit dem 7. Jahrhundert auf lokalen Märkten und in nahen Städten verkauft, sodass die frühmittelalterlichen Grundherrschaften keine autarken Wirtschaftseinheiten bildeten.
Die Erträge blieben indes gering. Das Verhältnis von Saat zu Ernte liegt heute zwischen 1:20 und 1:30. Damals lag das Verhältnis zwischen 1:2 und 1:5, was bedeutet, dass von einem ausgesäten Getreidekorn zwischen zwei und fünf Körner geerntet wurden. In schlechten Erntejahren führte dies unweigerlich zu Mangelkrisen und Hungersnöten. Im Jahr 792 / 93 erließ Karl der Große deshalb Höchstpreise für Getreide, um in einer Zeit des Mangels die Versorgung zu sichern. Trotz solcher Maßnahmen berichten die karolingischen Chronisten allein im 9. Jahrhundert in 26 verschiedenen Jahren von regionalen Hungersnöten.
Innerhalb der heterogenen bäuerlichen Gesellschaft (peasant society) des frühen Mittelalters bildeten die bäuerlichen Haushalte eine Produktions- und Konsumgemeinschaft, die in Abhängigkeitsverhältnissen und in Bereichen der Eigenständigkeit gleichermaßen verankert war. Aufgrund der Quellenlage ist es in der Regel nur indirekt möglich, etwas über das bäuerliche Alltagsleben und die bäuerliche Mentalität im frühen Mittelalter zu erfahren. Die schriftlichen Zeugnisse über Bauern stammen nämlich ausschließlich aus Fremdzeugnissen, verfasst von den kirchlichen Grundherren oder von Theologen, in deren Traktaten und Heiligenviten die ländliche Bevölkerung Erwähnung fand. Dennoch zeigen die Quellen, dass die Angehörigen der bäuerlichen Schichten bereits im frühen Mittelalter mobil waren – sowohl geografisch, etwa durch das Verlassen einer Grundherrschaft, als auch sozial, etwa aufgrund von Heirat oder von Funktionen in der grundherrschaftlichen Verwaltung. Über das Ausmaß dieser Mobilität wird weiterhin diskutiert. Was die Mentalität der Bauern betrifft, so sind wohl viele übliche Vorurteile (konservatives Weltbild, Friedfertigkeit, Sesshaftigkeit und Aberglaube) falsch oder zumindest nicht belegbar. Dagegen zeigen verschiedene überlieferte Texte, dass die Bauern versuchten, ihren Besitzstand zu wahren oder zu verbessern, dass sie dem Familienverband große Bedeutung beimaßen und dass sie ihre persönliche Freiheit mit Vehemenz verteidigten. In der Vita des heiligen Gerald von Aurillac (855–909) aus dem 10. Jahrhundert begegnet der Heilige einer Bauersfrau am Pflug:
Читать дальше