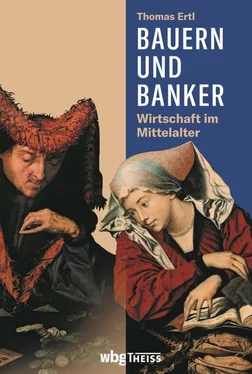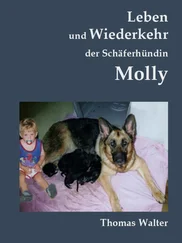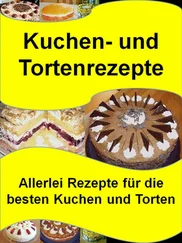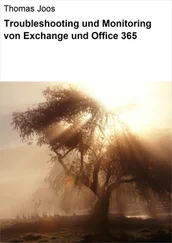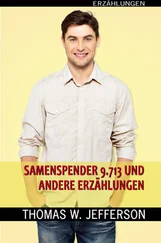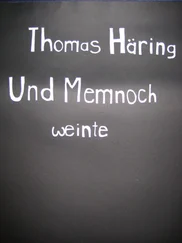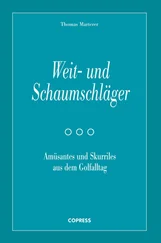Die mittelalterliche Wirtschaft entfaltete sich aufgrund dieser Prozesse in einem neuartigen politischen Rahmen. Die barbarischen Könige und Heerführer sahen sich nach der Errichtung ihrer Reiche auf römischem Boden als Nachfolger der römischen Kaiser und eigneten sich die kaiserlichen Ländereien an. Auch schriftliche Verwaltungspraktiken wie die gesta municipalia, die städtischen Dokumentenregister, und Steuerlisten wurden von den germanischen Königen und ihren Verwaltungen zunächst weitergeführt. Gleichzeitig übertrugen die Könige, die häufig einer einflussreichen und selbstbewussten Führungsschicht gegenüberstanden, immer mehr Krongüter an die Kirche und den Adel, um sich auf diese Weise ihre Loyalität zu sichern. Die dauerhafte Entfremdung dieser Güter ließ sich nicht aufhalten, obwohl Karl Martell und andere dem entgegenzutreten versuchten. Entsprechend passten sich die staatlichen Strukturen in den frühmittelalterlichen Königreichen auf ehemals römischem Boden sukzessive den veränderten Gegebenheiten an: Die Könige besaßen keinen Verwaltungsapparat, der ihnen den Zugriff auf das gesamte Land und alle Untertanen erlaubt hätte. Finanziert wurden die Königsherrschaft und das Militär nur noch teilweise aus Steuern, daneben aber durch Einnahmen aus den königlichen Grundherrschaften (Domänen), okkasionellen Abgaben, Strafen und Zöllen, der Vergabe von Land sowie durch Kriegsbeute. Die Mediatisierung der Staatsgewalt, die in der Spätantike im weströmischen Reich begonnen hatte, setzte sich fort. Allerdings herrscht in der Frühmittelalterforschung kein Konsens darüber, ob das römische Steuersystem gänzlich untergegangen war, ob die Kirche es zumindest teilweise übernommen hatte oder ob die karolingischen Polyptycha des 9. Jahrhunderts sogar als eine Fortsetzung der antiken Steuerregister zu deuten sind. Als Polyptycha (von altgriechisch »vielfach gefaltet«) werden Besitz- und Abgabenverzeichnisse karolingischer Klöster bezeichnet.
Zweifellos lebten administrative Strukturen zur Finanzierung der Herrschaft und zur Rekrutierung des Heeres sowie einzelne Abgaben, die im römischen Imperium von der Bevölkerung geleistet wurden, in veränderter Form in den frühmittelalterlichen Grundherrschaften weiter.
Am Übergang zum Mittelalter ging der Wohlstand weiter Teile der Bevölkerung zurück, sowohl der Bauern als auch der Eliten. Es kam zudem zu einer Ruralisierung, einer Bevölkerungsverschiebung von der Stadt auf das Land. Viele Städte schrumpften und ihre ehemals öffentlichen Flächen füllten sich mit privaten Bauwerken oder wurden landwirtschaftlich genutzt. Auf dem Land entstanden kleine Dörfer und Weiler. Zeugnisse für diese Wandlungsprozesse sind indes selten und hauptsächlich archäologischer Natur, beispielsweise der Rückgang von Funden hochwertiger Keramik oder das vermehrte Aufkommen simpler Holz- und Grubenhäuser. Alle Regionen waren von diesem Wandel berührt – besonders Italien, das im 6. Jahrhundert in der Folge der Gotenkriege und der Reichsgründung der Langobarden politisch fragmentiert und wirtschaftlich ruiniert wurde. Kriege und Gewaltexzesse prägten die Geschichte des fränkischen Reichs seit dem 6. Jahrhundert. Doch König, Kirche und Aristokratie im Frankenreich gelang es besser als den Eliten in anderen germanischen Königreichen, die ländlichen Regionen zu durchdringen und auf dieser Grundlage Militärorganisation und Münzprägung lokal zu verankern. Der Zugriff auf die landwirtschaftlichen Ressourcen und die räumliche Ausweitung von Rodungen wurden auf diese Weise ebenfalls vorangetrieben. Aus der wachsenden Schicht reicher Grundherren bildete sich eine Reichsaristokratie mit fränkischer Identität.
In diesem politischen Rahmen entstand die mittelalterliche Grundherrschaft – allerdings gehen die Meinungen über deren Ausbreitung und Formenvielfalt in der Forschung weit auseinander. Der Begriff Grundherrschaft bezeichnet die rechtlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen einem Grundherrn und den Personen, die auf seinem Land wohnen und arbeiten. Die Bauern standen in sehr unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnissen zum Grundherrn. Für die Überlassung von Land hatten sie verschiedene Abgaben zu leisten und waren teilweise zu Frondiensten verpflichtet. Die Abgaben in Geld und Naturalien sowie die Frondienste waren stark von lokalen Gegebenheiten geprägt. Die Gesamtheit der abhängigen Bauern bildete zudem keine homogene soziale Gruppe, sondern setzte sich aus Freien, Halbfreien und Unfreien zusammen, die unterschiedliche Leistungs- und Abgabepflichten hatten und verschiedene Funktionen in der Grundherrschaft ausübten. Selbst innerhalb des fränkischen Reichs war die Formenvielfalt so groß, dass Ludolf Kuchenbuch den Vorschlag machte, auf den Begriff Grundherrschaft gänzlich zu verzichten. Vermutlich lässt sich der Begriff jedoch weiterhin sinnvoll gebrauchen, vorausgesetzt, dass damit nicht eine bestimmte Herrschafts- und Betriebsform verstanden wird.
Die zweigeteilte (bipartite) Grundherrschaft, Villikation genannt, bestand aus dem Salland (Herrenland) und abhängigen Bauernstellen (Mansen / Hufen / Huben). Das Salland wurde von Hörigen bewirtschaftet, die auf dem Hof des Grundherrn wohnten, während das Hufenland stückweise an Bauern und ihre Familien ausgegeben wurde. Die Hufenbauern bewirtschaften diese Güter selbstständig und leisteten dafür Abgaben; zusätzlich waren sie zu Frondiensten auf dem Salland verpflichtet. Beauftragte des Grundherrn, Meier genannt (villicus), sorgten für die Übergabe der Abgaben aus den verstreut liegenden Hufen, gehörten sozial aber ebenfalls der bäuerlichen Schicht an. Eine feste, generationenübergreifende Hierarchie von Meiern und Funktionsträgern hatte sich in den Dörfern der abhängigen Bauern noch nicht gebildet. An den Fronhöfen arbeiteten hörige Handwerker für den Bedarf des Hofes und teilweise wohl auch für den örtlichen Markt. Frauen und Mädchen verrichteten in eigenen Tuchwerkstätten (genitium / Gynäceum) Spinn- und Webarbeiten für die Grundherrn. In der bayerischen Grundherrschaft Staffelsee gab es beispielsweise eine Tuchmacherei, in der 24 Frauen arbeiteten.
Die überlieferten Urkunden von Klöstern wie beispielsweise St. Gallen sowie die Besitz- und Abgabenverzeichnisse (Polyptycha) karolingischer Klöster wie Saint-Germain-des-Prés bei Paris, Saint-Remi in Reims, Montier-en-Der bei Saint-Dizier, Sankt-Peter in Gent und Prüm in der Eifel bilden die ältesten Zeugnisse für diese Form der Grundherrschaft mit Salland und Hufenland. Über die Verbreitung der Villikation gehen die Ansichten abermals auseinander. Ein Teil der Forschung vermutet, dass die klassische Villikation auf bestimmte Regionen des Frankenreichs mit guten Böden für den Getreideanbau und günstigen Siedlungsverhältnissen beschränkt geblieben ist. Dagegen wurde eingewandt, dass es vermutlich wenig sinnvoll ist, die frühmittelalterliche Grundherrschaft in Zonen mit unterschiedlichen Agrarverfassungen einzuteilen, weil Mischformen die Regel waren. Solche Mischformen wurden bereits innerhalb einer Grundherrschaft praktiziert, beispielsweise vom Kloster Werden, das zwar Sal- und Hufenland besaß, von den Bauern auf entfernten Höfen hingegen hauptsächlich Abgaben erhielt und keine Frondienste forderte.
Der weltliche Adel bezog seine Natural- und Geldeinkünfte ebenfalls aus großen und kleinen Grundherrschaften. Da Urbare des Adels erst seit dem 13. Jahrhundert überliefert sind, ist die Erforschung der weltlichen Grundherrschaft im frühen und hohen Mittelalter auf andere Quellen wie Traditionsurkunden (Schenkungs- oder Tauschurkunden) oder Chartulare, in denen Urkundeneingänge an einen bestimmten Empfänger gesammelt wurden, angewiesen.
Im Capitulare de villis (um 800) entwarf Karl der Große ein Reformprogramm für die königlichen Grundherrschaften, auf deren Erträge er bei seinen ständigen Reisen durchs Land angewiesen war. Das Kapitular widmet sich vor allem dem Wein- und Obstbau sowie der Viehzucht. Detailliert werden einzelne Arbeitsabläufe beschrieben, um die Erträge der Betriebe zu steigern und die Versorgung des Hofes zu gewährleisten. Im 70. Kapitel werden 73 Nutzpflanzen und 16 verschiedene Obstbäume genannt, die angepflanzt werden sollten, falls es die klimatischen Gegebenheiten zulassen würden. Über die Aufgaben der königlichen Verwalter heißt es unter anderem:
Читать дальше