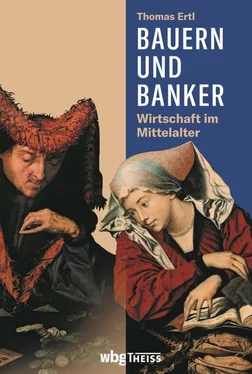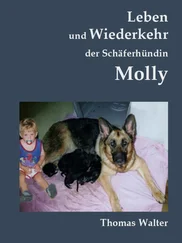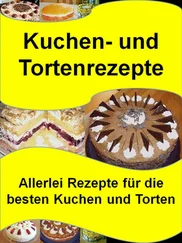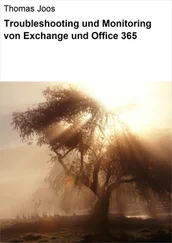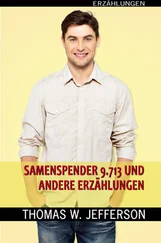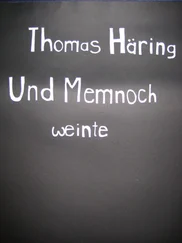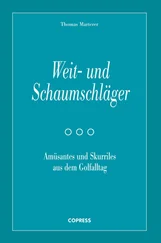Das persische Rad (Persian wheel): Mechanische Wasserhebevorrichtungen waren in der islamischen Welt seit dem frühen Mittelalter in Gebrauch – und blieben es mancherorts bis ins 20. Jahrhundert. Hier die Abbildung eines von Ochsen betriebenen Wasserschöpfwerks in Ägypten.
Für die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte und anderer Rohstoffe verbreiteten sich in der islamischen Welt bereits früh moderne Techniken, die zum Einsatz von vielen unterschiedlichen Wind- und Wassermühlen führten, mit denen Textilien, Getreide und andere Nahrungsmittel verarbeitet wurden. Zur Versorgung der Landwirtschaft wurden Dämme und Wasserschöpfräder angelegt. Die Textilverarbeitung erfolgte in privaten Unternehmen, aber auch in den Tiraz-Werkstätten des Kalifen und anderer Herrscher. Die Arbeitsteilung sowie der Anteil von Frauen in verschiedenen Berufen waren groß. Viele dieser Gewerbe waren in den Städten angesiedelt, deren Zahl und Größe im frühen Islam rasch zunahm.

Tiraz-Fragment (Irak, um 1000): Tiraz waren hochwertige Stoffe mit Schriftbändern, die in Werkstätten am Hof hergestellt und als Ehrengewand an Höflinge und Botschafter verschenkt wurden. Die Inschrift umfasst meist eine Lobpreisung Allahs, des Propheten und des amtierenden Kalifen. Ibn Khaldun (1332–1406) schrieb über die Funktion dieser Textilien: »Mit dieser Bortenstickerei an den Gewändern der Herrscher ist beabsichtigt, das Prestige desjenigen zu erhöhen, der ein solches Gewand trägt – sei es der Machthaber selbst oder einer, der unter ihm steht, oder einer, den der Machthaber mit dem von ihm getragenen Gewand auszeichnet, weil er ihn ehren will oder ihn in eines der Ämter seiner Dynastie beruft.«
Aufbauend auf griechischen und hellenistischen Traditionen erörterten muslimische Gelehrte seit dem 8. Jahrhundert Wirtschaftsfragen wie Besteuerung, öffentliche Finanzen, landwirtschaftliche Anbaumethoden und die Vorteile der Arbeitsteilung. Zu Recht wurde von der islamwissenschaftlichen Forschung daher die Ansicht zurückgewiesen, dass es in der Geschichte des Wirtschaftsdenkens im Westen (Europa und Mittelmeerraum) zwischen der Spätantike und Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert eine 500 Jahre dauernde Lücke (Great Gap) ohne nennenswerte wirtschaftliche Ideen gegeben habe. Möglicherweise wurde die Aufgeschlossenheit muslimischer Gelehrter gegenüber wirtschaftlichen Themen unter anderem durch einzelne Textstellen im Koran und zusätzliche Aussagen Mohammeds, der selbst als Kaufmann tätig gewesen ist, gefördert. Im Vergleich mit der frühmittelalterlichen Christenheit im westlichen Europa stand die muslimische Elite der Wirtschaft im Allgemeinen und kaufmännischer Tätigkeit im Besonderen aufgeschlossener gegenüber. Ob dies Auswirkungen auf das reale Wirtschaftsleben hatte, lässt sich schwer messen. Das dokumentierte Interesse der Gelehrten an Wirtschaftsfragen entspricht indes der insgesamt positiven Wirtschaftsentwicklung in der islamischen Welt zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.