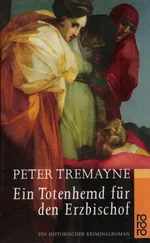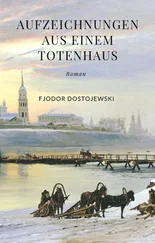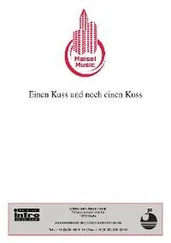Das Frühjahr ging dahin und auch die Hitze des Sommers. Die Tage wurden kürzer, dunkler und kälter. Wenn ihre Münder sich jetzt berührten, so routiniert, als würden sie das öfter tun, war sie in wärmere Kleidung gehüllt. Seine Fantasie musste einige Gewänder mehr durchdringen, wollte er sie sich vorstellen, wie er sie nie erblickt hatte.
Und wenn Elias sich nach dem Training aufs Bett warf, nur so dalag, ausgepumpt und angenehm durchblutet von den sportlichen Aktivitäten, gingen ihm die Worte durch den Sinn, die Franziska ihm unlängst auf der Jahnwiese ins Ohr geflüstert hatte: »Das wird eine gute Zeit mit uns beiden. Du darfst mich anfassen, hier und da, aber nicht überall – und du darfst mich küssen. Und dies hier – mein Bruder, blond wie du, schlank wie du, hat es bei seiner letzten Untersuchung geschenkt bekommen – sollst du nun tragen. Er ist allergisch gegen das Material.«
Die Arme, hinter dem Kopf verschränkt, hielten sein Haupt umschlungen. Ihr Präsent, das Amulett mit seinem und ihrem Bild darin, ruhte auf seiner Brust, in Höhe des Sternums. Der eingravierte Torjäger schimmerte silbern im schwindenden Tageslicht. Die Sonne verschwand hinter Blautannenspitzen und sandte letzte, glutrote Strahlen. Ihr verglimmendes Licht auf einen anderen Himmelskörper übertragend, verschied sie, und am dunkler werdenden Firmament erschien blass der Mond.
Und eines Tages schrieben Presseleute:
Das Szenario hatte etwas Beklemmendes. Polizisten des Unfallteams fotografierten gestern Abend einen neonfarbenen Sportschuh an einem Gleisüberweg auf der Aachener Straße in Höhe Haus 598. Er gehörte dem 14-jährigen Elias, der unweit der elterlichen Wohnung von einer Straßenbahn der Linie 7 frontal erfasst und mitgeschleift wurde.
an Elias war noch präsent, als Balder den Friedhof verließ und durch den Nieselregen heimfuhr, in sein kleines Apartment, das durch eine Tür mit dem Atelier verbunden war. Indes er in die Goltsteinstraße einbog – sie gingen schon lange getrennte Wege, sprachen wenig miteinander – stieg Elias’ Mutter, noch gerührt von der Anteilnahme, in Haus 592 die Stufen zum zweiten Stock empor. Öffnete und schloss hinter sich die Wohnungstür. Legte den Schlüsselbund auf der Kommode im Flur nieder. Entledigte sich ihres Mantels, ihrer Schuhe, an deren Sohlen noch Friedhofserde klebte. Begab sich in die gute Stube. Ließ sich auf die Couch sinken. Sah sich weinen. Hörte sich aufschluchzen. War ohne Hoffnung gewesen und hatte doch, in der Kapellenbank sitzend, die ganze Andacht über zu dem Mann Gottes hochgeschaut, als könnte er ihn wieder lebendig machen mit seinen salbungsvollen Worten, ihren Sohn, der auf einem der vielen Fotos, die sie erst vor Tagen gerahmt und verglast hatte, in weißen Nike-Turnschuhen, dreiviertellanger Jeans, halbärmeligem T-Shirt, die Daumen leger in die Hosentaschen eingeklinkt, mit seinem Freund Lukas vor dem Gymnasium Kreuzgasse stand, mit Gliedmaßen dünn wie Spargelstangen.
Am späten Nachmittag legte sie sich in Elias’ Hochbett und dämmerte im Halbdunkel bis in die Abendstunden vor sich hin.
Im spärlichen Licht einer nahen Straßenlaterne, das von draußen einfiel, tasteten ihre Hände wie zwei losgelöste Wesen mit spitzen Fingernägeln, unlackiert, nach etwas, das sich im abgelösten Nahtbereich einer schlecht verklebten Raufaserbahn, direkt über ihr, an der Zimmerdecke, oberhalb des Hochbetts, versteckte. Als sie es herauszog, vorsichtig, ganz vorsichtig, kam ein Ring zum Vorschein, in beschriebenes Papier eingewickelt. Sie erkannte Elias’ Handschrift, wusste die Worte einzuordnen, die er Franziska auf der bevorstehenden Klassenfahrt ins Ohr geflüstert hätte. Mehrere solcher Klebezettel mit ähnlichem Wortlaut hatten unlängst zerknüllt im Papierkorb seines Zimmers gelegen.
Diese Zeilen vor Augen, sah sie im Geiste vor sich, wie er Franziska den Freundschaftsring darbot, dabei über sie hinwegblickte und sich ihr, seiner Mutter, zuwandte. Auch wenn sein Gesicht zunächst noch unvollendet blieb, so wanderten Grübchen kess über ein Antlitz, das sich anschickte, für sie ein Lächeln zu formen. In dem Maße, wie es sich verbreiterte, nahm es ihrer mütterlichen Miene die herben Züge bitterer Kümmernis. Sie machte in Gedanken einen Schnappschuss von der Szene, die ihre Vorstellungskraft ihr eingab, bevor sie sich aus dem Hochbett erhob. Den Besten, seit sie Elias verloren hatte.
Spätabendlicher Nebel hing zwischen den kahlen, vermeintlich toten Novemberbäumen, die den Rasen auf der Gebäuderückseite umstellten, als Elias’ Mutter die Küche betrat. Mechanisch steckte sie zwei Scheiben Vollkornbrot in den Toaster. Hielt einen Moment inne. Ließ ihre Hand auf dem Hebel ruhen. Hatte eine Assoziation und verweilte gedanklich einen Augenblick in dem Moment, diesem alles entscheidenden Moment, der zu lange angedauert hatte. Drückte abrupt den Hebel nach unten, ähnlich dem Handgashebel, den der Fahrer der Linie 7 viel zu spät in Bremsstellung umgelegt hatte. Nahm Butter, Wurst, Käse und diverse Soßen aus dem Kühlschrank. Füllte etwas zum Knabbern und Dippen aus einer bunten Packung in eine Schale aus Porzellan in der Gewissheit, dass dies Elias’ Lieblingscracker waren. Gab alles auf ein Tablett und trug es hinüber zum Esstisch ins Wohnzimmer. Fabulierte, der Junge werde gleich frisch geduscht und hungrig vom Training kommen. Dachte in der Zwischenzeit an etwas Stämmiges, um die 50, mit wenig Haar. Das könne man mit Gehirntätigkeit nicht erklären, das sei pubertäres Verhalten, da seien Ampeln völlig uninteressant, hatte sie sich als Argument, als Versuch einer Erklärung, wie es zu dem Unfall kam, während der zeugenschaftlichen Vernehmung zum Tagesablauf ihres Sohnes anhören müssen.
Jenseits dieser Zwischenzeit stand sie hinter Elias’ angestammtem Platz – ein IKEA-Korbsessel – und streichelte in Gedanken sein nach Apfel-Shampoo duftendes Haar. Flüsterte immerzu, während sie verzweifelt versuchte, den verbliebenen Hauch seines Duftes in sich aufzunehmen, »was hast du nur gemacht« in ein nie dagewesenes Schweigen. Dabei hörte sie so gern seine Stimme.
Namen auf einer Liste, ohne Gesichter
30. November 2007 – immer noch. Den Nachmittag über hatte Balder auf der Couch gelegen, in seinem karg eingerichteten Apartment, das ihm einen Platz bot, worauf er sitzen und denken konnte, und auf die Nacht gewartet und die Nachtgedanken. Und nun fröstelte ihn.
Während er seinen Blick, der Müdigkeit und Erschöpfung verriet, zur Matratze schweifen ließ, die auf dem Boden vor dem verschraubten Schrankbett lag, dessen beide Gasfedern unlängst den Geist aufgegeben hatten, überlegte er, ob er den Alten mit der für gesunde Menschen unbegreiflichen Reizbarkeit herausklingeln sollte, der eine Etage tiefer wohnte.
Sein Paroxetin ging zur Neige.
Bis der emeritierte Hirnchirurg sich endlich aus dem Bett gequält hätte – er pflegte Tranquilizer mit stark sedierender Wirkung einzunehmen, die Balder ihn anflehen würde, mit ihm zu teilen –, wäre eine geraume Weile vergangen. Und der tags mit Haldol, nachts mit Diazepam und anderen Präparaten ruhiggestellte Mann würde ihn anhören, seine Leidensgeschichte über sich ergehen lassen, ohne eine Miene zu verziehen, und Balder dann zu verstehen geben, dass das Gehirn, wie er beim Öffnen unzähliger Schädel erkannt habe, zwar entscheidend für das bewusste Empfinden von Schmerz sei, selbst aber keinerlei Schmerz empfände.
Mit dieser Szenerie im Kopf und dem Entschluss, sich am nächsten Tag, oder am übernächsten, an dessen Tablettenvorrat zu bedienen – zwei Schubladen voll mit Schachteln, Röhrchen, Plastikdosen und losen Blisterpackungen von Valium über Antidepressiva bis hin zu Anxiolytika – starrte er düster auf das Foto an der Wand. Der darauf Abgebildete warf lauthals lachend den Kopf in den Nacken.
Читать дальше