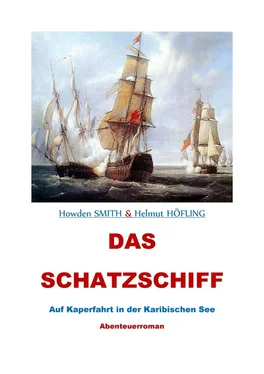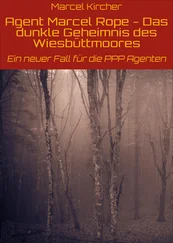Mein Vater hatte es schwer, gegen diesen Redestrom aufzukommen, und freute sich jedes Mal, wenn es ihm gelang.
„Ich habe immer geglaubt“, sagte er, „dass Kapitän Rappee während des letzten Krieges aus Westindien verschwunden ist.“
Kapitän Farraday zuckte die Achseln. „Möglich. In jenen Gewässern waren ihm bestimmt zu viele Kreuzer beider Parteien unterwegs. Aber jetzt weiß er, dass wir wieder flaue Friedenszeiten haben. Und wenn die Nationen in Frieden leben, dann halten die Piraten ihre Ernte.“
Kapitän Farraday stampfte zur Georgs-Taverne hinüber, gefolgt von einem Schwarm Neugieriger. Ich grinste in mich hinein, als ich an all die Flaschen und Gläser dachte, die sie ihm zum Dank für sein Seemannsgarn anbieten würden. Er hatte nicht die geringste Aussicht, innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden nüchtern zu sein.
Zerstreut nickte mein Vater zu Peter hinüber, der während des ganzen Gesprächs ruhig dagestanden hatte, das platte Gesicht schläfrig und unerschütterlich.
„Das Ganze gefällt mir nicht“, murmelte mein Vater.
Peter warf ihm einen scharfen Blick zu, sagte jedoch kein Wort.
Wir entfernten uns über das schneebedeckte Pflaster. Die Leute, an denen wir vorüberkamen, verbeugten sich vor meinem Vater oder zogen die Hüte. Er war ein großer Herr in New York: so groß wie nur irgendeiner nach dem Gouverneur. Aber er schritt nun mit gesenktem Blick dahin, tief in Gedanken versunken. Und als wir in die Pearl Street einbogen, murmelte er von neuem:
„Nein, es gefällt mir nicht… Es gefällt mir nicht…“
Darby McGraw begegnete uns an der Tür. Seine wilden Blicke verrieten mir, dass er eigentlich erwartet hatte, die Piraten dicht auf unseren Fersen auftauchen zu sehen.
„Hast du deine Arbeit erledigt, Darby?“, fragte ihn mein Vater, als sich der Bursche rückwärts ins Kontor zurückzog.
„Ja, Master.“
„Dann scher dich fort! Ich wünsche nicht gestört zu werden!“
„Vielleicht kannst du ein paar neue Nachrichten über die Piraten auftreiben, Darby“, fügte ich hinzu, als er an mir vorbeischlüpfte.
Er antwortete mir mit einem komischen, mürrischen Blick, ohne jedoch ein Wort zu sagen.
Dafür drehte sich mein Vater rasch auf dem Absatz nach mir um. „Was meinst du damit, Robert?“
Ich war verwirrt und stammelte: „Nun, weiter nichts, Vater… Darby ist versessen auf Piraten… Er…“
Peter Corlaer schloss hinter dem irischen Jungen die Zimmertür und kam auf uns zu, mit dem flinken, verstohlenen Gang, der eine seiner erstaunlichsten Eigenschaften war.
„Jo, er weiß es nicht“, fiel er mir ins Wort.
„Was?“, forderte ihn mein Vater heraus
„Wat Sie und ich wissen“, erwiderte der Holländer gelassen.
„Dann wissen Sie es also auch, Peter?“
„Jo.“
„Was ist das für ein Geheimnis?“, forschte ich.
Mein Vater zögerte und sah zu dem Holländer hinüber.
„Peter, dürfen wir es dem Jungen sagen?“
„Er is keine Junge mehr“, erklärte Peter. „Er is jetzt eine Mann.“
Ich bedankte mich bei dem fetten Holländer durch ein flüchtiges Lächeln, aber er beachtete es gar nicht.
Mein Vater schien mich zu vergessen. Er schritt im Kontor auf und ab, die Hände unter den Rockschößen und den Kopf sinnend gebeugt. Einzelne Gedanken murmelte er vor sich hin in kurzen, abgehackten Sätzen, als spräche er zu sich selbst.
„Ich habe ihn bisher für tot gehalten… Seltsam, wenn er wieder auftauchte… Aber vielleicht übertreibe ich… Nein, es kann keine Bedeutung für uns haben… Es muss ein Zufall sein… Ganz bestimmt!“
„Nein, er hat wat vor“, unterbrach ihn Peter.
Dicht vor Peter blieb mein Vater stehen. Er stand neben dem Kamin, in dem ein Stoß Buchenscheite loderte.
„Ja, Peter, Sie haben recht: Robert ist kein Junge mehr. Wenn uns von Rappee Gefahr droht, muss er erfahren, wer Rappee ist.“
„Es is Murray“, erklärte Peter Corlaer mit seiner quäkenden Stimme, die in lächerlichem Gegensatz zu seinem ungeheuren Leibesumfang stand.
„Ja, Andrew Murray“, bestätigte mein Vater nachdenklich. „Ich habe es all die Jahre geahnt – und manchmal sogar für sicher gehalten.“
„Ganz gleich, wer er ist: Vor diesem Seeräuber brauchen wir uns in New York nicht zu fürchten“, behauptete ich zuversichtlich.
„Sei lieber auf der Hut, Robert!“, mahnte mein Vater. „Zufälligerweise ist er nämlich dein Großonkel.“
Er langte auf das Gestell überm Kamin hinauf und suchte sich eine lange Tonpfeife aus, die er mit Tabak stopfte.
Nur mühsam erholte ich mich von meinem Erstaunen.
„Dein Onkel…?“, stieß ich schließlich hervor.
„Nein, Andrew Murray ist nicht mein Onkel, sondern der Onkel deiner Mutter.“
„Aber das war ja der große Händler, der den Schleichhandel mit Kanada organisiert hat!“, rief ich. „Ich habe von ihm gehört. Er hatte den Todespfad angelegt, um die französischen Pelzhändler mit Waren versorgen zu können und die Indianer von uns abtrünnig zu machen! Du selbst hast mir von ihm erzählt – und auch Master Colden. Ihr habt mit ihm gekämpft – du und Peter und die Irokesen -, als euch der Durchbruch durch die Schanzen des Todespfades gelungen war. Dadurch konnten unsere Leute endlich wieder mit Pelzen handeln.“
Mein Vater nickte, und ich fuhr lebhaft fort:
„Dann war es also damals, dass du Mutter – ich meine…“
Ich stockte. Die tiefen Gefühle, die mein Vater immer noch für meine längst verstorbene Mutter hegte, kannte ich gut. Deshalb scheute ich mich, seine Erinnerungen wachzurufen.
Doch er fuhr selbst fort:
„Ja, damals habe ich mich in deine Mutter verliebt. Sie – sie sah nicht so aus, als könnte sie mit einem so großen Schurken verwandt sein. Aber sie war seine Nichte. Daran bestand leider kein Zweifel, Robert. Sie war eine geborene Kerr von Jernieside – und ihre Mutter eine Schwester Murrays. Kerr und Murray rückten 1715 zusammen ins Feld. Kerr fiel bei Sheriffmuir. Da seine Witwe kurz darauf starb, nahm Murray die arme verwaiste Marjory zu sich. Er hat sie gut behandelt – das kann man ihm nicht abstreiten. Aber er handelte nicht aus reiner Nächstenliebe. Vielleicht wollte er sie dazu benutzen, seine eigenen Pläne zu fördern. Er blickte klar und berechnend in die Zukunft und dachte dabei an nichts anderes als an seinen eigenen Vorteil. Nun, Robert, du weißt ja, wie Peter Corlaer, der Seneka-Häuptling Tawannears und ich die ungeheure Streitmacht aufgerieben haben, die Murray an der Grenze zusammengetrommelt hatte.“
„Ja, ihr habt ihn restlos geschlagen“, pflichtete ich meinem Vater bei.
„Nicht nur das“, fiel mein Vater lebhaft ein. „Wir haben auch dafür gesorgt, dass sein schlechter Ruf überall bekannt wurde. Dadurch zwangen wir ihn, aus der Provinz zu fliehen. Sogar seine Freunde, die Franzosen, wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben – wenigstens nicht offen. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass er ihren Zielen noch immer irgendwie dient. Denn im Grunde ist er ein äußerst fanatischer Jakobit und sogar sehr aufrichtig. Bestimmt ist er fest davon überzeugt, dass alles, was er tut, hohen Staatszwecken dient.“
„Nur ein Irrsinniger kann behaupten, als Seeräuber dem Staat zu dienen“, rief ich zornig.
„Du urteilst allzu vorschnell“, wies mich mein Vater zurecht. „Heute lebt noch mancher, der sich an die Zeiten erinnern kann, als Morgan, Davis, Dampier und andere tapfere Burschen vom gleichen Schlag Seeräuber waren und doch gleichzeitig dem König dienten. Ein paar von ihnen wurden schließlich am Galgen aufgeknüpft. Aber Morgan starb als Ritter. Ja, mein Junge, es lässt sich also schon machen: Seeräuber und Staatsdiener zugleich zu sein.“
„Aber wie?“
Читать дальше