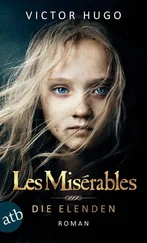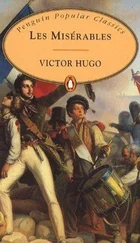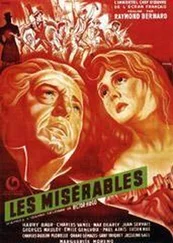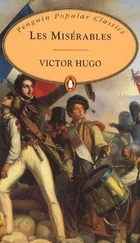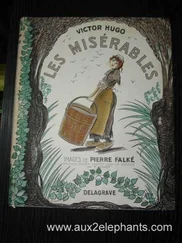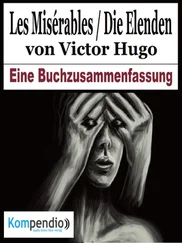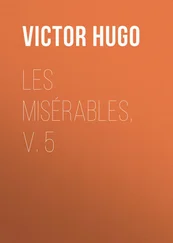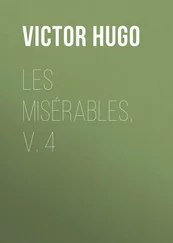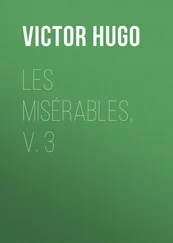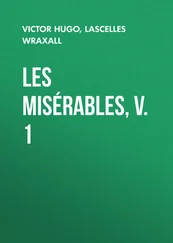Diese Aeußrung war ein Funke, auf den die andre Mutter gewartet zu haben schien. Sie ergriff die Hand der Thénardier, sah ihr ins Auge und fragte:
»Wollen Sie mein Kind eine Zeit lang bei Sich behalten?«
Die Thénardier machte eine Gebärde des Erstaunens, die weder Ja noch Nein bedeutete.
Cosettens Mutter fuhr fort:
»Sehen Sie, ich kann die Kleine nicht mitnehmen. Ich würde keine Arbeit bekommen, denn in meiner Heimat sind sie lächerlich in dieser Hinsicht. Der liebe Gott hat mich zu Ihnen hergeführt. Als ich Ihre allerliebsten, so reinlich gehaltnen und vergnügten Kinderchen gesehen habe, da ist mir ganz eigen zu Muthe geworden. Ich habe gedacht, das muß eine gute Mutter sein. Sie haben Recht: Die drei passen zu einander, als wenn's Schwestern wären. Außerdem bleibe ich auch nicht lange weg. Wollen Sie mir also bis dahin meine Kleine hier behalten?«
»Man müßte sich die Sache überlegen,« meinte die Thénardier.
»Ich würde sechs Franken den Monat geben.«
Hier ließ sich aus dem Hause eine Männerstimme vernehmen.
»Nicht unter sieben Franken. Und sechs Monate pränumerando.«
Sechs mal sieben macht zweiundvierzig, berechnete die Thénardier.
»Gut«, sagte die Fremde.
»Und außerdem fünfzehn Franken für die ersten Auslagen.«
»Im Ganzen siebenundfünfzig Franken, fuhr die Thénardier fort und sang ihre liebliche Romanze weiter:
Es muß sein, so sprach der Krieger.«
»Die sollen Sie haben,« sagte Fantine. Ich habe achtzig Franken. Da bleibt mir noch Geld genug übrig, um nach meinem Ort zu reisen, – wenn ich zu Fuß gehe. Wenn ich dort ein wenig Geld verdient habe, komme ich wieder und hole mir mein Herzenskleinod ab.«
Aus dem Hause rief es wieder:
»Die kleine hat doch eine Ausstattung?«
»Mein Mann!« erklärte die Thénardier.
»Nun natürlich hat sie eine Ausstattung. Ich habe mir gleich gedacht, daß es ihr Mann war. Sogar eine sehr statiöse, großartige! Alles dutzendweise, und Seidenkleidchen, wie das feinste Fräulein sie nicht besser haben kann. Ich habe Alles bei mir, in dem Reisesack.«
»Das müssen Sie mitgeben!« rief der Mann wieder.
»Nun natürlich bekommt sie's mit. Das wäre ja noch schöner, wenn ich meine Tochter ohne Kleider ließe!«
Jetzt trat der Hausherr aus dem Hintergrunde hervor.
»Ich bin's zufrieden.«
Der Handel wurde also abgeschlossen. Fantine übernachtete in der Herberge, zahlte das Geld aus und machte sich ohne ihr Kind und mit dem stark zusammengeschrumpften Reisesack am nächsten Morgen wieder auf den Weg, indem sie darauf rechnete, bald wieder zurückkommen zu können. Eine solche Abreise läßt sich ruhigen Herzens beschließen, aber ist der Augenblick gekommen, so bringt sie Einen an den Rand der Verzweiflung.
Eine Nachbarin der Thénardier begegnete Fantinen, als sie ohne ihr Kind von dannen ging, und erzählte ihnen:
»Ich habe so eben auf der Straße eine Frau weinen sehen, daß es herzzerreißend war.«
Als Cosettens Mutter fort war, sagte Thénardier zu seiner Frau:
»Nun kann ich die hundert und zehn Franken bezahlen die morgen fällig werden. Es fehlten mir noch fünfzig Franken. Der Wechsel wäre mir faktisch protestirt worden, und wir hätten den Exekutor auf den Hals gekriegt. Die kleine Maus hast Du gut geködert mit deinen Jöhren.«
»Ohne mir was dabei zu denken,« entgegnete die Frau.
II. Erste Skizze zweier verdächtiger Gestalten
Es war ein armseliges Mäuschen, das sie da gefangen hatten! aber eine Katze freut sich auch über einen magern Fang.
Was waren die Thénardiers für Leute?
Entwerfen wir in kurzen Umrissen ein Bild von ihnen. Wir werden es in der Folge des Näheren ausführen.
Diese Wesen gehörten zu jener Zwitterart von Menschen, die aus ungebildeten Emporkömmlingen und heruntergekommenen gescheidten Leuten zusammengesetzt ist, zwischen dem sogenannten Mittelstande und den unteren Volksschichten steht und einige Fehler der letzteren mit fast allen Lastern des ersteren verbindet, ohne die gutherzigen Regungen des Arbeiters, noch die Ordnungsliebe der wohlhabenden Klassen zu bekunden.
Die Thénardiers waren sittlich unentwickelte Naturen, die unter dem Stachel irgend einer bösen Leidenschaft der ungeheuerlichsten Verbrechen fähig werden. Die Frau war mehr roh und dumm, der Mann mehr Lump und Gauner. Alle Beiden konnten es auf dem Wege, der zur Vollkommenheit im Schlechten führt, sehr weit bringen. Es giebt eben Krebsseelen, die beständig rückwärts gehen, nach der Finsterniß hin, die ihre Erfahrungen nur dazu benutzen, um ihre moralische Verkrüppelung noch zu vermehren und allmählig immer nichtswürdiger zu werden. Zu diesen Naturen gehörten auch die Thénardiers, Mann und Frau.
Er war eine ausnahmsweise unangenehme Erscheinung für den Physiognomiker. Manche Menschen braucht man blos anzusehen, um Mißtrauen gegen sie zu fassen, ein Mißtrauen, das sich nach zwei Seiten hin erstreckt, auf ihre Vergangenheit und auf ihre Zukunft. Ihre Blicke, ihre Gebärden zeugen davon, daß sie schlimme Handlungen hinter und vor sich haben.
Thénardier war, wenn man seinen Angaben Glauben schenken durfte, Soldat gewesen und hatte es bis zum Sergeanten gebracht. In dem Feldzuge des Jahres 1815 sollte er sich sogar besonders ausgezeichnet haben; aber wir werden später auseinander setzen, wie sich die Sache in Wirklichkeit verhielt. Eine seiner Waffenthaten war auf seinem Aushängeschild dargestellt. Er selber hatte das Bild gemalt, denn er verstand von Allem ein wenig, aber Alles schlecht.
Es war damals die Zeit, wo die Romanlitteratur, die sich einst eines Meisterwerks wie »Clölia« rühmen konnte, sich zu nichts Besserem als zu einer »Lodoiska« emporgeschwungen hatte, in der das Scepter von Fräulein von Scuderi und Frau von Lafavette auf Frau Bournon-Malarme und Frau Barthélemy-Hadot übergegangen war und sich dem Niveau des Volkes angepaßt hatte. In dieser Gestalt entflammte der damalige Roman: »Die liebesbedürftigen Seelen der pariser Portierfrauen« und richtete sogar in den angrenzenden Ortschaften arge Verwüstungen in Frauenhirnen an. Auch Frau Thénardier war gerade gescheidt genug, dergleichen Bücher zu lesen. Sie lebte und webte in diesem Unsinn, tauchte ihr bischen Verstand ganz darin unter und erschien in Folge dessen, so lange sie jung war und noch einige Zeit darüber hinaus, als eine sinnige Natur im Vergleich mit ihrem Manne, einem zugleich rohen und pfiffigen Halunken mit einer gewissen Kombinationsgabe und der auch eine gewisse Bildung besaß, es aber in Bezug auf Sentimentalität nur bis zu Pigault-Lebrun's Anschauungen gebracht hatte und sich dem schönen Geschlecht gegenüber immer nur als ein vollendeter Knote betrug. Seine Frau war zwölf bis fünfzehn Jahre jünger, als er. Später aber, als ihre romantischen Schmachtlocken zu ergrauen anfingen, als sich aus einer Pamela eine Megäre entwickelte, war die Thénardier nur noch ein dickes, bösartiges Weibsbild, das sich an dummen Romanen erbaut hatte. Aber Albernheiten ließ man nicht ungestraft. Die Folge bei der Thénardier war, daß ihre älteste Tochter Eponine hieß. Die jüngste wäre beinahe von dem Unglück befallen worden, Gulnare getauft zu werden; glücklicher Weise bewirkte aber ein Roman von Ducray-Duminil eine Ablenkung zu Gunsten des armen Dinges, so daß es mit dem Namen Azelma davon kam.
Beiläufig gesagt war aber nicht Alles lächerlich und oberflächlich an dieser eigentümlichen Zeitepoche, die sich durch die Anarchie der Taufnamen charakterisirt. Neben dem so eben angedeuteten romantischen Element tritt ein andres auf, das symptomatisch ist für gewisse soziale Umwälzungen. Es ist heutzutage nicht selten, daß Ochsenjungen sich Arthur, Alfred, Alfons nennen, und Vicomtes – falls man solche Vicomtes noch sprechen kann, sich an dem simpeln Namen Thomas, Pierre, Jacques begnügen lassen. Diese Verbindungen der »feinen« und der plebejischen Taufnamen verdankt man dem neuen Gleichheitsdrange, dessen unwiderstehlicher Hauch jetzt alles durchweht. Auch diesem scheinbaren Mißklange liegt etwas Großes zu Grunde, die französische Revolution.
Читать дальше