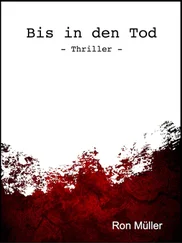„Das Mädchen ist deine neue Spielgefährtin“, antwortete die Tante und runzelte die Stirn. „Wie lange willst du sie denn noch warten lassen?“
„Aber, aber das ist doch ein Spiegel“, entgegnete ich. Mir war nun wirklich eigenartig zu Mute. Wenn ich nur auf diesen Baum gelangen könnte! Wäre er unter meinem Zimmerfenster gestanden, ich schwöre dir, du Leser, ich wäre in einer Nacht- und Nebelaktion dort hineingesprungen. Aber jetzt war kein Fortkommen. Plötzlich lachte die Tante und riss mich aus meinen Freiheitsgedanken.
„Steffi, das ist doch kein Spiegel. Eine verschwommene Glasscheibe ist es, sonst nichts!“
Und sie hatte recht. Denn sie öffnete die Tür und da stand das Mädchen noch im Hausgang. Und als sie hereintrat und die Tür wieder verschlossen wurde, war niemand mehr im Spiegel zu erkennen. Ich hätte mich schon selbst schrecklich schimpfen wollen für die Dummheit, wenn ich nicht zu sehr von dieser Mädchengestalt abgelenkt gewesen wäre.
Sie sah mir gar nicht unähnlich, hatte wie ich schmutzigblondes halblanges Haar, eine schöne kleine Nase und einen ganz leichten Überbiss. Doch waren ihre Augen – soweit das möglich ist – noch geröteter als meine. Und war ich zu diesem Zeitpunkt schon schlanker als früher, so war sie hager. Auch ihr Teint war blasser als meiner. Das merkwürdigste an ihr waren aber ihre Wimpern, die zum Teil an ihrer Iris festzukleben schienen. Vielleicht waren sie der Grund, warum ihre Augen so tränenreich und gerötet waren, ich weiß es nicht. Bis heute nicht.
Nur ein Teil ihrer Wimpern wuchsen mir entgegen, der andere Teil – es war sicher eine gute Hälfte davon – verlief exakt senkrecht über die offenen Augen. Mein erster Gedanke war: Das müssen ja enorme Schmerzen sein, die das Mädchen zu ertragen hat!
Der Schock aber kam, als ich einen Schritt auf sie zutrat, vielleicht, um ihr die Hand zu schütteln oder um sie einzuschüchtern, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich ihr tief in die roten Augen blickte und mich dann ähnlich erschreckte, wie es meine Mutter in ihren letzten Atemzügen getan hatte.
Ich erblickte mein Spiegelbild in ihren Augen. Es war mein Gesicht, das mit doppelter Beklommenheit auf mich zurückstarrte. Doch die senkrecht verlaufenden Wimpern erschufen ein grässliches Gesamtbild. Es sah doch haargenau aus wie eine Gefängniszelle, in der mein blasses Gesicht gefangen war. Ihre Wimpern waren zu Gitterstäben für mein Spiegelbild geworden!
Ich wich vor dem Mädchen zurück und glaubte – es mag Einbildung sein – eine kaum wahrnehmbare Häme über das zarte Gesicht wandern zu sehen.
Tante Trudl schämte sich für mich: „Was ist denn mit dir los? Willst du der Qual nicht guten Tag sagen?“
„Wie heißt sie?“, erwiderte ich unter erstickten Lauten.
Tante Trudl stöhnte. Dann sagte sie: „Steffi, das ist die Qual! Qual, das ist meine Nichte Steffi!“
*
Die Qual verschwand nicht mehr. Sie blieb an mir pappen wie ein Kaugummi und war ebenso eklig und schleimig. Ich hatte bis dato gedacht, dass es das schlimmste wäre, von jemandem gehasst zu werden, den man seinerseits gern mag. Ich bin in der zweiten Klasse mal verliebt gewesen, nein, „verliebt“ war ich vielleicht noch nicht, aber ich hatte mich zumindestens „verschaut“. In einen Buben, der dazu noch unser Klassensprecher war. Aber der hat mich nicht leiden können, ich weiß gar nicht, warum, aber er hat meine Anwesenheit gemieden, wo er nur konnte. Und dabei war er gar kein schüchterner Typ.
Ich meine, das wissen wir doch beide, wie Mädchen und Buben im Laufe der Schulzeit aufeinander reagieren. In der Grundschule verstehen sich die Geschlechter noch ganz gut. In der ersten Klasse ist fast noch kein Unterschied zwischen ihnen zu erkennen. Ab der fünften Klasse dann meiden sich die Geschlechter, es sei denn sie gehen wirklich miteinander. Wenn man beispielsweise zu einer Gemeinschaftsaufgabe mit einem Buben gezwungen wird, muss man „Iiih“ und „Äääh“ sagen, damit niemand denkt, man wäre in ihn verknallt. Das ist der normale Weg der Geschlechter. Hier an diesem Gymnasium ist das allerdings ein bisschen anders. Aber das werde ich ein anderes Mal erzählen, das gehört vorerst nicht hierher.
Der Klassensprecher, in den ich mich verschaut hatte, war also ein ganz aufgeschlossener Typ und – wie gesagt – noch in dem Alter, wo Mädchen und Buben noch keinerlei Berührungsängste haben. Außerdem bin ich nicht hässlich. Das heißt, momentan vielleicht schon, weil ich zu blass und zu dünn bin, aber eigentlich bin ich nicht hässlich. Ich bin auch nicht nervtötend. Du weißt schon, so ein hüpfendes Etwas, das bei Schüchternheit besonders hektisch wird und letztendlich nur noch Schmarrn daherredet. Nein, das bin ich nicht. Ich habe mich in manchen Pausen halt in seiner Nähe aufgehalten und ihn ein paarmal gefragt, ob ich auch mit Fußball spielen dürfte. Und ich durfte. Es gab also gar keine Probleme zwischen uns.
Ja, ja freilich, einmal habe ich in einem unbeobachteten Moment mein Tuschefass schlecht verschraubt in seinen Ranzen geworfen, weil er mich ja nie richtig beachtet hat und ich deswegen wütend war, aber ich hatte schon drauf geachtet, erst das Etikett mit meinem Namen zu entfernen. Er konnte also unmöglich wissen, dass es mein Tuschefass gewesen war, das seine Hefte und Schulbücher ruiniert hatte.
Naja, um wieder zum Punkt zu kommen: Es ist schrecklich, von jemandem gehasst – oder zumindestens ignoriert – zu werden, den man mag. Aber das ist nicht das schlimmste. Das weiß ich jetzt. Das schlimmste ist, von jemandem geliebt zu werden, den man hasst.
So geht es mir seither mit der Qual. Dieses Nachbarsmädchen weicht nicht mehr von meiner Seite, was immer ich tue. Gehe ich durch die Stadt, geht sie mit. Sitze ich am Frühstückstisch vor meiner schwarzen Milch, sitzt sie daneben. Möchte ich mich in meiner Deckenhöhle verstecken, hockt sie bereits darin. Es ist zum Haarausreißen!
Wenn man mit ihr wenigstens schön spielen könnte! Aber selbst das ist mit dieser Person unmöglich! Nach unserer ersten Begegnung hatte uns Tante Trudl auf mein Zimmer geschickt, damit wir uns besser kennen lernen könnten. Als ich die Tür verschlossen hatte, fragte ich an diese schrecklichen vergitterten Augen gewandt, was wir spielen wollten. Da hat sich die Qual auf mein Bett gesetzt und ganz heimtückisch dreingeschaut. Dann wühlte sie in ihrer Tasche und holte ein Feuerzeug heraus.
„Was sollen wir denn damit machen?“, habe ich gerufen.
„Wir knipsen es an und halten es uns, so lange wir können, unter die Handflächen. Wer am ehesten aufgibt, verliert!“, erwiderte das Mädchen.
„Spinnst du?“
„Na, wie wäre es dann hiermit?“
„Eine Münze? Wie sollen wir damit spielen?“
„Münzenroulette!“
„Was soll das sein?“
„Man spannt die Münze mit dem Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger und lässt sie, so fest man kann, auf die Fingerknöchel des anderen schmettern. Wer am Ende die wenigsten Wunden hat, ist Sieger!“
„Bist du bescheuert?“
„Hm ... dann habe ich hier noch Knallteufel. Vom letzten Silvester übriggeblieben. Die könnten wir uns um die Ohren hauen.“
„Mir fehlen die Worte!“
„Was auch nie seinen Spaß verfehlt, ist das Spiel ,Medizinschrank‘!“
„Medizinschrank??“
„Jaja, da geht man zum Medizinschrank und schluckt abwechselnd Medikamente, wartet eine Viertelstunde und erzählt sich dann, wie man sich fühlt. Gewonnen hat, wer am Ende ...“
„...noch am Leben ist?“
„Naja, zumindestens, wer nicht kotzen oder sonst was muss.“
Du kannst dir vorstellen, wie es ist, mit so einer Spielgefährtin geschlagen zu sein. Den ganzen Tag muss ich ihr irgendwelche dummen Ideen ausreden oder sie schlicht und einfach ignorieren. Nachdem die Sommerferien begonnen hatten, waren wir jeden Tag zusammen. JEDEN TAG!! Und IMMER gegen meinen Willen! Aber Tante Trudl wollte ja so gerne, dass wir was zusammen unternahmen. Sie sagte eines Morgens, als ich mir gerade den schwarzen Milchbart abwischte, dass es nichts Schlimmeres gäbe als einen schwarzen Milchbart.
Читать дальше