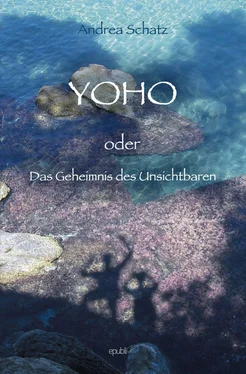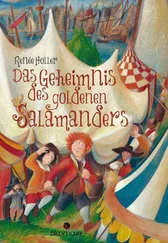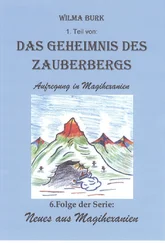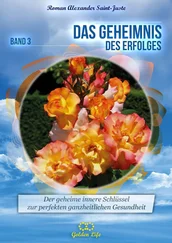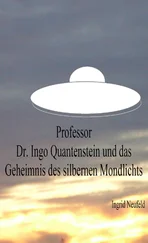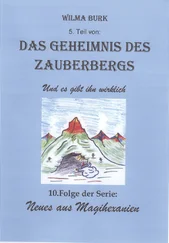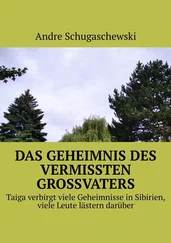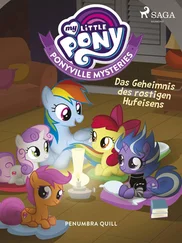Während sich eine meiner jungen Kolleginnen einen Spaß erlaubte und mich mit einem „Ätsch, beim privaten Handygebrauch ertappt!“ foppte, versuchte ich tapfer zu lächeln, mich zu beherrschen und gleichzeitig mein Bedauern darüber, die Volkshochschulkurse sicherlich wieder stornieren zu müssen, zu überspielen. Mechanisch machte ich mich auf den Weg ins Büro, um erst einmal weiterzuarbeiten, um später zu überlegen, machte aber nach drei Schritten kehrt, ging zurück ins Besprechungszimmer, schloss die Tür und versuchte meinen Lebensgefährten anzurufen. Der war leider nicht erreichbar, ich schrieb eine kurze SMS, klopfte bei meinem Chef und faselte etwas von früher gehen und Arzttermin, er nickte und schon klingelte mein Mobiltelefon, keine fünf Minuten später stand das Auto meines Lebensgefährten vor dem Eingang und wir fuhren – nicht nach Hause, aber an den Fluss, der viele Geheimnisse kennt: an die Balinger Eyach.
Tagebucheintrag: Wer zieht hier die Fäden?
Mein Mikrokosmos ist unzweifelbar
biologisch erklärbar
histologisch überschaubar
ursächlich unklar.
Unser Makrokosmos ist anzweifelbar
philosophisch diskutierbar
wissenschaftlich nicht beweisbar
im Großen und Ganzen ungreifbar.
Im Rückblick finde ich es erstaunlich, wie ruhig ich geblieben bin. Mit 48 Jahren spürte ich zum ersten Mal etwas von der Tragweite der Endlichkeit des Daseins, doch gleichzeitig hatte ich den Eindruck, es handle sich um kurzfristige Terminänderungen und nicht um eine potentiell lebensbedrohliche Diagnose namens Brustkrebs. Ein Riesenkompliment an meine Gynäkologin, meinen Lebensgefährten und meinen Hausarzt, die allesamt Bodenhaftung bewahrten, nicht um den heißen Brei herumredeten und dennoch die unfrohe Botschaft mitfühlend mit mir trugen und mir Vertrauen in die bevorstehende Therapie mit auf den Weg gaben.
Nach dem ausführlichen Gespräch mit meiner Ärztin war ich sofort einige Tage krank geschrieben, um meine Gedanken sortieren zu können. Ich schnappte mir das Fax mit dem pathologisch-anatomischen Gutachten und setzte mich ans Internet, um die mir nicht bekannten medizinischen Begriffe zu deuten. Nur gut, dass ich beruflich bereits mit der medizinischen Terminologie in Berührung gekommen war; doch der Bericht war gespickt mit irreführenden Begriffen. Es war etwas gruselig, sich durch so viele Definitionen zu klicken, in denen überall Schlagwörter wie Überlebensrate, Rezidiv, tödlicher Verlauf, Sterblichkeit, Heilungschancen laut Statistik usw. enthalten waren. Sobald ich die wichtigsten Begriffe gefunden hatte, fuhr ich den Computer aus der abergläubischen Sorge, beim Weiterlesen dem sicheren Tode geweiht zu sein, herunter. Ich hatte jetzt ein unscharfes Bild von einem invasiv-duktalen Karzinom NST (no special type), das mäßig differenziert war (G2), dass der Tumor noch recht klein war (< 2 cm), bei Draufsicht auf 9 Uhr stand und damit gut operabel sein sollte, die Proliferationsrate mit 10 % nicht zu beängstigend war, dass der positive Hormonrezeptorstatus für eine Therapie vorteilhaft war und dagegen der HER-2/Neu-Rezeptor (ein Protein) mit starker Ausprägung Score 3+ weniger vorteilhaft war.
Das K-Wort wirkte nun weniger bedrohlich, ich konnte es aussprechen und denken, auch wenn ich es anderen gegenüber eher vermied (ersetzt durch den Begriff „Tumor“). Ein Krebs war an und für sich ja etwas Schönes, ich hatte im Urlaub schon kleine Krebse fotografiert, die sich zwischen Felsritzen versteckten und doch neugierig daraus hervor lugten. Außerdem war mein Lebensgefährte im Sternzeichen Krebs geboren, das konnte also nur Gutes bedeuten. Man legt sich die Dinge eben so lange zurecht, bis sie passen. Dass ich buchstäblich Glück im Unglück hatte, wurde mir erst später in der Klinik, als ich Menschen mit viel schwerwiegenderen Diagnosen oder weit fortgeschrittenen Krankheitsstadien traf, richtig bewusst.
Es folgten angenehme Tage. Ich erinnere mich an mildes Frühlingswetter, an die Stunden, die ich im gemütlichen Sessel unseres Wintergartens verbrachte, wo sich die vielen neuen Informationen und wirren Gedanken setzen konnten: Ich war dankbar für eine recht gute Prognose (Brustkrebs ist heilbar), genoss die wärmenden Sonnenstrahlen, hatte keinen Zusammenbruch meines Weltbildes erlitten, endlich Zeit zu lesen, hatte auf weitere Deutungsversuche von Histologie / Pathologie im Internet verzichtet (dort ist nichts so sicher wie der Tod). Ein gewisses Freiheitsgefühl ersetzte das surreale Schweben, ich bereute meinen beruflichen Schritt nicht im geringsten und verspürte eine ruhige Zuversicht, dass alles gut gehen würde, und da war auch ein ruhiges, natürliches, tiefes Grundvertrauen mir selbst gegenüber. Es war einfach da, und dafür war ich ebenso dankbar wie ich froh war, dass der Tumor durch meinen Gang zur Vorsorge überhaupt entdeckt werden konnte. Dass alles gut werden würde, wusste ich von meiner sechsundachtzigjährigen Mutter, die in ihrem Leben viele schwere Wege gehen musste und vor vielen Jahren die damals noch zu härteren Bedingungen als heute durchgeführte Therapie eines Schilddrüsenkarzinoms überstanden hatte. Warum sollte ich es nicht auch schaffen? Zu dem Zeitpunkt hoffte ich, die bereits in Aussicht gestellte Chemotherapie nach der OP nicht antreten zu müssen – was ungefähr so naiv war wie mein Versuch, meiner Ärztin bei der Vorsorgeuntersuchung die entartete Zelle als harmlose Zyste zu verkaufen.

Blieb der Umgang mit der Familie und der „Öffentlichkeit“. Welches war der schwierigere Part? Die Familie, würde ich sagen. Wegen der Emotionen. Und enge Freunde. Auf das Verhalten der vielen anderen hatte ich eh keinen Einfluss. Ich ging Schritt für Schritt vor, suchte mir einen Freitagnachmittag als unspektakulären letzten Arbeitstag aus und verabschiedete mich im engeren Kollegenkreis mit kleineren Abschiedskärtchen und Gags.
Lieber Chef und liebe Hühner. Schwerfallendes Bekenntnis bei der lieben Freundin, die mich als einzige ganz genau versteht. Weitere mir wichtige Personen informiert, die es von mir direkt erfahren sollen. Familie noch offen – wie sage ich es der Mutter?
Ich versuchte es, sie ging mir zweimal durch die Lappen, und es war klar, dass ich sie gerne entwischen ließ. Der dritte Anlauf gelang. Ich sprach sehr behutsam, was gar nicht einfach war, weil sie schlecht hört und ich die klinischen Begriffe in möglichst einfacher Übersetzung darbieten musste. Ich hörte mich selber von Premiere und Abenteuer faseln (ich war bis dato noch nie Patientin in einem Krankenhaus gewesen), von guten Aussichten, von ihr als meinem großen Vorbild, von Organisatorischem, vom Genießen des tollen Frühlingswetters. Große Erleichterung, sie blieb cool. Eine Woche später würde sie mich vorsichtig fragen, ob es denn bösartig sei. Ich bejahte und dankte der Gnade des fortgeschrittenen Alters.
Nachdem der wichtigste Personenkreis Bescheid wusste (auch hier betonte ich die gute Therapiemöglichkeit im Sinne von „Glück gehabt“ und „Alles halb so wild“), war es mir sehr wichtig, das Steuer der Informationen in meiner Hand zu halten. Direkt und offen, wenn auch verständnisvoll, teilte ich meinem Umfeld mit, dass ich gegen betontes Mitleid oder gar Gejammer immun sei und dass die nächsten Monate zwar ein wichtiger Teil meines Lebens seien, dieses aber nicht durchgängig bestimmen würden. Ich bin ein Mensch, der viel mit sich selbst ausmacht, und das wollte ich beibehalten. Der Gedanke an den Empfang von Anstandsbesuchen während der Chemotherapie oder stundenlange Telefonate über das eine große Thema war mir zuwider, einen ganz kleinen Kreis hielt ich danach immer auf dem laufenden und das war völlig ausreichend. Denn ich wollte ja auch meine anderen Pläne voranbringen bzw. umsetzen, auch falls manches nur langsam oder eingeschränkt machbar sein sollte. Das Positive an einer solchen Situation – dem Umgang mit Informationen über die Krankheit, Selbstläufern und Gerüchten, Tratsch und Klatsch – ist, dass man die Menschen noch besser kennenlernt. Es ergibt sich Nähe, wo man es nicht unbedingt erwartet hätte, und man lernt, sich von Personen und Situationen, die einem nicht unbedingt gut tun, zu distanzieren. Wichtig war es jedoch auch, den Menschen gegenüber nachsichtig zu sein – ich hätte nie gedacht, dass mir das gelingen würde, denn es war auch etwas anstrengend, wenn sich Blicke auf der Straße und das Verhalten mancher Menschen änderten. Und doch schaffte ich es, die nötige emotionale Distanz zu wahren, die ich ganz unbescheiden meiner philosophischen Ader und meinem Bauchgefühl zuschreibe – plötzlich war ich diejenige, die der Unsicherheit anderer mit Empathie begegnete. Die Macht der Verletzlichkeit hatte mich nicht besiegt; ich konnte meine körperliche Verletzlichkeit als vorübergehendes Schicksal akzeptieren, während meine seelische Verletzlichkeit mich gar nicht erst herausforderte. Ich war wirklich authentisch und freute mich über dementsprechendes bestätigendes Feedback. Oft lächelte ich in mich hinein und sagte mir „Nun bist du also berühmt geworden“, wenn auch nur in einem 600-Seelen-Dorf und einigen kleineren Kreisen außerhalb. Interessant war die unterschiedliche Wirkung meiner Situation auf jüngere Frauen, die eher auf Körperbild und Beziehung fixiert waren, auf Gleichaltrige, die häufig pragmatisch reagierten, und auf viele ältere Frauen, die mit einer gewissen Hilflosigkeit auf meine Berichte reagierten. Das K-Wort fanden die meisten sehr abschreckend, weshalb ich es meist vermied.
Читать дальше