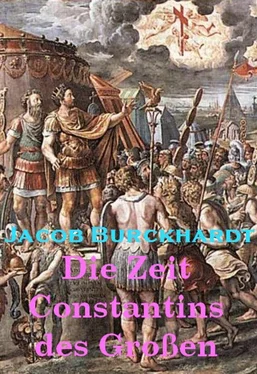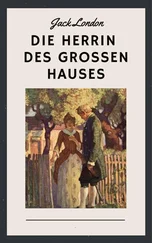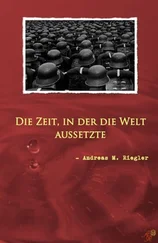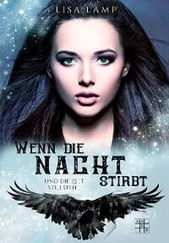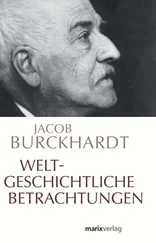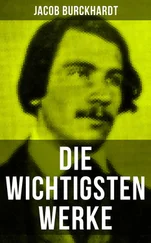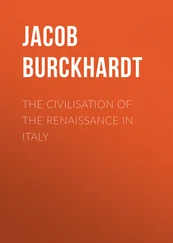Jacob Burckhardt - Die Zeit Constantins des Großen
Здесь есть возможность читать онлайн «Jacob Burckhardt - Die Zeit Constantins des Großen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Zeit Constantins des Großen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Zeit Constantins des Großen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Zeit Constantins des Großen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ausgang Constantins des Grossen könnte jeder Abschnitt seiner eigenen Einleitung bedürfen,
weil die Dinge nicht nach der Zeitfolge und der Regierungsgeschichte, sondern nach den
vorherrschenden Richtungen des Lebens geschildert werden sollen. Wenn dieses Buch aber
gleichwohl einer allgemeinen Einleitung bedarf, so wird dieselbe am ehesten die Geschichte
der höchsten Staatsgewalt des sinkenden Römerreiches im dritten Jahrhundert nach Christo
enthalten müssen. Nicht dass aus ihr sich alle übrigen Zustände entwickeln liessen, aber sie
gibt immerhin den Boden für die Beurteilung einer Menge äusserer wie geistiger Ereignisse
der Folgezeit. Alle Formen und Grade, welche die Gewaltherrschaft erreichen kann, von den
schrecklichsten bis zu den günstigsten, sind hier in einer merkwürdig abwechselnden Reihe
durchlebt worden.
Die Zeit Constantins des Großen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Zeit Constantins des Großen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Dieser war, wie gesagt, ein Dalmatiner, Maximian ein Bauernsohn von Sirmium (Mitrovicz an der Save), der Heimat der tapfersten Kaiser des dritten Jahrhunderts Unweit Sirmium sah man den Palast, welchen er an der Stelle hatte errichten lassen, wo seine Eltern um Tagelohn gearbeitet hatten. Aurel. Vict., Epit. 40. Auch Galerius schämte sich solcher Erinnerungen nicht und benannte seinen Geburtsort nach seiner Mutter Romula Romulianum, ibid.; Galerius ein Hirte, entweder aus Dacien oder von Sardica (dem jetzigen Sophia in der Bulgarei); Maximinus Daza wahrscheinlich aus derselben Gegend; Constantius Chlorus wohnte, als ihm sein Sohn Constantin geboren wurde, zu Nissa in Serbien; der später auftretende Freund des Galer, Licinius, war ein Bauer von der untern Donau; die Heimat des Severus ist unbekannt. Man muss einstweilen es ganz auf sich beruhen lassen, ob eine örtliche Religion oder Superstition die Herrscher noch besonders vereinte. Von Maximians Abdankung kennen wir nur die Formel, die er im Tempel des kapitolinischen Gottes (wahrscheinlich in Mailand) aussprach: »Nimm zurück, o Juppiter, was du verliehen hast« Panegyr. VI (Max. et Const. M.), 12 und VII (Const. M.), 15. – Malalas l. XII, ed. Bonn. p. 310 lässt den Diocletian zu Antiochien als Alytarch (Vorsteher) den olympischen Spielen präsidieren, worauf er in bezug auf seine Festtracht gesagt haben soll: »Ich lege die Herrschaft nieder; ich habe das Kleid des unsterblichen Zeus getragen.« Dasselbe wird dann von Maximian wiederholt. Hier liegt vielleicht eine echte Tradition, nur entstellt, zugrunde.. Mit Schwüren, Opfern und Weihen mochte Diocletian ersetzen, was seiner politischen Kombination an Kraft und Haltbarkeit abging.
Wer dieser unserer Erklärung nicht beistimmen will, mag annehmen, dass Diocletian bei der Erhebung Maximians dessen Stillschweigen und Feldherrngaben nicht entbehren wollte, dessen Sohn Maxentius aber deshalb beseitigte, weil Galerius mit diesem von jeher verfeindet war De mort. pers. 18.. Allein man sehe wohl zu, ob eine Handlungsweise dieser Art mit dem ganzen Wesen und dem Mass von Regentengrösse vereinbar ist, welches man dem Diocletian nicht wohl streitig machen wird. Es liegt ein tiefer Ernst in seinen Anordnungen, zumal in der Herabsetzung des Kaisertums auf eine bestimmte Amtsdauer. Wenn andere dasselbe für eine Sache des Genusses ansehen würden, so war dies nicht seine Schuld; er hielt es für ein furchtbares und verantwortungsvolles Amt, welches Kindern und Greisen zu ihrem und des Reiches Glück entzogen bleiben sollte. Zugleich war aber dem berechtigten Ehrgeiz der jeweiligen Caesaren Rechnung getragen; sie konnten nun den Tag und die Stunde berechnen, da sie (wenn nichts in der Zwischenzeit vorfiel) spätestens den Thron besteigen würden. Mit den Gefühlen eines Menschen, der seinen Todestag kennt, mochte der Imperator von fünf zu fünf Jahren die Quinquennalien und die Decennalien und die Quindecennalien feiern; unabwendbar nahten die Vicennalien, da er den Purpur auszuziehen hatte. Denn so wollen es die »übermächtigen Schicksalsgöttinnen«, welche auf einer Münze des Abdankungsjahres Mit der Inschrift: FATIS · VICTRICIBVS. – Dass Diocletian von erblicher Herrscherbegabung nicht viel hielt, hat man, gewiss mit Recht, aus Hist. Aug., Sept. Sever. 20 geschlossen, wo der Autor, mit direkter Anrede an ihn, als etwas Ausgemachtes betont, dass fast kein grosser Mann einen würdigen und tüchtigen Sohn hinterlassen habe. verherrlicht sind. Dass man Nachfolger nicht auf ewig binden könne, wusste auch Diocletian, aber er wollte, so scheint es, ein Beispiel geben. Überdies verbürgte nur die Zwanzigjährigkeit des Amtes den Ausschluss der Kaisersöhne, welcher bei dessen Lebenslänglichkeit unfehlbar dahinfallen musste. Man könnte fragen, ob es wohlgetan war, auch den feindlichen Menschen und den gärenden Elementen im Staate einen festen Termin zum vielleicht erfolgreichen Ausbruch zu bezeichnen; allein auch die Mittel des Widerstandes konnten in Bereitschaft gehalten werden. Während der Krankheit Diocletians, die seiner Abdankung vorausging, blieb das Volk dritthalb Monate in der Ungewissheit, ob er überhaupt noch lebe De mort. pers. 17., und doch rührte sich in dem wohlgebändigten Staate Romanam gentem modestam atque tranquillam . . . Cod. Gregor. XIV, IV. – Die nähere Motivierung und die Konsequenzen des diocletianischen Systems sind mit vorsichtiger Kritik erörtert bei: Hunziker, Zur Regierung und Christenverfolgung Diocletians, S. 250 (in Rüdingers Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte, Bd. II). Wahrscheinlich sollte das Oberkaisertum zwischen Osten und Westen abwechseln. Die zurückgezogenen Augusti, in dauerndem Besitz kaiserlicher Ehren, konnten als eine Art Obertribunal bei Zwisten ihrer Nachfolger gelten. – Über den Grad der Vollmacht des Mitaugustus und der Caesaren gegenüber dem Oberkaiser vgl. die genauen Untersuchungen bei Preuss, a. a. O., S. 88 ff. keine Hand.
Merkwürdigerweise bewegten dieselben Fragen, dieselben Ereignisse gleichzeitig das feindliche Nachbarland im Osten, das Sassanidenreich. Bei Bahram III., welcher nur einige Monate im Jahre 293 regierte, bemerken die Schriftsteller Hamza Ispahanens., ed. Gottwaldt, p. 36 seq. – Mirkhond, ed. Sacy, p. 299. – Vgl. Clinton, Fasti Rom., vol. I ad a. 301 et vol. II, p. 260. zum erstenmal: der König von Persien habe denjenigen Sohn oder Bruder, den er zum Nachfolger bestimmt, einstweilen zum Fürsten einer Provinz gemacht, mit dem Titel Schah, und so habe auch Bahram früher bloss Schah von Segan oder Sistan geheissen, solange sein Vater Bahram II. noch lebte. Nach seiner kurzen, wahrscheinlich von gewaltsamen Umständen begleiteten Regierung folgt sein jüngerer Bruder Narsi, und dieser krönt dann selber seinen Sohn Hormuz zum Nachfolger, um sich im Jahre 301 vom Thron in die Stille des Privatlebens, »unter den Schatten der Güte Gottes« zurückzuziehen. Laut Mirkhond bewog ihn hiezu der Gedanke an den Tod, »dessen Augenblick in ewigen Beschlüssen vorgezeichnet und unvermeidlich ist«. Möglicherweise hatten ihm die Magier eine bestimmte Todesstunde geweissagt und ihm damit die Lust am Leben genommen; weiterhin aber wird angedeutet, dass Narsi den Wechselfällen des königlichen Schicksals, die er in seinem Kriege mit den Römern sattsam erfahren, aus dem Wege gehen wollte. »Der Weg ist lang«, sagte er, »man muss oft auf- und niedersteigen.« Es ist nicht undenkbar, dass dieses Beispiel auf das Gemüt Diocletians einigen Eindruck gemacht habe.
Mit der Feierlichkeit, welche das ganze, abergläubisch bedingte Leben Diocletians umgab, steht ohne Zweifel in engster Verbindung die plötzliche und auffallende Steigerung des Hofzeremoniells. Oder hätte er wirklich nur, nach Art der Emporkömmlinge, des äussern Pompes nicht genug bekommen können, wie der ältere Aurelius Victor meint? In diesem Falle wäre es befremdlich, dass keiner von den grossen Soldatenkaisern des dritten Jahrhunderts ihm darin vorangegangen, welche fast sämtlich aus den geringsten Verhältnissen sich zum Thron emporgearbeitet hatten. Wir sehen zum Beispiel den gewaltigen Aurelian harmlos mit seinen alten Freunden verkehren, die er gerade so weit ausstattet, dass sie nicht mehr dürftig heissen können; seidene Kleider sind ihm zu teuer; das Gold möchte er am liebsten ganz aus der Bauverzierung und aus den Gewändern entfernen, während er das kostbarste Geschmeide, das man ja wieder einschmelzen kann, andern gern gestattet, sich selber versagt; seine Diener kleidet er nicht prächtiger als bevor er Kaiser war; in dem prachtvollen Palaste auf dem Palatin, an dessen bunten Marmorwänden das Blut so vieler Kaiser klebte, ist ihm nicht wohl zumute; er bezieht (wie einst Vespasian) die Gärten des Sallust, in deren miglienlanger Halle man ihn täglich turnen und die Pferde tummeln sah Hist. Aug., Aurelian. 45–50, wogegen die Notizen in Aur. Vict., Epit. und bei Malalas über das Diadem nicht zu allgemeinen Schlüssen berechtigen.. – Jetzt änderte sich dies alles. Diocletian hatte Freunde aus früherer Zeit; aber das Zutrauen war, vielleicht auf beiden Seiten zugleich, verschwunden; er fürchtete nicht mit Unrecht, dass eine Intimität mit dritten Personen seine künstliche Harmonie mit den Kollegen stören könnte. Statt des einfachen Purpurs, womit sich fast alle frühern Kaiser (die wahnsinnigen ausgenommen) begnügt hatten, trägt er (seit 293) seidene und golddurchwirkte Gewänder und bedeckt selbst die Schuhe mit Edelsteinen und Perlen; das Haupt aber umgibt er mit dem Diadem, einer weissen, perlenbesetzten Binde. Dies war natürlich nur das Staatskleid, in welchem er bloss bei festlichen Gelegenheiten auftrat; auf seinen Schnellreisen und Feldzügen werden er und sein Kollege Maximian es wohl anders gehalten haben, und so vollends die auf jeden Wink beweglichen »Wie stets herumreisende Diener«, Ammian. XIV, 11, § 10. Caesaren, von welchen besonders Constantius das einfachste Auftreten liebte. Allein in Nikomedien hielt Diocletian auf das Feierliche. Der Zutritt zu seiner geheiligten Person wurde täglich schwieriger durch das wachsende Zeremoniell. In den Sälen und Vorhallen des Palastes waren Offiziere, Hofbeamte und Wachen aufgestellt; im Innern walteten einflussreiche Verschnittene; wem es sein Geschäft oder sein Rang möglich machten, bis zum Kaiser durchzudringen, musste nach orientalischem Brauch zur Anbetung niederfallen. Schon bei Anlass der Zusammenkunft Diocletians und Maximians in Mailand (291) bezeichnet der Lobredner Mamertinus Panegyr. III, 11. – Constantin entzückte später die Bischöfe, wenn er sie »bis in die innersten Gemächer« zu sich liess. Euseb., V. C. III, 1. die feierliche Cour als »eine im Innersten des Heiligtums verborgene Verehrung, welche nur die Gemüter derer mit Staunen erfüllen durfte, denen der Rang ihrer Würde den Zugang zu Euch verstattete«. Und bei den stummen Formen blieb man nicht mehr stehen, auch das bedenkliche Wort wurde ausgesprochen; der Kaiser nannte sich nicht mehr nach den so harmlos gewordenen Titeln des republikanischen Roms, dem Konsulat, der tribunizischen Gewalt usw.; er hiess jetzt dominus , der Herr In der gewöhnlichen Anrede an den Kaiser war der Titel längst vorgekommen, und auch hie und da in Inschriften, z. B. auf Valerian und Gallienus, vgl. Millin, Voyage dans les dep. du Mich, III, p. 6. Dann bei Aurelian.. Gegen den Titel rex hatte sich das römische Gefühl beharrlich gesträubt, weil sich verabscheute Erinnerungen daran knüpften; die Griechen aber, welche in Sparta und ihren halbbarbarischen Nachbarländern des Königtitels nie entwöhnt worden und denselben unter den Nachfolgern Alexanders Jahrhunderte hindurch gebraucht hatten, nannten ohne Bedenken die römischen Imperatoren von Anfang an βασιλει̃ς, Könige, weil bei ihnen die Behauptung der republikanischen Fiktion keinen Sinn gehabt hätte Man vergleiche den neu erfundenen Mythus von Basileia und Tyrannis in der ersten Rede des Dio Chrysostomus, wahrscheinlich an Trajan gerichtet.. Jetzt ging man auch über diesen Titel hinaus und führte einen neuen ein, welcher das Verhältnis völliger Herrschaft und Dienstbarkeit ausdrückte. Daneben konnte bald auch eine wahre Vergötterung nicht mehr auffallen; über die verstorbenen Kaiser hatte ja längst der Senat das Kanonisationsrecht geübt, und tatsächlich hatte man den lebenden dieselbe Ehre immerfort erwiesen durch das Opfern und Schwören vor ihren Statuen, wenn man auch dabei den unbestimmten und deshalb unübersetzbaren Ausdruck » numen imperatoris « brauchen mochte. – Maximian hatte übrigens die Schwäche, sich wie Commodus und ähnliche Vorfahren im Reiche auf Münzen mit der Löwenhaut seines Namensheros abbilden zu lassen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Zeit Constantins des Großen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Zeit Constantins des Großen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Zeit Constantins des Großen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.