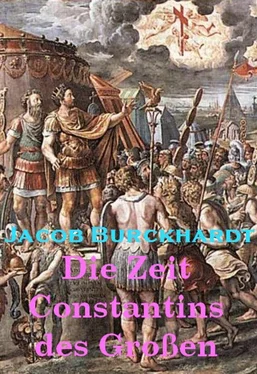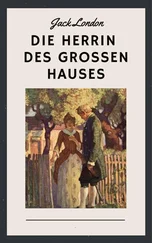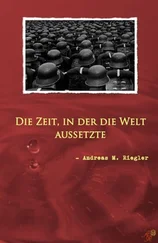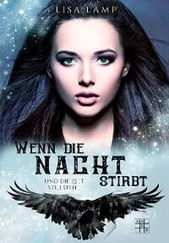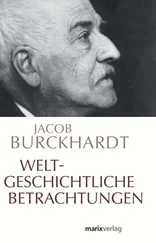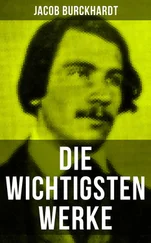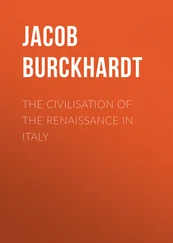Jacob Burckhardt - Die Zeit Constantins des Großen
Здесь есть возможность читать онлайн «Jacob Burckhardt - Die Zeit Constantins des Großen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Zeit Constantins des Großen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Zeit Constantins des Großen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Zeit Constantins des Großen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ausgang Constantins des Grossen könnte jeder Abschnitt seiner eigenen Einleitung bedürfen,
weil die Dinge nicht nach der Zeitfolge und der Regierungsgeschichte, sondern nach den
vorherrschenden Richtungen des Lebens geschildert werden sollen. Wenn dieses Buch aber
gleichwohl einer allgemeinen Einleitung bedarf, so wird dieselbe am ehesten die Geschichte
der höchsten Staatsgewalt des sinkenden Römerreiches im dritten Jahrhundert nach Christo
enthalten müssen. Nicht dass aus ihr sich alle übrigen Zustände entwickeln liessen, aber sie
gibt immerhin den Boden für die Beurteilung einer Menge äusserer wie geistiger Ereignisse
der Folgezeit. Alle Formen und Grade, welche die Gewaltherrschaft erreichen kann, von den
schrecklichsten bis zu den günstigsten, sind hier in einer merkwürdig abwechselnden Reihe
durchlebt worden.
Die Zeit Constantins des Großen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Zeit Constantins des Großen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Gegen die Einwohnerschaft Jenen vulgus urbis Romae , welchem einst Carin die Güter des Senats versprochen, als wäre er der populus Romanus . Vgl. Hist. Aug., Carin. 1. von Rom (um nicht den entweihten Namen des römischen Volkes zu brauchen) erwiesen sich aber Diocletian und sein Mitkaiser später in einer ganz absichtlichen Weise gefällig; als wären zu Rom noch nicht Vergnügungsanstalten genug, bauten sie auf dem Viminal jene ungeheuersten aller römischen Thermen (299). Unter den etwa zehn Thermenbauten früherer Kaiser und Privatleute befanden sich die riesigen Hallen Caracallas, mit deren rätselhaft weiten Wölbungen die ermüdete Kunst nicht mehr wetteifern konnte; da wurde wenigstens die Ausdehnung überboten, bis man ein Ganzes von 1200 Schritt Umfang, mit 3000 Gemächern, geschaffen hatte, dessen erstaunlicher Mittelbau mit jenen Granitsäulen von 15 Fuss Umfang jetzt den Hauptraum der Karthäuserkirche bildet, während man die übrigen Reste weit ringsum in Klöstern, Weingärten und einsamen Strassen zusammensuchen muss [Nachtrag:] Hier ist versäumt worden zu berichtigen, dass die Umgebung der Diocletiansthermen in neuerer Zeit zu den belebtern Quartieren Roms gehört.. – Im gleichen Jahre Euseb., Chronicon. begann Maximian einen Thermenbau zu Karthago, möglicherweise in einer ähnlichen, begütigenden Absicht. Karthago war bisher ein Hauptschauplatz für das erste Auftreten von Usurpatoren gewesen. Von andern Bauten dieser Regierung in Rom werden namentlich erwähnt S. Mommsens Ausg. des Chronographen v. J. 354, S. 648.: die Herstellung des unter Carinus verbrannten Senatslokales, des Forum Caesaris , der Basilica Iulia und des Pompeiustheaters; sodann als Neubauten ausser den Thermen die beiden Portiken mit den Beinamen Iovia und Herculea, drei Nympheen, ein Isis- und ein Serapistempel und ein Triumphbogen. Vielleicht hatte auch die auffallende Masse von Prachtgebäuden, womit Diocletian das tadelsüchtige und gefährliche Antiochien versah Malalas l. XII, ed. Bonn. p. 306., keinen andern Zweck, als die Ablenkung von politischen Gedanken. Es werden Tempel des olympischen Zeus, der Hekate, der Nemesis und des Apoll, ein Palast in der Stadt und einer in Daphne, mehrere Thermen, Speicher, ein Stadium und anderes mehr genannt, meist als Neubauten, weniger als Reparaturen.
Für Rom waren überdies die öffentlichen Spenden Aur. Vict., Caes. und Schauspiele nie unterbrochen worden; erst nach der Abdankung des Jahres 305 wagte Galerius jede Rücksicht gegen die alte Weltherrscherin beiseite zu setzen. Aber schon Diocletian hatte noch in einer andern, bereits angedeuteten Beziehung Rom beleidigt. Zunächst hinter seinen Thermen, von drei Seiten durch die Stadtmauer Aurelians umgrenzt, liegt eine grosse Vigne, später den Jesuiten gehörend, an der Mauer ringsum halbzerstörte gewölbte Zellen. Es ist das ehemalige prätorianische Lager, dessen Bewohner so oft den Kaiserpurpur auf der Spitze ihrer Schwerter hatten in die Luft flattern lassen, öfter hatte man sie aufzulösen, zu ersetzen gesucht; im Laufe des dritten Jahrhunderts aber scheint sich das alte Verhältnis wieder festgesetzt zu haben, dass nämlich in der Umgegend Roms und in den nähern Teilen Italiens die vielleicht wenigen tausend Mann ausgehoben wurden, die wir schon kaum mehr als kaiserliche Garde, sondern eher als Garnison der Hauptstadt zu bezeichnen haben. Jetzt verminderte sie Diocletian sehr beträchtlich Aur. Vict., Caes. – S. auch De mort. pers. 26, wo die Massregel mit Unrecht erst dem Galerius zugeschrieben wird. – Gegenwärtig ist die Örtlichkeit wieder zum Campo militare geworden., sicher nicht bloss, weil er in ihnen die unruhigen, anspruchvollen Italier fürchtete, sondern auch aus Sparsamkeit, und weil durch den Lauf der Dinge ein neues Korps bereits an ihre Stelle getreten war. Eine herrliche Reihe illyrischer Kaiser seit Decius hatte das Reich gerettet Panegyr. II (Mamert. ad Max. Herc.), 2 Halia gentium domina gloriae vetustate, sed Pannonia virtute . – Auf der andern Seite hatte auch der Neid einen Spottnamen auf die Illyrier in Umlauf gebracht, sabaiarius , welches etwa unserm »Bierlümmel« entspricht. Ammian. Marc. XXVI, 8.; kein Wunder, dass im Lauf von dreissig Kriegsjahren sich eine getreue landsmännische Schar um sie bildete, welche ihnen in jeder Beziehung näherstand als jene Latiner und Sabiner und sich noch besonders durch eine nationale Waffe empfahl. Es sind dies die beiden Legionen, jede von 6000 Mann, welche jetzt zur Belohnung mit den Beinamen der Kaiser als Jovier und Herculier benannt wurden Vegetius, De re milit. I, 17. – Wenn ihre Waffe aus Bleikugeln bestand, deren je zwei durch einen Riemen verbunden waren, so erklärt sich auch die Tötung mit Bleikugeln, deren Zosim. V, 2 erwähnt.; früher hatten sie Martiobarbuli geheissen, nach den Bleigeschossen, deren sie je fünf (fünf Paare?) am Schild befestigt trugen und die sie mit der Schnelligkeit und der Wucht eines Pfeiles zu schleudern wussten. Sie erhielten jetzt den offiziellen Vorzug vor allen andern Legionen, ohne dass damit erwiesen wäre, dass sie ihre bleibende Garnison in der Umgebung der Kaiser gehabt hätten. – Erregten früher in Rom die Prätorianer beim Volke meist Furcht und Hass gegen sich, so empfand man jetzt doch ihre Auflösung als einen Angriff auf die Majestät der Hauptstadt; es bildeten sich gemeinsame Antipathien, und die wenigen Prätorianer, welche im Lager zu Rom blieben, nahmen später im Einklang mit Senat und Volk an der Empörung gegen Galerius teil Ausserdcm verminderte Diocletian auch die Zahl »der bewaffneten Leute aus dem Volk«, in armis vulgi , laut Aur. Vict., Caes. – Am leichtesten wird man dies auf jene Bürgergarde beziehen, welche laut Zosim. I, 37 der Senat beim sog. Scytheneinfall unter Gallienus einrichtete, und deren Fortbestand auch z. B. zur Erbauung der Stadtmauer unter Aurelian ganz wohl passen möchte. – Andere deuten es etwas gezwungen auf die cohortes urbanae , oder lesen: inermis vulgi ..
Die Römer konnten diese ganze Wendung der Dinge beklagen und verabscheuen, allein es geschah ihnen im Grunde kein Unrecht. Irgendeinmal musste die grosse Täuschung aufhören, als ob der Imperator noch immer der Beamtete und Repräsentant des örtlich römischen oder auch des italischen Lebens und Volkes sei, in dessen Namen er über den Erdkreis zu herrschen habe. Hätte Diocletian nicht das Erlöschen dieses Vorurteils auch äusserlich durch Verlegung der Residenz, orientalische Gestaltung des Hofwesens, Missverhältnisse mit dem Senat und Verminderung der Prätorianer konstatiert, so hätte doch bald darauf das Christentum dieselbe Aufgabe auf seine Weise vollbringen müssen, indem es mit Notwendigkeit ganz neue Schwerpunkte der Macht schuf.
Wir werden im folgenden erzählen, unter welchen furchtbar gewaltsamen Umständen Diocletians Neuerungen vor sich gingen – während er und seine Mitregenten das Reich an allen Grenzen verteidigen und den Usurpatoren stückweise entreissen mussten, was man bei seiner Beurteilung nie vergessen darf. Was den höher gespannten Ton des Hofes und das neue Zeremoniell betrifft, so fanden sich ohne Zweifel Leute genug, welche mit allem Eifer darauf eingingen. Auf Übergangsstufen, wie jene Zeit eine war, verspürt der Imperator noch das Bedürfnis, sich öffentlich anloben zu lassen, eine Gattung von Anerkennung, welche der durchgebildete Militärdespotismus entbehren kann und verachtet, auch wohl sich geradezu verbittet. Damals kam man noch halbfrisch aus der alten Welt und ihrer Lebenslust, der Öffentlichkeit; alle Bildung war noch rhetorisch und die Gelegenheitsreden von einer Wichtigkeit im ganzen Leben des antiken Menschen, von welcher sich die heutige Welt keinen Begriff mehr machen kann. Dazu gehörten denn auch die Panegyriken, welche bei Jahresfesten und andern feierlichen Gelegenheiten von irgendeinem angesehenen Rhetor der Stadt oder Nachbarschaft in Gegenwart des Kaisers oder eines hohen Beamten gehalten wurden. Erhalten ist uns der bekannte Panegyricus des jüngern Plinius auf Trajan; dann folgt nach einer langen Lücke zufällig ein Stoss Lobreden auf die Mitregenten Diocletians nebst einigen wenigen auf noch spätere Kaiser Ich zitiere die Ausgabe in usum delph., Paris 1676. Die Numerierung schwankt, je nachdem die Rede des Plinius, wie hier, mitgezählt wird oder nicht. – Wie unersättlich Constantin in diesem Punkte war, geht aus Panegyr. (incerti) IX, cap. 1 hervor.. Als historische Quelle sind diese Reden natürlich mit Vorsicht zu gebrauchen, in gewissen Beziehungen aber höchst schätzbar und auch als literarische Arbeiten keineswegs verächtlich. Der Stil ihrer Schmeichelei ist wahrscheinlich noch ganz derselbe, welcher in den verlorenen Lobreden des dritten Jahrhunderts herrschte. Lebhaft und fast zudringlich versetzt sich der Rhetor in die möglichst veredelte Person des anwesenden Kaisers hinein und errät ihm, eins nach dem andern, seine Gedanken, Pläne und Empfindungen, was der ausgelernte Höfling klüglich bleiben lässt, weil hier schon die idealisierende Dichtung indiskret ist, geschweige denn die Wahrheit. Dies wird jedoch überwogen durch den starken Duft unmittelbaren Lobes und Entzückens, wie es dem Ohre eines Maximian angemessen war, mochte auch dieser schwerlich genug Bildung besitzen, um all die verbindlichen Beziehungen zu verstehen. Da wird Panegyr. II (Mamertin. ad Max.) und III (Genethliacus), aus den Jahren 289 und 291, nach andern beide von 292. vor allem der Beiname Herculius ausgenützt zu einer beständigen Verflechtung und Parallelisierung mit der Geschichte des Hercules, welcher endlich gleichwohl zu kurz kömmt, insofern Maximians Bagaudensieg doch etwas ganz anderes sei als der Sieg des Alciden über Geryon. Schon etwas weiter reicht die sonst dem altern Kaiser vorbehaltene Vergleichung mit Juppiter, dessen Kindheit bekanntlich, wie die des am Donaustrand aufgewachsenen Maximian, von Waffenlärm umgeben war. Unermüdlich häuft der Redner Bild auf Bild, um die Eintracht der Kaiser zu verherrlichen; die Regierung ist ihnen gemeinschaftlich wie das Tageslicht zweien Augen; wie sie beide an einem Tage (vgl. S. 64) geboren sind, so ist ihre Herrschaft eine Zwillingsherrschaft gleich derjenigen der Heraklidenkönige in Sparta; Rom ist jetzt glücklicher als unter Romulus und Remus, deren einer den andern totschlug; es darf sich jetzt Herculea und Iovia zugleich nennen. Wie auf Maximian die Geschichte des Hercules, so wird nämlich auf Diocletian der Mythus von Zeus angewandt, zumal in Betreff der Allgegenwart, welche durch die kaiserlichen Schnellreisen gewissermassen nachgeahmt schien. Aber aus der wohlbemessenen Kadenz dieser Phrasen heraus klingt eine sehr kecke, selbst unverschämte Bevorzugung Maximians, welcher dergleichen vielleicht ohne eine Miene zu verziehen ganz gerne anhörte. »Durch Übernahme der Mitherrschaft hast du dem Diocletian mehr gegeben als von ihm empfangen . . . Du ahmst den Scipio Africanus nach, Diocletian aber dich« – dies und ähnliches wagte Mamertin im Palast zu Trier vor dem ganzen Hofe zu deklamieren. Freilich strömt dazwischen ungehemmt der Blütenregen gemeinschaftlicher Huldigungen für beide. »Wie der Rhein seit Maximians jenseitigen Eroberungen getrost vertrocknen darf, so braucht auch der Euphrat Syrien nicht mehr zu decken, seit Diocletian ihn überschritten . . . Ihr verschiebt die Triumphe um immer neuer Siege willen; ihr eilt zu immer grössern Dingen hin . . .« Auch viel kleinere Taten werden kühnlich zu grossen aufgestutzt. Bei Anlass der Zusammenkunft des Jahres 291, als Diocletian aus dem Orient, Maximian über die Alpen mitten im Winter nach Mailand eilten, ruft zum Beispiel Mamertinus aus: »Wer nicht mit Euch reiste, konnte glauben, Sonne und Mond hätten Euch ihr tägliches und nächtliches Gespann geliehen! Gegen den strengen Frost schützte Euch die Macht Eurer Majestät; während alles erfror, folgten Euch laue Frühlingslüfte und Sonnenschein. Geh doch, Hannibal, mit deiner Alpenreise!« – Wozu ganz wohl passt, dass seit der Herrschaft dieser Kaiser selbst die Erde plötzlich fruchtbarer geworden sei. In ähnlichem, nur mehr bukolischem Ton hatte einige Jahre vorher der Dichter Calpurnius Siculus (in der achten oder vierten Ekloge) den Caesar Numerian besungen, in dessen Gegenwart die Wälder vor Ehrfurcht schweigen, die Lämmer munter werden, die Wolle und die Milch reichlicher, Saaten und Bäume üppiger, denn unter seiner sterblichen Gestalt birgt sich ein Gott, vielleicht der höchste Juppiter selber. – Etwas feiner weiss der Redner Eumenius mit dem gebildeten Caesar Constantius Chlorus umzugehen Paneg. IV und V (Pro scholis und Ad Constantium), aus den Jahren 295 und 297., wenn er zum Beispiel die Jugend Galliens vor die grosse Weltkarte zu führen verspricht, welche in der Halle zu Autun (zwischen dem Apollstempel und dem Kapitol mit dem Heiligtum der Minerva) auf die Mauer gemalt war. »Dort lasst uns nachsehen, wie Diocletians Milde das wild empörte Ägypten beruhigt, wie Maximian die Mauren niederschmettert, wie unter deiner Rechten, o Herr Constantius, Batavien und Britannien das verkümmerte Antlitz wieder aus Wäldern und Fluten emporheben, oder wie du, Caesar Galerius, persische Bogen und Köcher zu Boden trittst. Denn jetzt erst ist es eine Freude, den gemalten Erdkreis zu betrachten, da wir nichts mehr darauf erblicken, was nicht unser wäre.« Neben der schwungvollen Schilderung dieses erneuten »goldenen Zeitalters« mag man dem Redner die spielende Symbolik gerne nachsehen, welche er mit der Vierzahl der Regenten treibt. Sie erscheint ihm als Grund und Fundament der Weltordnung in den vier Elementen, den vier Jahreszeiten, selbst den vier Weltteilen orbis quadrifariam duplici discretus Oceano , Paneg. V, 4. Worte, deren Deutung den Kennern der damaligen geographischen Ansichten überlassen bleibe.; nicht umsonst folgt je nach vier abgelaufenen Jahren das Lustrum; am Himmel sogar fliegt ein Viergespann vor dem Sonnenwagen, und wiederum sind den zwei grossen Himmelslichtern, Sonne und Mond, zwei kleinere, Morgenstern und Abendstern beigegeben. – Es sollte uns nicht wundern, wenn irgendwo im alten Gallien etwa ein Mosaikboden ausgegraben würde, welcher diese Ideen zu einer grossen Prachtkomposition verarbeitet enthielte. Die bildende Kunst und die Rhetorik mussten bei Aufgaben dieser Art oft auf die gleichen Mittel angewiesen sein. Eumenius zeichnet sich übrigens nicht bloss durch Takt und Talent vor den andern Lobrednern aus; wir werden in ihm einen ganz ehrwürdigen Patrioten kennenlernen, der nicht zu eigenem Vorteil schmeichelte. Hier wie in tausend Fällen muss das geschichtliche Urteil das, was die Zeit und die Umgebung dem einzelnen auferlegt, und das, was er kraft eigenen Entschlusses tut, sorgfältig zu scheiden suchen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Zeit Constantins des Großen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Zeit Constantins des Großen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Zeit Constantins des Großen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.