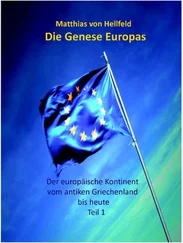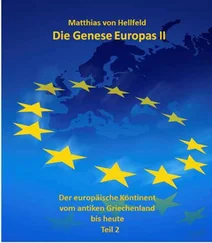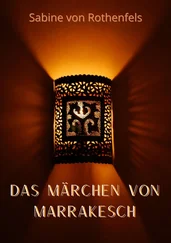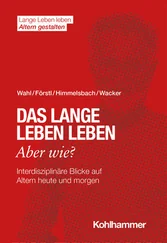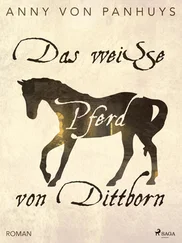Der Nationalstaatsgedanke des 19. Jahrhunderts verband sich mit der Zeit mit den Ideen des Liberalismus. Nun waren staatliche Einheit, Verfassungsstaat und individuelle Freiheiten der Dreiklang, der das überkommene System absoluter Monarchien erschütterte. Der Gedanke, in einer Nation mit gleichen Rechten für alle und einem an die Verfassung gebundenen Herrscher zu leben, erreichte mehr als nur die intellektuellen Eliten. In Deutschland war die Revolution 1849 gescheitert, aber die Ideen blieben erhalten – wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen. Der Nationalismus wurde mehr und mehr eine „konservative, auf den bestehenden Staat, seine Institutionen und Symbole bezogene Kraft – von der Obrigkeit gezielt gefördert“ (Janz, 2013). Er wurde schließlich zum sozialen Kitt, der als Antwort auf die Unwägbarkeiten, die die Industrialisierung mit der Binnenwanderung und der Urbanisierung nach sich zog, diente. Äußeres Erscheinungsbild waren Zeremonien, die mehrmals im Jahr die nationale Gemeinsamkeit zur Schau stellten. In Deutschland war das besonders der 2. September, an dem alljährlich an den Sieg im deutsch-französischen Krieg 1870 erinnert wurde. Jener „Tag von Sedan“ brachte Paraden, Schulfeiern, landesweite Beflaggung und national-patriotische Reden hervor, die allerdings oft in Hasstiraden gegenüber dem „französischen Erbfeind“ endeten. Frankreich erinnerte jedes Jahr an die glorreiche Revolution von 1789 und stellte dabei mitunter mehr als notwendig französisches Selbstbewusstsein zur Schau. Neben den Feiertagen wurden Staatsbegräbnisse aufwändig in Szene gesetzt. Das Pariser Panthéon, Westminster Abbey in London oder die Walhalla bei Regensburg gaben die geschichtsmächtige Umgebung derartiger Ereignisse ab. Der öffentliche Raum wurde mehr und mehr zu einer Feierstätte für Monarchen, Militärs und Staatsmänner. Allen voran gab der deutsche Kaiser Wilhelm II. den ersten Medienstar in der Geschichte. Seine öffentlichen Auftritte waren sorgsam inszeniert, für die anwesenden Photographen warf sich seine kaiserliche Hoheit auch schon mal in Pose. All das diente dem inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft, die in den zurückliegenden Jahrzehnten vieles hatte ertragen müssen.
Neben dem inneren Spektakel, das für jeden sichtbar, die eigene Nation zur Schau stellte, war die Industrialisierung für die Ausbildung des Nationalstaatsgedankens von großer Bedeutung. Sie verursachte die Konkurrenz zwischen die Nationalstaaten und etablierte das Ringen um wirtschaftliche Macht zwischen Europas Nationen. Aus einem geregelten Nebeneinander wurde spätestens mit dem Beginn des kalendarischen 20. Jahrhunderts eine heftige Konkurrenz. Großbritannien war als Kolonialmacht und durch die früh einsetzende Industrialisierung schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum weltweiten Wirtschaftsimperium aufgestiegen. Amsterdam hatte seine Stellung als zentraler Handelsplatz Europas an London verloren. Die Gründung des deutschen Kaiserreichs im Januar 1871 geschah auch als Ausdruck eines Aufholprozesses gegenüber dem industrialisierten und hochgerüsteten Großbritannien. Mit dem Ende der Ära Otto von Bismarcks änderte sich das außenpolitische Augenmerk Deutschlands auf den Erwerb von Kolonien, um mit dem ungeheuren Reichtum und den ökonomischen Möglichkeiten der europäischen Kolonialmächte mithalten zu können. Damit einher gingen die Debatten um militärische Aufrüstung und die Anschaffung einer deutschen Flotte. Beides mündete schließlich in waffenstarrenden Militärblöcken, die sich im Sommer 1914 gegenüberstanden. Doch bevor es soweit war, verlagerten die europäischen Großmächte ihr Augenmerk auf die Aufteilung der Welt, die vor allem in Afrika verheerende Folgen bis weit in das 20. Jahrhundert nach sich zog. Bei der „Eroberung des schwarzen Kontinents“ wurden Pseudonationen geschaffen, Grenzen mit dem Lineal auf einer Landkarte gezogen und in die Tat umgesetzt. Afrikanische Gebiete wurden so aufgeteilt, wie es den Europäern praktisch erschien. Als diese künstlich geschaffenen Gebiete in der Mitte des 20. Jahrhunderts in die Unabhängigkeit entlassen wurden, entwickelten diese Staaten eine Sprengkraft, die nach wie vor den gesamten Kontinent erschüttern.
Die Militärpotenziale der europäischen Nationen trafen nicht nur in Afrika aufeinander. Auch in Asien waren die Kolonialmächte vertreten und eroberten Teile dieses Kontinents als wesentliche Station ihres weltweiten Handels. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte Europa auf diese Weise eine weltweite Dominanz erreicht. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs wurde all das aufs Spiel gesetzt und verloren (Kocka, 2001). Am Beginn dieser „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts hatte Deutschland ein gehöriges Maß an Schuld. Die Regierung in Berlin war im Sommer 1914 einer der maßgeblichen Akteure, selbst wenn Kaiser Wilhelm II. so tat, als sei er nicht involviert, weil er mit seiner Jacht in norwegischen Fjorden segelte. Aber Deutschland trug nicht allein die Verantwortung (Münkler, 2013).
Der Erste Weltkrieg trennt die beiden Jahrhunderte, von denen das 19. „lang“ und das 20. „kurz“ war. Der erste Krieg war das Menetekel eines noch viel größeren Desasters im Zweiten Weltkrieg. Aber die Grundlagen für die Anfälligkeit der Deutschen gegenüber den radikalen Positionen der Nationalsozialisten wurden im 19. Jahrhundert gelegt. Es fehlte an Demokraten und Erfahrungen mit der Demokratie, die Zivilgesellschaft funktionierte nicht, das Parlament wurde permanent an seiner Arbeit gehindert oder durch den allein regierenden Kaiser ausgehebelt, und schließlich hatte der alltäglich gewordene Militarismus den Deutschen einen Anblick serviert, der ihnen später bei den braunen Kolonnen von SA und SS nicht fremd war.
Nationalismus und Industrialisierung waren die beiden entscheidenden Komponenten des 19. Jahrhunderts. Die Menschen wurden durch beides zwar einerseits aus ihrer gewohnten Lebensumgebung herausgerissen, erlebten aber andererseits den Aufbruch in die Moderne mit. Ökonomisch betrachtet war England durch die schon weit fortgeschrittene Industrialisierung eine Weltmacht. Frankreich hatte es zwar mit inneren Unruhen zu tun, war aber doch ein weitgehend stabiles Königreich, das sich auf seine weltweiten Kolonien stützen konnte. Deutschland hingegen kämpfte noch mit der Überwindung der Folgen der konfessionellen Spaltung, seiner geopolitischen Zersplitterung und nicht zuletzt mit den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges, der im 17. Jahrhundert die geographische Mitte des Kontinents zerstört hatte. Dadurch lag Deutschland ökonomisch deutlich hinter seinen europäischen Nachbarn zurück, auch wenn sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das wirtschaftliche Wachstum und der soziale Wandel rasch beschleunigten.
Mehr als zwei Drittel der deutschen Erwerbsbevölkerung war in der Landwirtschaft beschäftigt. Ihr Leben war eintönig, an die Scholle gebunden und warf für die Bauern nur ein bescheidenes Einkommen ab. Gleichwohl wurde der gesellschaftliche Reichtum im Agrarsektor erwirtschaftet, so dass jeder landwirtschaftlichen Innovation eine entscheidende Bedeutung zukam. Die gesellschaftliche Ordnung des ausgehenden 18. Jahrhunderts war ständisch geprägt. Die gesellschaftliche Trennung zwischen Adel, Klerus und dem aus freien Bauern und Bürgern bestehenden „Dritten Stand“ gab es im wirtschaftlichen ebenso wie im rechtlichen und sozialen Bereich. Dabei standen die Adligen mit den Fürsten und Königen an der Spitze der sozialen Rangordnung, die keinerlei Durchlässigkeit besaß. Mehr noch: Wer in eine soziale Schicht hinein geboren wurde, wurde durch Rechtsvorschriften darin festgehalten. Der Adel, der im 18. Jahrhundert von der Steuerzahlung befreit war, kontrollierte die Nutzung des Bodens und lebte von den Abgaben und Dienstleistungen, die die von ihm abhängigen Bauern zu erbringen hatten. Diese starre und jeder Modernität entgegenstehende soziale Ordnung wurde dadurch vor Veränderungen geschützt, dass den unteren Schichten kaum Wahlmöglichkeiten blieben. Sie konnten weder ihren Wohnort, noch ihre Arbeitsstelle, den Beruf und schon gar nicht ihre Ehepartner frei wählen. Ihr Leben unterlag strengen Regeln, die von ihren Grundherren überwacht wurden. Deshalb war es den meisten Menschen am Beginn des 19. Jahrhunderts nicht möglich, zu reisen, andere Städte oder Länder zu sehen. Und wenn sie ihre Region doch einmal verlassen konnten, dann traten sie eine beschwerliche Reise an, die sie in Pferdewagen über lehmige Wege von einem Ort zum anderen brachte. Den meisten Menschen wird ein derartiges Vergnügen allerdings verwehrt geblieben sein, weil sie weder das Geld noch das Interesse hatten, ihre heimatliche Umgebung zu verlassen. Mobilität bezog sich am Ende des 18. Jahrhunderts auf Händler, die den Kontinent kreuz und quer mit ihren Waren bereisten und auf fromme Pilger, deren Ziel meist der Vatikan in Rom war.
Читать дальше