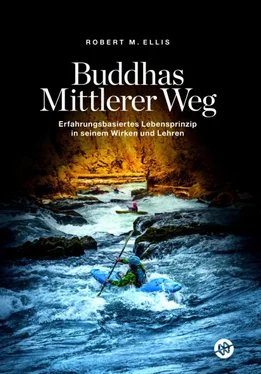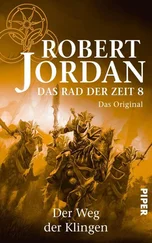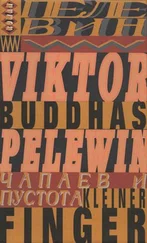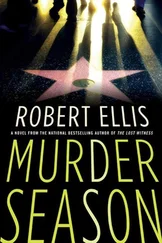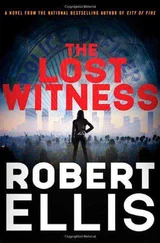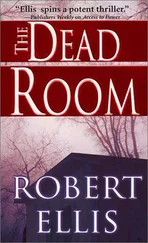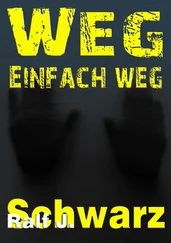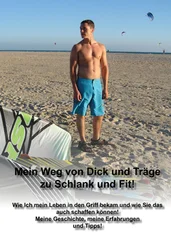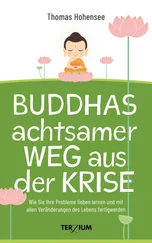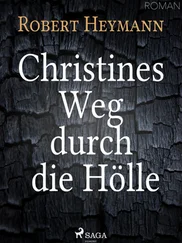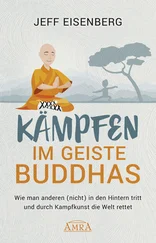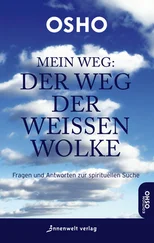Mara steht für die verabsolutierenden Kräfte in uns, die uns überwältigen, wenn wir mit Angst oder Verlangen konfrontiert werden. Einerseits lassen sie uns implizit oder explizit glauben, dass unsere projizierten Ängste (im Gegensatz zu den Bedingungen dahinter) uns verletzen können. Andererseits lassen sie uns glauben, dass unsere Projektionsobjekte der Begierde (im Gegensatz zu den Bedingungen dahinter) besessen werden können. Unsere Neigung, über Dinge in entgegengesetzten Absoluten zu denken, wird ständig durch die mächtigen Motive Angst und Begierde verstärkt, die aus der Amygdala und dem Striatum im hinteren Teil unseres Gehirns kommen. Diese Triebkräfte können uns in Extremsituationen davor bewahren, gefressen zu werden oder zu verhungern. Unter stabileren und zivilisierteren Bedingungen ist es jedoch viel wahrscheinlicher, dass sie unnötige Konflikte und Stress verursachen. Werden wir etwa mit dem unerwarteten Brüllen eines Tigers oder bewusst verführerischem Entblößen einer Brust konfrontiert, haben wir Urinstinkte, die gerne die Oberhand gewinnen. Aber es ist das ständige Wiedererinnern solcher Ereignisse, solange sie nicht auftreten, das unsere Fähigkeit stört, angemessen auf die viel häufigeren gewöhnlichen und vieldeutigen Ereignisse menschlichen Lebens zu reagieren: das harmlos herausfordernde Gerede eines Fremden, das harmlose Dröhnen eines Flugzeugs über uns oder der nicht aufreizende Blickkontakt, den ein Mann mit einer Frau auf der Straße bei ihren Alltagsbeschäftigungen aufnehmen mag. Es sind unsere Überreaktionen, die den Gleichmut bedrohen, der Teil der Praxis des Mittleren Wegs sein muss.
Daher müssen wir Maras Prüfungen in Hinblick auf die Notwendigkeit interpretieren, Verabsolutierungen auf praktisch und emotional begründete Weise zu vermeiden. Wir werden uns dann über diese extremen, emotionalen Reaktionen nicht aufregen. Gemäß dem Grundsatz des Agnostizismus können wir weder mit Angst noch mit zwanghaftem Verlangen allein durch Unterdrücken wirksam umgehen. Stattdessen müssen wir sie als Teil unserer verkörperten Situation anerkennen, während wir sie aufnehmen und sie in einem weiteren, im Körper verankerten Gewahrsein kontextualisieren. Unterdrücken funktioniert nicht, weil es uns nur in einen vorübergehenden Zustand erzwungener Selbstkontrolle führt, in dem wir weiterhin Energien aufwenden müssen, um die unerwünschten Emotionen in Schach zu halten. Unter diesen Umständen ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die die Energie zum Unterdrücken verlieren, die erforderlich ist, um Mara in Schach zu halten. Wenn er sich also weiter an uns abarbeitet und unsere einzige Antwort Unterdrücken ist, wird er uns schließlich in Begierde oder Hass treiben.
Siddharthas Errungenschaft beruht nicht auf gewaltsamer Unterdrückung, sondern vielmehr auf Integration. Die durch Maras Armee geworfenen heißen Kohlen verwandeln sich in Blütenblätter, die nicht mehr die Wucht haben, neue Konflikte anzuregen, und somit harmlos für Siddhartha sind. Solange er sich auf eine integrative Praxis konzentriert, die sich auf seinen Körper als vereinende Grundlage des Bewusstseins stützt, kann Siddhartha die Reaktionen von Angst und Verlangen vermeiden. Auf diese Weise wird er zu einem starken Symbol der potenziellen Kraft unseres eigenen Gleichmuts. Es ist keineswegs so, dass er sich überhaupt nicht anstrengen braucht, oder, dass er die störenden Emotionen einfach so akzeptieren kann. Unterdrückung im Sinne bewusster Entschlossenheit, diese Emotionen nicht zu erwidern oder auf sie zu reagieren und gleichzeitig ihre Gegenwart zu akzeptieren, ist in der Tat notwendig. Andererseits ist es auch nicht einfach eine Frage des Mutes und der Standhaftigkeit im üblichen Sinne, denn er hat es nicht mit einem üblichen Feind zu tun. Sein Erfolg bei der Integration seiner störenden Emotionen hängt davon ab, ob er in der Lage ist, sie als Teil seiner selbst anzunehmen, ohne ihre trennende und störende Form zu akzeptieren. Dies hängt sowohl von seiner Weisheit und seinem Mitgefühl als auch von seinem Mut ab.
h. Erwachen: Bedeutung versus Glauben
Das Erwachen oder die Erleuchtung des Buddha ist ein höchst vielschichtiges Ereignis, das sehr unterschiedlichen Interpretationen zugänglich ist und dennoch als grundlegend für die Identität des Buddhismus angesehen wird. Ich vertrete die Ansicht, dass es eine schlichte Frage der Prioritäten ist, wie wir das Erwachen verstehen wollen. Einerseits können wir es auf eine Weise erklären, die mit dem Mittleren Weg, als grundlegendste und universellste Einsicht, die man aus Buddhas Leben und Lehren gewinnen kann, vereinbar ist. Andererseits könnten wir auf Grundlage einer anderen, traditionelleren Interpretation des Erwachens beginnen und diese dann auf den Mittleren Weg anwenden.
Aus den bereits in diesem Buch dargelegten Gründen, ist erstere Schwerpunktsetzung aus rein praktischen Gründen zu bevorzugen. Erwachen sollte in Begriffen interpretiert werden, die mit dem Mittleren Weg vereinbar sind, nicht nur, weil der Mittlere Weg das charakteristische Beurteilungsprinzip ist, das der Buddha anbietet, sondern, weil es für jeden, überall die beste Möglichkeit schafft, die Angemessenheit der eigenen Reaktionen auf Erfahrungen zu verbessern. Das Erwachen in einer Weise zu interpretieren, die mit dem Mittleren Weg vereinbar ist, bedeutet, dass das Erwachen nicht als ein absoluter oder diskontinuierlicher Zustand verstanden werden kann, der Zugang zu irgendeiner Form von absoluter Wahrheit gewährt. Es impliziert, dass wir, wenn wir die Leistung des Buddha beachten, der Methode des Buddha in seinen Begegnungen mit Alara Kalama und Udaka Ramaputta folgen sollten. Diese Methode besteht darin, von den Methoden und Errungenschaften eines spirituellen Lehrers zu lernen, sie aber nicht notwendigerweise als letztendliche Verwirklichung oder letztes Wort zu nehmen.
Andererseits könnten Sie sich dafür entscheiden, das Erwachen so zu interpretieren, dass die Autorität der Tradition dem praktischen Wert des Mittleren Wegs übergeordnet wird. Wenn Sie dies nur um der Tradition willen tun und nicht, weil es irgendwelche praktischen Vorteile in den von der Tradition vertretenen Ansichten gibt, dann machen Sie den Denkfehler, sich ohne Bedeutung auf Tradition zu berufen. Eine bestimmte Herangehensweise ist nicht auf Grund der Anzahl oder der Autorität der Menschen richtig, die sie in der Vergangenheit verfolgt haben, sondern wegen ihrer generellen Eignung für die menschliche Erfahrung. Unser Verständnis dessen, was für die menschliche Erfahrung am geeignetsten ist, muss unseren Grad der Unwissenheit berücksichtigen. Der wirksamste Weg, die gegenwärtige Unwissenheit zu berücksichtigen, besteht jedoch nicht darin, einer traditionellen Quelle absolute Autorität zu verleihen. Diese Quelle haben wir unweigerlich selbst gewählt und interpretiert und sie kann sich später als die falsche erweisen. Ein sinnvoller Weg besteht vielmehr darin, unsere Urteile vorläufig und schrittweise zu fällen, solange wir höhere Integrationsgrade entwickeln.
Eine Entschlossenheit, das Erwachen in einer Weise zu interpretieren, die mit dem Mittleren Weg vereinbar ist, bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht tief von der Geschichte über das Erwachen des Buddha inspirieren lassen können. Wie bei jeder Geschichte, reicht ihre Bedeutung für uns weiter als die Überzeugungen, die durch sie möglicherweise hervorgerufen werden. Das Erwachen liefert ein bedeutungsvolles Symbol für das Ziel am Ende des Mittleren Wegs und der Buddha selbst kann dieses Symbol ebenfalls darstellen (s. Kapitel 6.e). Die Vorstellung, dass auch wir erwachen könnten, gibt einen Einblick in unser eigenes Integrationspotenzial. Die Schilderungen der Verwirklichungen des Buddha zur Zeit seines Erwachens geben uns auch eine vorläufige Vorstellung davon, welche Art von Einsichten wir durch eine stärkere Integration erlangen könnten.
Читать дальше