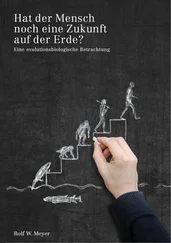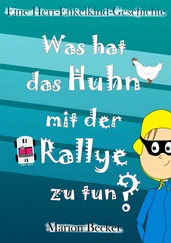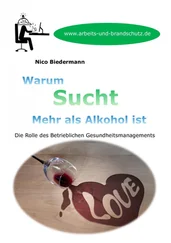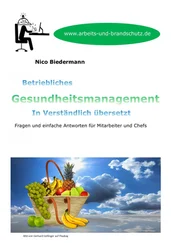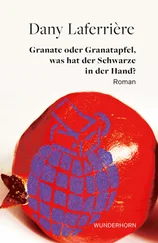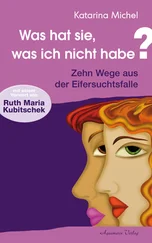Wieso ist ein Gesundheitsmanagement sowohl betrieblich als auch persönlich wichtig?
Sind Arbeitnehmer im Homeoffice gesetzlich unfallversichert?
Nicht versichert auf dem Weg in die Küche?
Ist eine Friseurmeisterin auf dem Weg zur Waschmaschine versichert?
Von der Wohnung zum Büro in den Keller versichert?
Arbeitsunfall auf dem Weg vom Kindergarten ins Homeoffice?
Wieso lassen sich Fehlzeiten nicht für die Beurteilung des Gesundheitszustandes der Belegschaft heranziehen?
Lassen sich arbeitsbedingte Einflüsse vielleicht doch auf den Krankenstand durch Fehlzeitenmanagement ermitteln?
WORIN LIEGT der Unterschied zwischen Absentismus und Präsentismus?
Was ist der Unterschied zwischen einer Dienstaufsichtsbeschwerde und Fachaufsichtsbeschwerde?
Wer darf die Behörde einschalten?
Welche Institutionen gibt es in Deutschland?
Was tun, wenn die Behörde nichts unternimmt?
Was ist eine Dienstaufsichtsbeschwerde?
Was ist eine Fachaufsichtsbeschwerde?
Welche Rolle spielt die Fachkraft für Arbeitssicherheit bei einer Fachaufsichtsbeschwerde?
Schlussbemerkung
ÜBER DEN AUTOR
Ein Pawlowscher Hund am Arbeitsplatz? FOMO als Sicherheitsrisiko und an Steharbeitsplätzen brauchen wir etwas zum Hinsetzen? Schuld soll die Venenpumpe sein? „Night Shift“ am Tablet hilft die optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz zu erklären?
Das klingt alles sehr verwirrend, aber die optimale Gestaltung des Arbeitsplatzes ist mit den Alltagsphänomenen erklärbar. Ich habe versucht ein kleines Büchlein zu schreiben, dass sich an Angestellte und Unternehmer richtet. Es soll helfen, interessante Fragen zu den gesetzlichen Vorgaben mit dem Verständnis unserer Anatomie in Verbindung zu bringen. So erfahren Mitarbeiter, was sie tun können, wenn der Chef nicht „spurt“. Der Arbeitgeber erfährt, was er tun muss, damit die Mitarbeiter gern an den Arbeitsplatz kommen. Die Erkenntnisse lassen sich dann am Arbeitsplatz und zu Hause umsetzen. Die Einrichtung des Arbeitsplatzes ist eben kein Hexenwerk!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und verstehen, warum die gesetzlichen Vorgaben so sind wie sie sind…
Herzliche Grüße,
Ihr Nico Biedermann
Was bedeutet Maßnahmenhierarchie?
Was ist ein STOP – Prinzip?
Der Start in dieses Buch soll mit dem Grundprinzip der Arbeitssicherheit beginnen. Dabei eignet sich das Beispiel der Gefahrstoffe.
Nicht immer ist eine belastende Atemschutzmaske notwendig. Nämlich dann nicht, wenn es nichts Gefährliches zum Einatmen gibt. Nach diesem Prinzip funktioniert der gesamte Arbeitsschutz. Doch das ist jetzt sehr abstrakt und soll nun etwas mehr Praxisbezug bekommen.
Bei der Diskussion über Gefährdungen und die zu ergreifenden Maßnahmen taucht immer wieder der Begriff STOP-Prinzip oder TOP-Prinzip auf. Dabei darf der Chef nicht irgendwas machen. Wer mit flüchtigen Substanzen arbeitet, die beim Einatmen schädlich sind, sollte nicht auf gut Glück eine Atemschutzmaske bekommen. Das ist erst dann zulässig, wenn es keine technischen Maßnahmen gibt, die umgesetzt werden können.
Kann der Stoff nicht durch einen weniger gefährlichen ersetzt werden (S für Substitution), dann muss ein Abzug installiert werden (T für Technische Maßnahme). Das STOP-Prinzip ist ein Gebot im Arbeitsschutz, welches besagt, dass die Persönliche Schutzausrüstung /(PSA) immer erst der letzte Schritt ist. Deswegen steht das „P“ bei TOP an letzter Stelle. Strenggenommen sprechen wir aber statt von einem TOP-Prinzip von einem STOP-Prinzip, denn das oberste Gebot lautet, dass erst zu prüfen ist, ob der Stoff, von dem eine Gefahr ausgeht, komplett durch einen weniger gefährlichen ersetzt werden kann. Deswegen steht das „S“ für Substitution. „T“ für Technische Maßnahme wurde bereits geklärt. Nun fehlt noch das „O“ für die organisatorischen Maßnahmen, denn das „P“ haben wir auch schon geklärt. Doch nun sortieren wir das einmal.
Was bedeutet Maßnahmenhierarchie?
Durch das STOP Prinzip wird eine Hierarchie für die umzusetzenden Schutzmaßnahmen vorgegeben, also in welcher Reihenfolge welche Maßnahmen umzusetzen sind.
Beim STOP Prinzip bedeuten die Buchstaben folgendes:
S – Substitution (ersetzen)
T – Technische Schutzmaßnahmen
O – Organisatorische Schutzmaßnahmen
P – Persönliche Schutzmaßnahmen
Demzufolge ist bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen immer zu prüfen, ob ein Ersatz möglich ist. Wenn nicht, stellt sich die Frage:
Gibt es technische Schutzmaßnahmen? Wenn nein:
Lassen sich die Gefährdungen durch organisatorische Maßnahmen verringern?
Erst wenn das auch nicht möglich ist, gilt es die optimale persönliche Schutzausrüstung (PSA) festzulegen. Aber eben auch erst dann! Darauf achtet auch die Behörde, wenn eine Begehung stattfindet.
Beispiele dieser Hierarchie:
Substitution Werden Gefahrstoffe oder Arbeitsmittel durch weniger gefährliche (Stoff, mit dem das gleiche Arbeitsergebnis umgesetzt werden kann, der aber weniger gefährlich ist) ersetzt, wenn es die Möglichkeit gibt?
Technisch Werden technische Schutzmaßnahmen vorrangig eingesetzt? (Gefahrstoffabzug statt Maske)
Organisatorisch Werden die Mitarbeiter regelmäßig qualifiziert oder muss durch zeitliche Regelungen die Aufenthaltsdauer reduziert werden?
Persönlich Ist geeignete PSA vorhanden und wird diese auch benutzt?
Solch ein Ablauf der Überprüfung erfolgt i.d.R. als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung.
Was ist ein Arbeitsschutzausschuss (ASA)?
In der Regel muss der Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuss (ASA) bilden. Dieser berät über aktuelle Themen des Arbeitsschutzes und dient auch dem Informationsaustausch.
Die Verpflichtung zur Organisation dieses mindestens vierteljährlich zusammentretenden Kreises ergibt sich aus §11 (ASiG) „Arbeitsschutzausschuß“ und setzt sich auf jeden Fall aus dem folgenden Personenkreis zusammen:
dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten,
zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,
Betriebsärzten,
Fachkräften für Arbeitssicherheit und
Sicherheitsbeauftragten
Wer sonst noch an einem ASA teilnehmen kann, ergibt sich aus den zu besprechenden Themen, bzw. wenn andere Fachkompetenzen gefragt sind.
Wie ist der Arbeitsschutz in Deutschland organisiert?
Was sind Schutzziele?
Für die Sicherheit im Betrieb definiert die Gesetzgebung den Rahmen und legt sogenannte Schutzziele fest. Bei der Umsetzung dieser abstrakten Vorgaben kommen verschiedene Akteure ins Spiel. Doch welche Player sind wann beteiligt? Welche Rolle spielen die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt?
Wie ist der Arbeitsschutz in Deutschland organisiert?
Um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber verschiedene Regelwerke geschaffen. Darin sind sogenannte Schutzziele festgelegt, die den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter gewährleisten sollen. So kann bspw. ein Schutzziel sein, dass eine übermäßige Belastung durch Lärm ausgeschlossen wird. Dabei kann sich Lärm auf eine langfristige Schädigung des Gehörs auswirken, Lärm kann aber auch die psychische Gesundheit der Mitarbeiter verschlechtern. Das gleiche gilt für die Beleuchtung. Zu wenig Beleuchtung kann dafür sorgen, dass sicherheitsrelevante Hinweise nicht wahrgenommen werden. Das falsche Beleuchtungsspektrum sorgt dafür, dass das psychische Wohlbefinden verringert wird. Also sind die Schutzziele die übergeordneten Ansprüche, die wir erfüllen müssen.
Читать дальше