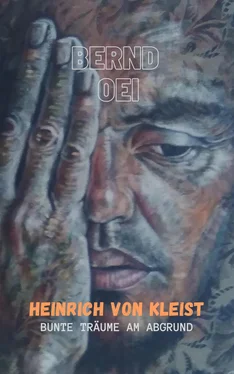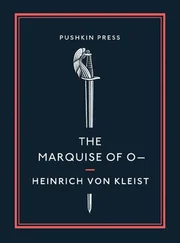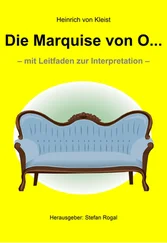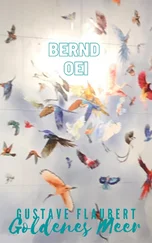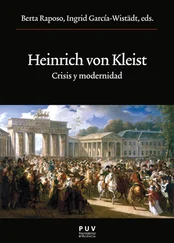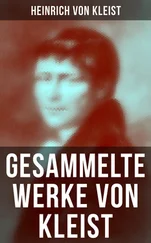Die Kritik an der Rationalität setzt mit den Erfahrungen des Großstadtlebens und der Entscheidung zum Nomadenleben ein. Von Kleist macht die Erfahrung der Entwurzelung auf physischer wie psychischer Ebene. Zwar haben Themen der Philosophie von Kleist fundamental bewegt, aber er ist kein Philosoph im methodischen oder systemischen Sinn. Die Formulierung solcher Probleme erfolgt bei ihm nur in Form von Vorgängen oder Fällen, szenisch wie erzählerisch. Kleists Briefe sind vor allem für seine eigene Dichtung hochwichtig: sein Leben scheint nur aus dem Werk heraus zu verstehen.
In Paris erblickt von Kleist einen apokalyptischen endzeitlichen Zustand der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Wirklichkeit setzt sich allen philosophischen Entwürfen der Aufklärung als reale Verneinung entgegen. Der Ursprung seiner Dichtung liegt in der Entdeckung der Grundprobleme von Zeit und Gesellschaft, dem Aufeinanderprallen von Rationalität und Gefühl.
I. 2. Das Duell mit sich selbst
I. 2. 1. Eine Gegenüberstellung mit Puschkin
Nach gregorianischen Kalender (in Russland erst mit der Oktoberrevolution 1918 eingeführt), wird der zweifellos bedeutendste Dichter Russlands am 6. Juni 1799 geboren; er ist etwa 22 Jahre jünger als Heinrich von Kleist. Von dunklen Ahnungen, der bizarren Synthese aus Aufklärung und und Aberglaube erfüllt, bewegt sich sein Werk gleichfalls zwischen Romantik und Realismus. Der Heißsporn, der auch von Kleist bisweilen sein kann, duelliert sich als Offizier infolge einer Intrige mit dem französischen Gardeoffizier Georges-Charles de Heeckeren d’Anthès am 8. Februar 1837. Er wird dabei durch einen Bauchschuss schwer verletzt, an deren Folge er zwei Tage später im Alter von 36 Jahren in Moskau verstirbt, womit er nur wenig älter wird als Heinrich von Kleist.
Die beiden Männer geraten trotz ihrer Reputation aufgrund ihrer liberalen Gesinnung häufig unter Generalverdacht, sehen sich zensiert, verfolgt, ins Exil verbannt. Heinrich von Kleist erschießt sich am Kleinen Wannsee am 21. November 1811. Im selben Jahr tritt Puschkin in die Armee ein.
Gemeinsamkeiten finden sich viele: neben der aristokratischen Herkunft eines alteingesessenen, doch verarmten Adels, dienen sie als Offiziere einem autokratischen System, das sie im Grunde verachten. Ihre liberale Gesinnung zwingt sie ins Exil. Ein kaum zu überbietende Reisefieber, Rastlosigkeit, Nomadenexistenz sind die Folge inklusive der (romantisierten)Todessehnsucht. Ambivalenz prägt ihren Geist. Sie bewundern die französische Kultur, sprechen fließend Französisch, doch aus den Napoleonischen Kriegen erwächst während der Befreiungskriege Feindschaft und Patriotismus. Literarisch brechen sie mit der Tradition und sind schwer zuzuordnen; zudem engagieren sich beide für die Herausgabe eigener kritischer Zeitungen, die ökonomische Misserfolge werden.
In ihren Dramen, Erzählungen und in der Lyrik ist das Thema der Gewalt leitmotivisch, nicht zuletzt wird auch das Duell mehrfach beschworen. Das Übersinnliche und Monströse ist beiden vertraut; Puschkins „Der eherne Reiter“ (in dem sich das steinerne Monument des ersten Zaren verselbständigt) und die rächende Steinstatue in „Don Juan“ dokumentieren dies.
Sowohl Kleist als auch Puschkin sind unversöhnliche Opportunisten der Autokratie, von der Zensur Verfolgte und zeitweise aus ihrer Heimat Verbannte. Es verbindet sie die Kombination aus Freiheit und Mutwille, die man auch als Hasardeur bezeichnen könnte. Mit Puschkin erfährt Russland eine Hinwendung zum Nationalstolz trotz seiner Rückständigkeit. Bezeichnend dafür ist Puschkins Paradox: „ Natürlich verachte ich unser Vaterland vom Kopf bis zu den Zehen, aber es ist mir auf das Äußerste zuwider, wenn ein Ausländer dieses Gefühl mit mir teilt."
Vergleicht man Puschkins Erzählung „Der Schuss“ (1830) mit von Kleists Erzählung „Der Zweikampf“ (1811), so lehnen sich beide an historische Ereignisse an, die sie sehr frei interpretieren. Im Fall von Kleist handelt es sich um den Hundertjährigen Krieg, in dem Gottesurteile üblich waren, bei Puschkin spielt die Schlacht von Sculenji im heutigen Moldawien während des osmanisch-griechischen Krieges eine Rolle. Eine Interpretation der Novelle Kleists 7verweist mit seiner Metapher der „ Tarnkappe “ der politischen Opposition auf die Zensur, die Autoren zu historischen Chiffren nötigt. Selbiges gilt auch für Puschkins Novelle „Der Schuss“. In beiden Geschichten geht es um ein Duell und die Auseinandersetzung mit sich selbst durch einen äußeren Rivalen. Im Zentrum steht die Triade Ehre, Recht und Rache; die Finalisierung läuft apodiktisch auf den Tod hinaus, da er ihr innerer Zweck ist.
Das Geheimnis wird durch Selbstoffenbarung gelüftet, dennoch bleiben viele Rätsel offen, die Unglaubwürdiges beinhalten. Das Leben ist nur Spiel, das Fragen der Theodizee aufwirft.
Herrlicher als Kleist ist keiner gestorben, urteilt Zweig: er rühmt die konsequente Selbstbestimmung des Dichters zu einem Zeitpunkt, an dem er noch an eine Wende glaubt und am Leben festhält, es nahezu an sich reißt.
Von Kleists bis ins letzte Detail inszenierter Tod ist mit dem Begriff Selbstmord nicht vollständig oder befriedigend erfasst. Die Tötung Henriette Vogels, Frau des Rendanten Friedrich Ludwig Vogel ist nach den Begriffen der Zeit ein Mord, die Selbsttötung eine Konsequenz von unerhörter Sachlichkeit. Zudem kann dem Doppel-Mörder Kleist nicht sein tiefer christlicher Glaube abgesprochen werden.
Sein fröhlicher Spazier-Gang in den Tod gleicht dennoch einer Hinrichtung, Selbstbestrafung und Anklage. In der Literatur kündigt er sie ohnehin an; kaum ein Werk kommt ohne gewaltsames Sterben aus. In von Kleists Dichtungen sind Konsequenzen rechtlichen Charakters aus vorangegangenen Taten. Nicht ohne Bedeutung auch der Ort: auf einer leichten Anhöhe, nahe der Brücke, die den heutigen Kleinen und Großen Wannsee trennt, in Sichtweite der großen Heerstraße zwischen dem militärischen und dem politischen Zentrum des Staats, zum immer währenden Gedenken für alle, zum fortdauernden Vorwurf aber an das Königshaus. Das hat man dort gewusst und verstanden; die Prinzessin Marianne deutet es am 8.1.1833 in ihrem Tagebuch an.
Der komplizierte, verstörende Vorgang wirft tiefe Schatten auf von Kleists ganze Wirkungsgeschichte, insbesondere einer grotesken Heroisierung während des Nationalsozialismus. Der Vorwurf, eine der reichsten Begabungen der deutschen Dichtung sei an Gleichgültigkeit und Unverstand der Öffentlichkeit, der Kritik, der Obrigkeit zugrunde gegangen, ist Bestandteil des Kleist-Mythos geworden, die Kunst weiter zu gehen (Cuonz) oder die Sehnsucht kein Selbst zu sein (Kehlmann) führen zu einem entstellten Ideal (Ruprecht).
Nekrolog: Zwei Masken, die sich beäugen, kriegerisch sich zugetan, ein Bild mitten im nunmehr vollendeten Rätsel. Unbegreiflich bleibt sein Leben, fassbar nur der Tod. Schweigsam beredt und bedeutsam in den Lücken, den Punkten und Auslassungen, der Morgentau glänzend, wo Raureif die Gräser streichelt. Wie im Rausch ist der Mensch, im Fieber liebt und stirbt sich´s am besten. Abschied von der Qual. Auf Erden nie, im Himmel vielleicht, eher in der Hölle wird ihm zu helfen sein. Wo ist sie hin, die mächtigste Stunde seines Lebens, die ihm zeigt, dass der Zeiger springt, die Zeit klemmt, wenn sie sich ins Mechanische gesperrt sieht. Hört er die Zeit gehen, als das Mondlicht den Schatten seiner Lippen küsst? Oder ist es doch am helllichten Tag, inmitten von Eselslärm, als die Kutsche wankt und schließlich fällt, er überlebt, doch gleichsam nur als ein anderer. Der Vernunft erster Diener will er sein, am Ende ist alles Liturgie, nur noch Musik hat der Gewaltige in seiner Brust, wenn er die Sirenen schweigen und den Seraphim Posaune blasen hört. Sprache gleicht einem inneren Verhör, einem Tasten und Stolpern, endlos müht er sich, das Geschrei des Esels zu vergessen, doch es sind zu viele Esel unter ihm. Ulrike leuchtet in bunten Träumen aus dunklen Schlössern mit ihren fahl leuchtenden Gräbern.
Читать дальше