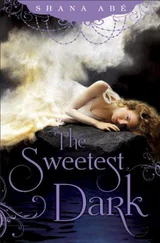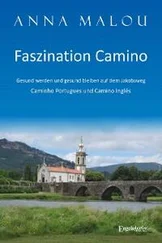Vor uns erhebt sich ein verfallen aussehendes Kloster, von dem Gebäudekomplex nehme ich einige Fotos auf. Auf den zweiten Blick scheint es keine Ruine zu sein, die meisten Gebäude sind gut erhalten, dennoch ist der von Mauern umgebene Garten verwildert und vereinzelte Mauerreste ragen zwischen Brombeerranken hervor. Gerne würde ich mir das genauer ansehen, jedoch sind meine beiden Begleiter mittlerweile ein gutes Stück auf dem steilen Anstieg, der dem Kloster folgt, voraus gewandert.
Ich setze mich wieder in Bewegung, schleppe mich aufwärts und lege noch einen Zahn zu, um im Laufschritt zu meinen Kollegen aufzuschließen. Fast geht mir die Luft aus, bis der Trampelpfad, der durch einen Kastanienwald führt, wieder flacher wird.
Die Franzosen legen durchgehend ein zügiges Tempo vor. Ich kann gerade noch mithalten, meine Stiefel bieten auf dem matschigen Boden wenig Halt und ich strauchle regelmäßig, mir gelingt es aber immer wieder, mich gerade noch abzufangen. Abermals schlittere ich, rudere mit den Armen und … Platsch! Diesmal lande ich in einer Lache aus Matsch und modrigen Herbstblättern. Die Franzosen halten einen Moment und fragen: »Alles okay?« Ich stehe auf, wische mir den Schlamm aus dem Gesicht und antworte: »Alles gut!«, worauf sie, wieder beruhigt, die Wanderung in ihrem Tempo fortsetzen. Und bald außer Sichtweite verschwunden sind.
Für die Tour hatte ich - in weiser Voraussicht - eine wasserdichte Regenhose eingepackt, was sehr schlau ist. Hätte ich sie nur angezogen. Das wäre noch schlauer gewesen.
Was soll das Gehetze? Mit diesen Franzosen kann ich definitiv nicht mithalten. Eigentlich hatte ich mich für einen sehr fitten Wanderer gehalten, denn auf der ersten Etappe im vergangenen Sommer über die Pyrenäen, auf dem Camino Francés, hatte ich in kurzen Abständen andere Pilger überholt. Meine Begleiter, die mich soeben abgehängt haben, sind ganz andere Kaliber: Berufssportler, gestählt durch ihre alpine Heimat und nahezu halb so alt wie ich. Nun bin ich alleine, trotte gemütlich vorwärts und sammle ab und zu Kastanien, bis ich das Waldende erreiche. Eine Ebene öffnet sich vor mir und ein Brunnen plätschert vor sich hin.
Bei Santiago kann ich mich reinwaschen: die Quelle ist dem Heiligen Apostel gewidmet. Klares Wasser lasse ich über Jacke und Jeans laufen und schrubbe mit einer Socke den Schlamm herunter, bis meine Kleidung einen halbwegs sauberen Eindruck macht. Ich will ein zivilisiertes Erscheinungsbild abgeben, wenn ich die nächste Siedlung erreiche, einigermaßen wenigstens. Ein paar verbleibende Flecken von Matsch werden auf meinen schwarzen Jeans wohl nicht auffallen.
Wenn die Tour so weiter geht, werde ich bald über mich selbst lachen – über meine Idee: auf jeden Fall, noch vor Jahresende, nochmal wandern zu gehen. Das musste sein, unbedingt! Tolle Idee.
Leichter Wind streift durch die Ebene und trocknet meine Jeans bei der Wanderung entlang der stark befahrenen Landstraße. Sie führt an einer riesigen Milchfabrik vorbei, in der möglicherweise die gesamte Milchproduktion Asturiens verarbeitet wird und gleichzeitig kündigt sich die nächste Stadt an: Salas. Eine Ritterburg mit zwei Türmen prägt das Zentrum dieser mittelalterlichen Stadt. Man könnte diese Burg auch besichtigen, jedoch um diese Uhrzeit nicht mehr, denn das Tourismusbüro ist nachmittags geschlossen.
Eines der Argumente, eine Wanderung in dieser Region zu machen ist: Restaurants und Unterkünfte sind sehr billig. Für 8 Euro bestelle ich mir in dem Ort ein Menú del Dia – es besteht aus vier Gängen. Und zwar deswegen, weil ich zuvor naiv die Frage stellte, ob es auch Salat zur Auswahl gäbe. Das stand nicht im Angebot. Der erste Gang wäre nur Garnelensuppe, jedoch wird mir als Vorspeise zusätzlich Tomatensalat serviert. Ein Extra-Service. Hier geht auf man auf die Sonderwünsche jedes Gastes ein. Endlich wieder kostengünstig und reichhaltig schlemmen: wie habe ich das vermisst!
Währenddessen setzt Gewitter ein, der einen Starkregen auslöst. Und der nicht nachlässt. Beim Kellner erkundige ich mich vor Verlassen des Restaurants, wo der Camino weiterführen würde. Er beschreibt den Weg und zeigt mir, nach welcher Abbiegung ich die nächste Markierung finden werde, fragt mich aber verunsichert, was ich denn dort wolle? - bei dem Unwetter sicher nicht durch den Wald gehen, er könne mir ein Taxi rufen.
Doch, ich will weiter, versichere ich ihm, obwohl ich beim Blick vor die Tür und auf den munter plätschernden Bach, der sich wie eine Kreuzotter die Straße hinunterwindet, wenig Lust verspüre, weiterzugehen. Es sieht jedoch nicht so aus, als ob das Warten besseres Wanderwetter bringen würde, daher nehme ich all meine Willensstärke zusammen und wecke den Pilger in mir. Diese Tour habe ich mir ausgesucht, bin also quasi auf einer Mission. Trotz aller Widrigkeiten muss ich da durch. Einfach die Zähne zusammenbeißen und hinein in die Düsternis.
Am Ortsende von Salas beginnt ein Waldstück, die Markierungen führen bergauf. Was zu anderen Jahreszeiten ein Wanderweg wäre, hat sich in einen Fluss verwandelt. Ich wandere entgegen der Strömung und versuche, wo es möglich ist, seitlich auszuweichen und denke: Alles ist im Fluss … hat der Philosoph, der diese sinnlosen Worte verkündet hat, diese Tour unter gleichen Bedingungen unternommen? Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, dass der Camino sich durchgehend in einen wilden Bach verwandelt hat. Abrupt endet er und mündet in eine Straße.
Der Verlauf meiner heutigen Teilstrecke ist in weiten Teilen zerstört durch den Neubau von Autobahnen und Schnellstraßen, führt über Serpentinen eine brandneue, aber enge Landstraße hinauf, die beidseitig flankiert ist von Leitplanken. Es gibt keine Alternative, als auf der Straße zu pilgern. Sollten Autofahrer mich jetzt übersehen, ist es mit dem Pilgerleben vorbei. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Es ist düster und neblig. Und es schüttet durchgehend.
Bei der Ankunft in Bodenaya ist der Empfang sehr herzlich – die Franzosen waren, wie erwartet, lange vor mir angekommen und begrüßen mich zusammen mit der Hospitalera, für die der Camino der wichtigste Lebensinhalt zu sein scheint. Warum, wird mir klar, als ich erfahre, welche Krankheit sie überwunden hat und am eigenen Leib bemerkt hat, wie kurz das Leben sein kann.
Während ich meine Wäsche aufhänge, von der nicht ein einziges Stück trocken geblieben ist und mich im Anschluss vor den Holzofen setze - die einzige Wärmequelle der Herberge - läuft im Hintergrund ein Kassettenrecorder. Ein melancholisches Lied wiederholt sich den ganzen Abend, wohl der Lieblings-Chanson der Herbergsverwalterin: »¿Peregrino, donde vas …?« - Pilger, wo gehst du hin? Langsam beginnt das Gefühl in meinen Armen und Beinen, die fast taub waren, zurückzukehren, was sich mit Schmerzen ankündigt.
Die Herberge hat einen besonderen Flair, rustikal im Fachwerkstil mit offenen Holzbalken. Vielleicht ein restauriertes Bauernhaus. Mit einem Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss, in dem sich eine Küche, ein Tresen mit Barhockern und eine große Tafel befindet. Dort sitzen die Anderen und plaudern.
Bevor ich mich an den Tisch dazugeselle, begebe ich mich ins Badezimmer der Herberge und verbringe dort einige Zeit, lese einen Zettel mit dem Hinweis, man solle doch bitte sparsam mit dem Wasser umgehen und beginne bei der Wohltat des warmen Duschbades fröhlich zu pfeifen, während ich fühle, wie meine Lebensgeister durch das warme Wasser wiedererweckt werden.
Als ich fertig mit Duschen bin und mich zu den Anderen gesetzt habe, serviert die Herbergsverwalterin uns ein Abendessen mit Schnitzel und Salat für jeden, während sie berichtet: die letzten Tage hätte sie alleine in dieser Herberge ausgeharrt, derzeit wäre kaum jemand auf dem Camino unterwegs, jedoch hätte sie eine Vision gehabt: 3 Pilger werden heute ankommen. Sie habe sich aus dem Grund entschlossen, für vier Personen einzukaufen. Und sie erzählt ein wenig über ihr Leben als Hospitalera: sie wäre Italienerin, betreue jährlich mehrere Monate diese Unterkünfte, und den folgenden Tag würde sie nach O Cebreiro fahren, um dort die Pilgerherberge des Camino Francés zu betreuen.
Читать дальше