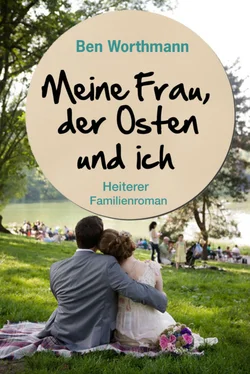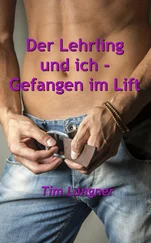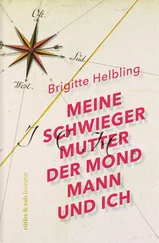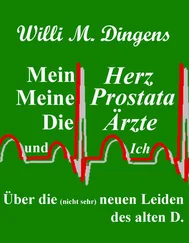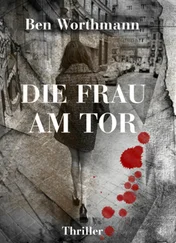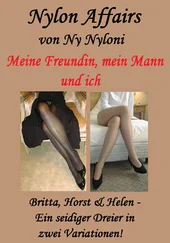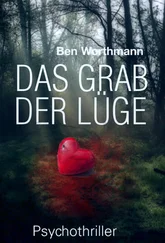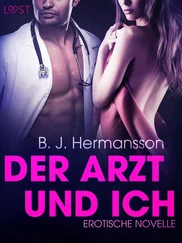Der Strand zum Beispiel war zwar nicht völlig unbenutzbar, ließ aber doch zu wünschen übrig, weil einfach im Verhältnis zu dem Sand zu viele Steine herumlagen. Es gab auch Strandkörbe, und Anna, die ein besonderes Faible für diese Freiluftmöbel hat und sich dort besser auskennt als ich, behauptete sogar, sie seien ganz bequem, nur waren sie leider dauernd alle ausgebucht, weil es zu wenige gab. Das Wasser - nun ja, es war die Ostsee, aber im Unterschied zur westdeutschen Ostsee schien diese ostdeutsche Ostsee einen deutlich höheren Besatz mit Tang, Algen und Quallen aufzuweisen. Anna hatte hierzu nichts anzumerken, da sie es ohnehin ablehnt, im Meer zu baden. Julius meinte nur, dies sei nicht das, was er von Timmendorf gewohnt sei.
Wollte man essen gehen, war das so eine Sache. Man konnte Glück haben und auf einigermaßen bemühtes, leidlich kompetentes, gelegentlich sogar freundliches Bedienungspersonal treffen. Doch zu behaupten, der Dienstleistungsgedanke hätte sich hier bereits auf breiter Front durchgesetzt, wäre eine Übertreibung gewesen. Was dominierte, war jene gewisse Abwehrhaltung aus den Zeiten, da der Gast als der natürliche Feind des Kellners gegolten hatte. Die Preise allerdings, die bewegten sich ohne weiteres auf Timmendorfer Niveau, in dieser Beziehung war die Angleichung der Lebensverhältnisse vollauf gelungen.
Und dann gab es noch die Strandpromenade. Eine Strandpromenade sollte zur Erbauung und Entspannung der Urlaubsgäste dienen, sozusagen als eine kleine Aufmerksamkeit der örtlichen Verhältnisse an die Adresse derjenigen, die schließlich Geld mitbringen - denkt man. Hier allerdings verhielt es sich so, dass die Strandpromenade von jugendlichen Glatzköpfen als Rennstrecke benutzt wurde. Man konnte den Eindruck haben, dass sie mit ihren ost- und westdeutschen Kleinwagen beinahe rund um die Uhr auf- und abfuhren, wohl in der stillen Hoffnung, vielleicht doch einmal einen Touristen auf die Kühlerhaube nehmen zu können. Vermutlich waren sie frustriert, weil es in dieser Gegend nicht genügend Asylbewerber gab. Es gibt auch heute immer noch Menschen, denen solche Typen leid tun, weil es dort, wo einmal die DDR war, keine Jugendheime mehr gibt und zu wenig Arbeit und zu viele Videotheken und überhaupt einen Mangel an Lebenssinn. Ich fand und finde es schlicht ärgerlich, ansehen zu müssen, wie tief der Mensch sinken kann, viel mehr muss man dazu im Grunde nicht sagen.
Anna war jedenfalls nicht besonders begeistert von diesem Urlaubsort, Julius auch nicht, und was mich betraf, so mischte sich der Mangel an Begeisterung mit meinen Sorgen wegen meines Jobs und noch einigem anderen Ärger, so dass sich insgesamt nicht gerade die allerbeste Stimmung ergab. Mir fielen die Warnungen einiger Kollegen wieder ein, die aus dem Osten stammten und von denen es bereits eine Reihe bei jener Westberliner Zeitung gab, bei der ich als Leiter des Ressorts Innenpolitik beschäftigt war. Insbesondere ein älterer Reporter, ehemals bei führenden Publikationsorganen des Arbeiter- und Bauernstaates beschäftigt und neuerdings ein großer Verfechter des Projekts Vereinigtes Vaterland, hatte mich sorgenvoll beiseite genommen und mir dringend geraten, das Ganze zu überdenken. Es sei noch zu früh für solche Abenteuer, hatte er gemeint. Seine „Landsleute“, wie er sie nannte, seien noch nicht so weit, um „in urlaubsspezifischer Hinsicht“ allen westlichen Ansprüchen zu genügen.
Ich schlug seine Warnung in den Wind, obschon er im Grunde ein vertrauenswürdiger Mensch war, so vertrauenswürdig, wie jemand in diesem Metier sein kann. Ich duzte mich übrigens aus Prinzip mit allen, die aus dem Osten waren, ungeachtet der Hierarchie. Das war mir einfach ein Bedürfnis. Dieses ganze Kapitel deutsche Einheit hatte ich für mich längst abgehakt, das war eigentlich kein Thema mehr, es war so gekommen, wie es irgendwann hatte kommen müssen, auch wenn es keiner geglaubt hatte, aber ich fand es ganz in Ordnung. Und das hatte nichts mit dieser Renegatenhaltung zu tun, die groß in Mode war und ein paar Jahre später bekanntlich noch einmal zu höchster Blüte gelangen sollte.
1968 erledigen - das wurde rasch zum erklärten Lieblingssport der Nachgeborenen. Die sogenannten 89er machten sich überall breit, auch bei unserer Zeitung, und das einzig Bemerkenswerte an ihnen war, wenn man es unter soziologischen, ästhetischen und dramaturgischen Aspekten betrachtet, die Erkenntnis, dass junge Leute ziemlich alt aussehen können. Sie wollten oder konnten nicht verstehen, dass 68 vor allem eine große Fete gewesen war - es gab endlich die richtige Musik und die Mädchen waren nicht mehr so verklemmt.
Für manche mag die Chiffre 1968 mit Berlin verbunden sein, schon wegen der vielen Demonstrationen, die im Fernsehen gezeigt wurden. Doch selbst das ist ein Missverständnis. Für alle, die damals nicht in Berlin weilten - also für die meisten ebenso wie mich -, hatte 1968 mit Berlin wenig zu tun. Mir war damals Berlin nicht nur gleichgültig, es ging mir die Nerven. Diese dubiose Mischung aus Heinrich Zille und Luftbrücke, Stacheldraht und spießigem Ku'damm-Glamour, aus verlogenem Insulaner-Trotz und abgestandenen Erinnerungen an tote goldene Zwanzigerjahre, dieser ganze Preußen-Humbug, garniert mit Bratwurst und Plüschbären, all dieses pathologische Pathos mit Weißbier und Kreuzberger Müsli - das war für meine Begriffe einfach deprimierend. Meinethalben hätte Berlin nicht nur zwei-, sondern viergeteilt gewesen sein können.
Manchmal dachte ich, man sollte Berlin gegen Israel umtauschen, das wäre für alle Beteiligten die gerechte Strafe gewesen. Berlin in den Nahen Osten exportieren und dafür Israel mitten nach Deutschland verlegen - das hätte die Lösung vieler Probleme sein können, nur konnte man so etwas kaum jemandem erzählen, ohne schief angeguckt zu werden.
Doch als dann gut zwanzig Jahre später die bekannten Ereignisse eintraten, machte ich rasch meinen Frieden mit dieser Geschichte. Vielleicht war dies auch die diskrete Rache Berlins an mir. Jedenfalls, ich war schon dort, als die Mauer fiel - wenn auch weniger Berlins wegen, als hauptsächlich aus Karrieregründen, was aber nichts daran ändert, dass ich es völlig in Ordnung fand, als das große Ereignis passierte, und damit ist mein Konto aus ethischer Sicht im Grunde ausgeglichen. Es war einfach eine Frage der Gerechtigkeit, den Ostdeutschen nicht weiter vorzuenthalten, was die Westdeutschen unverdientermaßen bereits hatten. Man hätte ja ganz Deutschland nach dem Zweiten Wehkrieg auch abschaffen können, moralisch wäre das leicht zu begründen gewesen.
Das wirklich Problematische an den sogenannten 89ern war in meinen Augen, dass sie die Vorgängergeneration immer nur nach 68 fragten, das nagte an ihnen, dass sie nicht dabei gewesen waren, es war fast schon rührend. Wir 68er hatten unsere Väter immerhin nach Auschwitz gefragt, und dass wir dort nicht dabei gewesen waren, empfanden wir nun wahrlich nicht als Mangel. In gewisser Weise taten mir die 89er leid, sie litten offenbar unter einer biographischen Defizit-Neurose - das war die ganze Geschichte, aber helfen konnte ihnen letztlich keiner.
So begrüßenswert mir übrigens die Einigung erschien, so schwierig fand ich es anschließend, den nunmehr mit uns Vereinten durchweg mit Wohlwollen zu begegnen. Einige Bewohner des sogenannten Beitrittsgebiets waren, gelinde gesagt, eine Enttäuschung, sobald man sie erst in natura erlebt hatte. Zu den Privilegien derjenigen, die ihren Hauptwohnsitz in Berlin hatten, zählte es, diese Entdeckung etwas schneller zu machen als etwa die Bewohner von Mönchengladbach oder Kaiserslautern. Tief im Westen brauchten sie noch Jahre, um die Feinheiten der neuen föderalistischen Folklore mitzubekommen. Noch weniger als manche Ossis allerdings gefielen mir die Wessis, die die Ossis nicht mochten. Diesen Spruch, dass Deutschland ein schwieriges Vaterland ist, hätte sich gar nicht jemand anderes auszudenken brauchen - er hätte auch ohne weiteres von mir sein können. Ambivalenz, das ist das Wort, das es beschreibt, und unser Urlaub an der ostdeutschen Ostseeküste hatte in dieser Beziehung etwas Symptomatisches.
Читать дальше