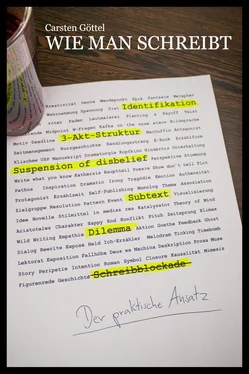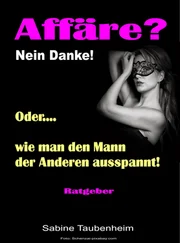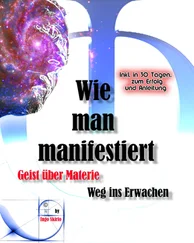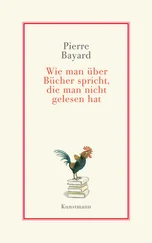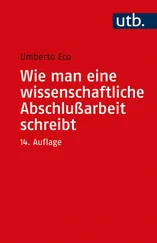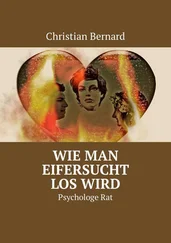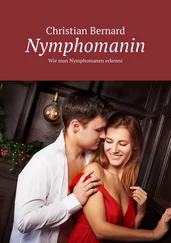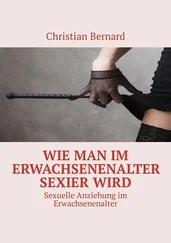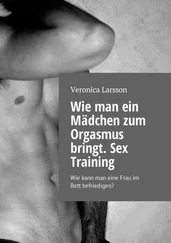Dies sind beides Hinweise darauf, dass Ihre Geschichte fertig ist und Sie jetzt der Symptomatik des Kreativen verfallen, Sie nicht loslassen zu wollen. Immerhin hat Sie über einen langen Zeitraum einen Fokus in Ihrem Leben eingenommen und der letzte Punkt bedeutet gleichermaßen eine plötzliche Leere. Doch, so wie Sie die Arbeit an Ihrer Geschichte genossen haben, können Sie jetzt den wiedererlangten Freiraum genießen, sich neuen Projekten widmen, oder erst einmal Urlaub machen, guten Gewissens, dass Sie nun ein Autor sind.
Die Theorie des Schreibens
Abschließend vertrete ich nicht die Auffassung, dass ein Prozess, wie das Kreative Schreiben, sich auf Doktrinen basieren lässt. Wenn Sie z. B. lieber Eckpfeiler Ihrer Geschichte festlegen möchten, um diese dann zu verbinden, so wie Viki King es in ihrer »Inner Movie Method« mit dem Sinnbild eines Lakens, das man nach und nach mit Wäscheklammern aufhängt, beschreibt, und Sie daraufhin in den Prozess des Rewrite gelangen, kann Sie dies auch an ihr Ziel führen, aber sie machen es sich deutlich schwerer. Daher empfehle ich Ihnen ebenfalls, sich mit so vielen theoretischen Ansätzen wie möglich zu beschäftigen, doch kann gleichermaßen aus Erfahrung schildern, dass dies auch darin resultieren kann, sich zu sehr mit dem theoretischen Aufbau einer Geschichte zu beschäftigen und zu versuchen nach einer Formel zu schreiben, was, meiner Ansicht nach, im Gegensatz zum kreativen Prozess steht, da es sich um eine Tätigkeit im geschlossenen Modus handelt. Doch wirkt sich die Kenntnis der Fertigkeit durchaus auf die Anzahl Ihrer Rewrites aus. Wenn Sie bereits die grobe Anatomie einer Geschichte im Allgemeinen verstehen, wird der erste Entwurf natürlich vielversprechender ausfallen. Aber schreiben Sie nicht nach der Anatomie, sondern spielen Sie, Sie können nichts falsch machen!
WENN Sie dann im Rewrite auf Probleme stoßen, hilft Ihnen die Kenntnis der Anatomie einer Geschichte, um mögliche Fehlerquellen ausfindig zu machen. Auf eben diese komme ich auch in späteren Kapiteln wieder zurück, da es jetzt in erster Linie darum geht, dass Sie Ihre Geschichte fertig schreiben. Im offenen Modus.
4. »Feedback & Kritik« oder »Die Achillesferse des Perfektionisten«
Man mag sich die Frage stellen, warum, quasi noch am Anfang des Schreibens, ausgerechnet dieser Thematik ein ganzes Kapitel gewidmet wird.
Schließlich bezieht sie sich doch eigentlich auf das Resultat des Schreibens und daher eher dem Ende des Prozesses. Doch umfasst dieses Thema gleichermaßen die Erwartungshaltung oder das Momentum Ihres Schreibens. Denn nichts blockt die Euphorie, sich erneut mit einer Idee auseinanderzusetzen, als schlechtes Feedback. Und die Schublade an verworfenen Ideen zeichnet sich nicht nur durch Werke aus, die von vornherein für eben diese bestimmt waren (und diese gibt es selbstverständlich), sondern eben auch durch Ansätze, die enormes Potenzial boten, doch bei denen der Autor zu früh nach Bestätigung suchte. Kurzum behandelt dieses Kapitel die Frage »Wann ist eine Idee reif für die Öffentlichkeit?«
Ein Drahtseilakt für jeden Autor. Zu früh und er offenbart sich seiner eigenen Ängste und Unsicherheiten, zumal er diese in Form von schlechtem Feedback bestätigt sieht, auch wenn er sie davor nicht zugeben wollte, oder hätte können. Zu spät und er läuft Gefahr sich in eine Idee zu verrennen und umso größer fällt der Niederschlag aus, wenn denn die Kritik zahlreich oder schlichtweg schlecht ausfällt.
Generell wird demgemäß des Öfteren dazu geraten, Ansätze bereits früh zu testen, um so Letzteres zu vermeiden. Ein Pitch ist daher nichts anderes, als die Vorstellung eines Projektes. Ebenso dient ein Kurz-Pitch in exzellenter Weise dazu, Schwächen in der eigenen Idee ausfindig zu machen. Dieser ist auch als Elevator Pitch bekannt, ein Begriff aus der amerikanischen Werbeindustrie, da man nun einmal nur die Zeit der Aufzugfahrt hatte, um einem Vorgesetzten, der sonst unerreichbar war, von einer Idee zu überzeugen, weil die Aufzugfahrt eine ansonsten ungenutzte Wartezeit darstellte und gleichermaßen eine gewisse Form von Intimität bot. Kurzum eine Gelegenheit, die es zu nutzen galt. Wenn ich nicht in der Lage bin, meine Idee innerhalb von 30 Sekunden auf den Punkt zu bringen und meinem Gegenüber verständlich zu machen, ist dies A ein Hinweis darauf, dass ich mir selber über meine Idee noch nicht im Klaren bin oder in manchen Fällen B ein Hinweis, dass mir die Fertigkeit der Präsentation fehlt, was gleichermaßen mit A zu tun haben kann oder Folge davon ist, dass ich schlichtweg nicht der Mensch bin, zu dessen Vorlieben es zählt, anderen eine Idee vorzustellen, dergestalt, dass ich ebenso einfach kein guter Verkäufer wäre. Gerade bei der eigenen Idee ergibt sich ein Zwiespalt zwischen dem nötigen Selbstvertrauen diese zu präsentieren und dem Selbstzweifel, der wichtig ist, um überhaupt eine herausragende Idee zu erschaffen. Denn wer nicht zweifelt, begnügt sich mit dem erstbesten Einfall, ergo dem Einfall, den jeder hat, Mittelmaß.
Um auch an dieser Stelle noch einmal, wie schon im vorherigen Kapitel, auf John Cleese zurückzugreifen, stellte dieser in einem weiteren Vortrag über Kreativität die These voran, dass, um zu wissen, dass man gut in etwas ist, dieselben Kenntnisse und Fertigkeiten erfordert werden, um in dieser Sache tatsächlich gut zu sein. Was im Gegenschluss bedeutet, dass, wenn man etwas absolut nicht kann, einem genau die Kenntnisse & Fertigkeiten fehlen, um dies zu erkennen, wodurch es uns dementsprechend schwerfällt, unsere eigenen Ideen & Konzepte einzuschätzen.
Also woher soll man denn nun wissen, ob etwas gut ist oder ob man etwas kann. Kritik & Feedback. Input von außen. Wir sind darauf angewiesen, ob es uns passt oder nicht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem es nicht nur uns nichts mehr bringt, sondern, und das ist das Wichtigere, auch unserer Geschichte, uns die Haare zu raufen und das Geschriebene bis ins kleinste Detail zu zerreißen, oder eben uns mit allen verfügbaren Mitteln, zu denen ich im nächsten Kapitel kommen werde, »einzureden«, dass unsere Geschichte, nicht nur wert ist, erzählt zu werden, sondern eine Bereicherung der Literatur darstellt. Ein Werk.
Ist jede Kritik gute Kritik?
Kritik ist ein zweischneidiges Schwert, dass zudem mit Stacheln versehen wurde. Denn welche Kritik ist tatsächlich gute Kritik?
Verfügt die Kritik-gebende Person über die Kenntnisse & Fertigkeiten, um die Kritik zu geben?
Bei einem Klempner, der einem Maurer Verbesserungsvorschläge für seine Mauer gibt, ist dies schlichtweg nicht der Fall. Nun hat aber auch der Klempner schon einmal in seinem Leben eine Mauer gesehen und ist durchaus in der Lage das Produkt des Maurers mit seiner Erfahrung zu vergleichen. Sie merken vielleicht jetzt bereits, wie komplex dieses Thema eigentlich ist, aber es geht noch weiter.
Um es noch einmal kurz zusammenzufassen, Kritik unterscheidet sich durch den Zeitpunkt, zu dem sie gegeben wird, durch die Qualifikation der Person, die sie gibt, die Konstruktivität, dergestalt, dass aufgrund dieser Kritik eine Verbesserung überhaupt möglich ist und selbstverständlich den Umgang mit dieser durch den Autor.
Nun ist es erkenntlich, warum bereits zu einem frühen Zeitpunkt über diese Thematik gesprochen wird, denn, wenn sie sich erinnern, erwähnte ich im ersten Kapitel, dass sie selbst nicht während des Schreibens lesen sollten, was Sie geschrieben haben. Eine Woche später sieht dies schon besser aus, ein paar Jahre später und Sie werden hoch qualifiziert sein, ihre eigenen Texte zu kritisieren, da dieser Zeitraum es ermöglicht, eine Objektivität zu erlangen, als würden Sie den Text einer fremden Person lesen, da Ihre Erinnerung an den Zeitpunkt des Schreibens so schwach geworden ist, dass Sie diese kaum noch sich selbst zuordnen können und sich selbst die Frage stellen »Wie kam ich darauf?«
Читать дальше