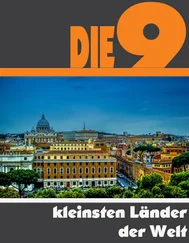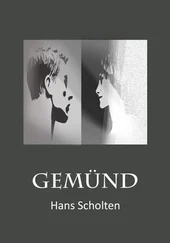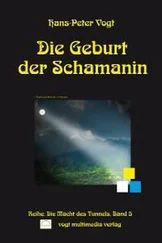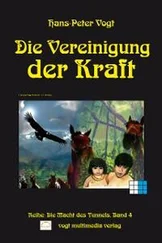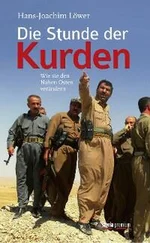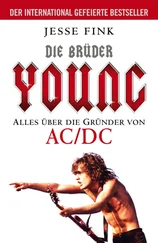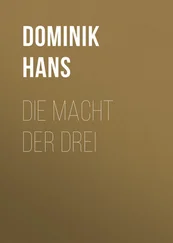Die ersten, die das beherzigten, waren die Päpste. Sie zogen die größten Architekten, Bildhauer, Maler der Zeit an ihren Hof. Rom wurde neben dem Florenz der Mediceer das geistige und künstlerische Zentrum Europas. Die Begleiterscheinungen waren Vetternwirtschaft, Zügellosigkeit und Sittenlosigkeit. Erst das Konzil von Trient setzte diesen Auswüchsen ein Ende. Aber: Es hatte eine Befreiung stattgefunden.
Einer der von Petrarcas Antikenfieber Angesteckten war der Florentiner Francesco Pioggio Braccolino. Wie Petraca wurde er zum Jäger antiker Schriften. Unter den vielen Skripten des römischen Altertums, die er entdeckte, war eines von ganz besonderer Bedeutung. Es war das Werk „De rerum natura“ des Titus Lukretius Carus, heute bekannt als Lukrez. Entdeckt hat Pioggio es in einem Kloster in Fulda im Jahre 1417.
Wegen der Faszination des Papiers sei sein Inhalt vorangestellt:
Alles auf dieser Welt ist aus Teilchen zusammengesetzt. Lukrez nennt sie Keime.
Die Teilchen sind ewig.
Die Teilchen sind unendlich an der Zahl, aber jedes einzelne Teil in Gestalt und Größe begrenzt.
Die Teilchen bewegen sich in unendlicher Leere. Das Universum hat keinen Schöpfer oder Designer.
Alle Dinge entstehen infolge geringer Abweichungen.
Die Natur experimentiert unaufhörlich.
Das Universum wurde weder wegen des Menschen noch für ihn geschaffen.
Der Mensch ist nicht der Pol, um den sich alles dreht.
Der Mensch ist nicht einzigartig.
Der Mensch hat begonnen mit dem Kampf um sein Überleben.
Die Seele ist sterblich.
Es gibt kein Leben nach dem Tod.
Alle Religionen sind organisierte Täuschungen.
Religionen sind allesamt grausam.
Es gibt keine Dämonen, Engel oder Geister.
Das höchste Ziel des Menschen ist die Vermeidung von Leiden.
Nicht Leid ist das größte Hindernis für ein angenehmes Leben, sondern Täuschung und Enttäuschung.
Das Verstehen der Dinge weckt großes Staunen.
Es kann Götter geben. Aber wenn sie denn wirklich Götter sind, leben sie in himmlischen Sphären unter sich und kümmern sich nicht um den Menschen.
So einfach und doch so viele Fragen. Das Buch „Über die Natur der Dinge“ ist siebentausendvierhundert Verse lang, enthält Betrachtungen über Religion, Freud, Leid und Tod, Theorien zur natürlichen Welt, zur menschlichen Gesellschaft. Es stellt ein großes Werk der Philosophie und der Dichtung dar.
Ihr Verfasser Lukrez lebte von 97 bis 55 v. Chr.. in Italien, eine kurze Lebensspanne von 42 Jahren. Dann verfiel er dem Wahnsinn.
Der Entdecker seines Werkes Pioggio wurde 1380 in Arezzo geboren, er starb 1459 in Florenz. Er sah sich als führenden Humanisten, war von 1453 bis 1458 Kanzler von Florenz, Verfasser moralphilosophischer Traktate in lateinischer Sprache. Aber sein wirkungsmächtigstes Werk war ohne Zweifel die Wiederentdeckung von Lukrez' Werk „De rerum natura“.
1415 verlor er auf dem Konzil zu Konstanz seinen Posten als Berater des Papstes Johannes XXIII., nachdem dieser, aus dem Seeräubergeschlecht Gossa stammend, als Kirchenoberhaupt abgewählt und mit Schimpf und Schande fortgejagt worden war. Aber der nun arbeitslose Pioggio besaß Gönner, die ihm finanziell ermöglichten, seine berufliche Freistellung dazu zu nutzen, in den Bibliotheken von Klöstern nördlich der Alpen nach antiken Schriften zu fahnden.
Die Mönche in Fulda weigerten sich, das von Pioggio entdeckte Werk des Lukrez herauszugeben. Pioggio musste einen deutschen Kalligraphen finden, der es für ihn abschrieb. Das abgeschriebene Werk schickte er an einen Freund, den Florentiner Nicolo Nicoli, der es ein weiteres Mal abschrieb. Die beiden Abschriften waren Grundlage weiterer Abschriften, von denen etwa 50 bis heute erhalten sind. Nach Erfindung der Buchdruckerkunst 1444 verbreitete sich das Werk schnell in ganz Europa.
Die Kirche verbot es zunächst nicht. Seine Brisanz wurde nicht erkannt. Das Werk wurde als großartige Dichtung wahrgenommen, deren Inhalt fremdartig oder kurios erschien, für keinen vernünftigen Christen akzeptabel. Der Verfasser sei dem Wahnsinn verfallen gewesen, verbreitete sie. Aber das Werk weckte in philosophischen, schriftstellerischen Kreisen, unter Mathematikern und Physikern Interesse und wurde diskutiert.
1419 nahm Pioggio eine Stelle beim Bischof von Winchester, Henry Beaufort, an. Dieser hatte die englische Delegation auf dem Konzil von Konstanz geleitet. Dort hatte er Pioggio kennengelernt.
Auch in England machte sich Pioggio auf die Suche nach antiken Schriften, wurde aber nicht fündig. Nach vier Jahren kehrte er zurück auf den Kontinent, um dort weiter solchen Schriften hinterherzujagen. Mit Erfolg. Als er 1459 starb, galt er als der erfolgreichste Sammler antiker Schriften.
Der Mann, der durch eine Milleniumserfindung die Grundlage dafür schuf, dass die neuen Ideen schnell verbreitet wurden, stand zum Glück derjenigen, die diese Ideen hatten, am Anfang der Entwicklung: Johannes Gutenberg. Er erfand den Buchdruck. „Da durch die von ihm erfundene Druckerpresse die Verbreitung von Wissen und Ideen über die gesamte Welt möglich geworden ist, platzieren wir ihn vor alle anderen Persönlichkeiten, deren Wirkung erst durch die Druckerpresse möglich wurde.“ So schrieben Agnes Hooper Gottlieb, Henry Gottlieb, Barbara und Brent Bowers in ihrem Werk: „1000 years, 1000 people. Ranking the men and woman who shaped the millenium“, New York, Tokio, London 1999. Ohne den Buchdruck ist die Entwicklung der Zivilisation nicht denkbar.
Über sein Leben vor Erfindung der Druckerpresse gibt es wenig Zeugnisse. Einem Papier aus dem Jahre 1430 entnehmen wir, dass dem 1428 aus Mainz verbannten Gutenberg die Rückkehr nach Mainz gestattet wird. Auf den 14. März 1434 ist eine Urkunde datiert, die seinen Aufenthalt in Straßburg belegt. Aus dem Jahre 1439 liegen Gerichtsakten vor, aus denen sich ergibt, dass Gutenberg Kaufmann, einfallsreicher Erfinder und Meister im Handwerk ist, an den sich junge Männer wenden, um „etlich kunst“ zu erlernen. Er erteilt ihnen Lehre im Polieren von Edelsteinen, im Münz- und Goldschmiedehandwerk. Er stellt Wallfahrtszettel für eine Heiltumsfahrt nach Aachen her. Mit den Prozessbeteiligten Dritzehn, Andreas Heilmann und Hans Riffe hatte er eine Gesellschaft gegründet, deren Zweck es ist, dass Gutenberg „alle sind künste und afentur, so er fübasser oder in ander Wege mehr erkunde und wusste“, in die Gesellschaft einbringen soll. „Künste und afentur“ sind nach damaligem Sprachgebrauch Fachbegriffe für handwerkliches Können und wagemutige kaufmännische Unternehmungen. Aus den Gerichtsakten ergeben sich Hinweise auf eine hölzerne Presse, den Einkauf von Blei, die Bereitstellung von Formen, die eingeschmolzen wurden. Ein Hans Dünne sagte aus, dass er den Auftrag erhielt, für 100 Gulden alles zu fertigen, „dass zu dem trucken gehöret“. Der Gesellschafter Andreas Heilmann besaß vor den Toren Straßburgs eine Papiermühle, so erfahren wir.
1448 wird Gutenberg wieder in Mainz nachgewiesen. Am 17. Oktober 1448 leiht er sich bei seinem Vetter Arnold Gelthus 150 Gulden, offensichtlich, um seine Idee des Buchdrucks verwirklichen zu können. 1450 ist es so weit. Er druckte die ersten Seiten. Er beginnt mit Ablassbriefen, Kalendern und Wörterbüchern. Spätestens 1456 wird die erste Bibel gedruckt. In zwei Exemplaren der 88 Bibeln der ersten Auflage, die erhalten sind, aufbewahrt in der Bibliotheque National in Paris, ist ein Vermerk auf den jeweils letzten Seiten enthalten, dass ein Heinrich Cremer, Kleriker am Kollegialstift St. Stephan in Mainz, die Exemplare am 15. und 24. August 1456 gebunden hat.
Die Wissenschaft hat festgestellt, dass im Verlauf der Setzarbeiten der insgesamt 180 Bibeln sechs verschiedene Setzer beschäftigt waren. Die Druckzeit hat etwa zwei Jahre gedauert. Mit der neuen Technik konnten in dieser Zeit 180 Bibeln, großformatig wie ein Messbuch, hergestellt werden. Bis dahin erforderte das Abschreiben einer Bibel mit der Hand drei Jahre.
Читать дальше