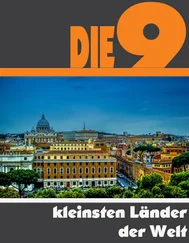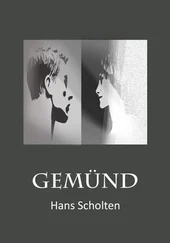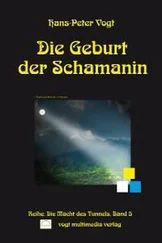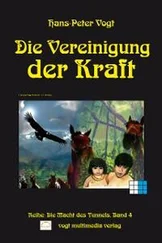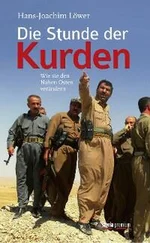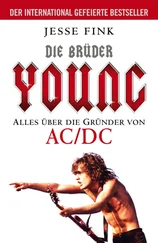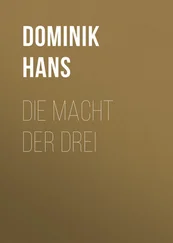Zur Zeit von Luthers Aktivitäten sollten noch zwei andere das Bild der Welt verändern, ein Astronom und ein Arzt, Nikolaus Kopernikus und Andreas Vesalius. Der Astronom erforschte die Tiefen des Kosmos, der Arzt das Innere des Menschen, bis dahin ein ebenso unerforschter Kosmos.
Der Arzt begann zu sezieren und den menschlichen Körper bis ins letzte Detail zu erkunden. Bis dahin orientierte sich die Medizin an den Werken des Griechen Galenos aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, der sein Wissen aus der Sektion von Katzen, Hunden und Schweinen bezog und aus diesen Erkenntnissen auf den Menschen schloss, ohne in diesen hineingesehen zu haben.
Der Astronom Kopernikus aus dem ostpreußischen Frauenburg fand heraus, dass sich alle Ungereimtheiten der Berechnung der Planetenbewegungen von selbst lösen, wenn man annimmt, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt der Planetenbewegungen steht. Bis dahin wurde angenommen, dass die Erde sich im Mittelpunkt befindet.
Kopernikus wurde nicht von der Inquisition verfolgt, aber nur, weil sie wohl nichts von seinen für die Kirche gefährlichen Erkenntnissen wusste. Dann wäre die Überstellung seiner Person nach Rom wohl die unweigerliche Folge gewesen.
Dieses Schicksal ereilte den Dominikanermönch Giordano Bruno. Er hatte den von Pioggio Braccolino wiederentdeckten römischen Dichter Lukrez gelesen und war Verfechter seiner Idee geworden, dass es im Weltall ungezählte Sonnen gebe, die vom Zufall regiert sich bewegten. Er verbreitete sie, durch Europa wandernd, in nahezu allen Ländern. In Venedig ereilte ihn das Schicksal. Er wurde festgenommen und an den Vatikan ausgeliefert. Die Inquisition machte ihm einen fast zehn Jahre dauernden Prozess und ließ ihn, da er seinen Lehren nicht abschwor, verbrennen.
Einer, der sich ebenfalls zu weit vorwagte, war Galileo Galilei. Er vertrat in Florenz, wo er wirkte und in Rom, wo er sich gelegentlich aufhielt, in höchsten Kreisen die These von Nicolaus Kopernikus, dass die Erde um die Sonne kreist. Schließlich wurde es dem Papst, in dessen Gunst er sich wähnte, zu arg. Er ließ ihn durch die Inquisition von Florenz nach Rom beordern, wo ihm der Prozess gemacht wurde, an dessen Ende er vor die Wahl gestellt wurde, zu widerrufen oder den Scheiterhaufen zu besteigen. Wider besseres Wissen schwor er ab. Galilei sollte der letzte sein, der in dieser Weise bedroht wurde.
Die ihm folgenden großen Physiker, Mathematiker und Erfinder wie Huygens, Leibniz, Boyle, Hooke und Newton lebten ohne Verfolgung durch die Kirche, jedoch wohl nur, weil sie in protestantischen Ländern oder im anglikanischem England tätig waren. Auch der im katholischen Frankreich geborene Renè Descartes konnte seine Schriften ohne Einschränkung verbreiten, aber wohl nur, weil er in das zum reformatorischen Glauben übergetretene Holland umgesiedelt war. Einer, der nicht um Leib und Leben fürchten musste, aber sich um sein Ansehen und seinen Platz in der englischen Gesellschaft Sorgen machte, war Charles Darwin. Er fürchtete sich vor der Anglikanischen Kirche und vor Verspottung durch die Fachwelt. Er zögerte zwanzig Jahre lang, seine Erkenntnis zu veröffentlichen, dass sich die Natur durch Evolution entwickle.
Heute braucht kaum ein Wissenschaftler Furcht vor Religionen oder gesellschaftlicher Ächtung zu haben. Die Wissenschaft feiert ihren Siegeszug nun schon unangefochten seit mehr als hundert Jahren.
Derjenige, der den Reigen der großen Denker, Forscher, Künstler, Religionserneuerer eröffnete, war der Dominikanermönch Albert von Köln, später Albertus Magnus genannt. Er machte die Werke der Philosophen des alten Griechenland, angeführt von Platon und Aristoteles, zum Thema der Theologen seiner Zeit, des 13. Jahrhunderts. Die Werke hatten sich in den Bibliotheken des arabischen Andalusien im Süden Spaniens, vor allem in der Stadt Cordoba, erhalten. Französische Gelehrte hatten sie dort entdeckt und sich in Paris daran gemacht, sie zu übersetzen. Der junge Albert wurde bei einem Studienaufenthalt auf die Arbeit der Franzosen aufmerksam, begeisterte sich für die griechische Philosophie, insbesondere Aristoteles und begann seinerseits ein philosophisches Werk darauf zu gründen. Der Papst hatte die Werke der Griechen zwar auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, aber hinzugefügt, dass die Wissenschaft aufgefordert sei, die Werke fleißig von Irrtümern zu befreien, die von den Arabern hineingebracht worden seien.
Albertus zögerte nicht, der Aufforderung zu folgen. Er sollte derjenige werden, der die Kirche von einer „Augustinischen“ in eine „Aristotelische Kirche“ umwandelte. Er stellte dem erdrückenden Werk des Aristoteles ein ebenso gewaltiges eigenes Werk mit aristotelischen Gedanken zur Seite, unterstützt von seinem Schüler in Köln, dem Dominikanermönch Thomas von Aquin, der sich an Größe von seinem Lehrer nur dadurch unterschied, dass Albertus zugleich ein, für die damalige Zeit vielleicht der größte, Naturforscher war. Die Kirche hatte dem Gedenkengebäude von Albertus Magnus nichts entgegenzusetzen. Sie sprach ihn und auch Thomas von Aquin heilig. Der Papst ahnte nicht, dass mit seiner Aufforderung, die Texte der Griechen fleißig von Irrtümern zu beseitigen, verbunden mit der Heiligsprechung von Albertus Magnus und Thomas von Aquin, die wissenschaftlich interessierten Zeitgenossen sich frei fühlten, ebenfalls die wissenschaftlichen Werke der alten Griechen wie Euklid, Pythagoras, Archimedes zu studieren. Der zuerst mit naturwissenschaftlichen Werken an die Öffentlichkeit trat, war wiederum Albertus Magnus, allerdings mit biologischen Untersuchungen, die aber auf wissenschaftlichen Prinzipien beruhten, wie sie die Griechen des Altertums entwickelt hatten. Biologische Studien entsprachen seinem Naturell und seinem Lebenslauf.
In Lauingen an der Donau als Albert von Bollstädt geboren, hatte er alles andere im Kopf, aber nicht, einmal Mönch zu werden. Nach allem, was wir wissen, war sein Vater Verwalter einer kaiserlichen „Hofstatt“. Dort wuchs er zwischen Knechten, Mägden, Pferden, Hunden, Kühen und Schafen auf. Und Falken, die er abzurichten verstand; sein Vater war wohl Jäger. Einer später von ihm verfassten Schrift „Von Pferden, Hunden und Falken“ entnehmen wir, dass er diese Tiere besonders mochte und sich in ihrem Verhalten auskannte. Wir wissen weiter, dass er eine Klosterschule in der Nähe besuchte und bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr in der Welt umherwanderte. Er interessierte sich für Gesteins- und Gebirgsarten. In Venedig sah er dem Zersägen von Marmorblöcken zu, bestaunte die dabei zu Tage tretenden Strukturen und farblichen Unterschiede. Er sprach von „Stein gewordenen Dämpfen“, von „Spuren der Schöpfungszeit“.
In Padua besuchte er einen Onkel, der königlicher Beamter war. Dieser nahm ihn für längere Zeit auf und sorgte dafür, dass er an der dort gerade gegründeten Universität das Studium der Rechtswissenschaft aufnahm. Über einen förmlichen Abschluss dieses Studiums wissen wir nichts.
In Padua, er war bereits im 35. Lebensjahr, hatte er eine Begegnung mit dem Ordensmeister der Dominiker, Jordanus von Sachsen. Dieser gewann ihn für den Dominikaner-Orden und schickte ihn nach Köln in die größte deutsche Stadt, um dort diesen in den Anfängen steckenden Orden zu stärken. Vier Jahre später finden wir ihn als Lektor an der dortigen Priesterschule, in den folgenden Jahren auch in Hildesheim, Freiburg und Straßburg.
1242 schickte ihn der Ordensmeister als Lektor zur Universität in Paris.
Albertus Magnus stürzte sich in die Lektüre des aristotelischen Riesenwerkes. Er tat es mit solcher Konsequenz, dass er alsbald nicht nur in der theologischen, sondern auch in der philosophischen Fakultät uneingeschränkte Autorität genoss. In wenigen Jahren wuchs er zu einer wissenschaftlichen Größe heran, die alle Gelehrten in Paris, ja des ganzen Abendlandes überragte. Nach und nach legte er das ganze System aristotelischer Philosophie der wissenschaftlichen Welt zu Füßen. Auch begann er eine Synthese der aristotelischen Philosophie und der christlichen Theologie zu erarbeiten.
Читать дальше