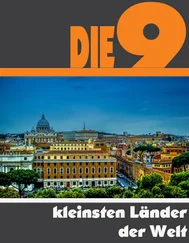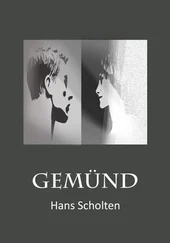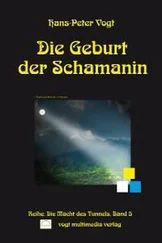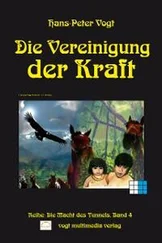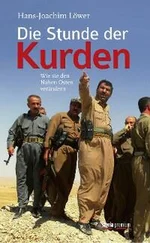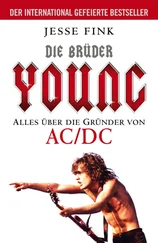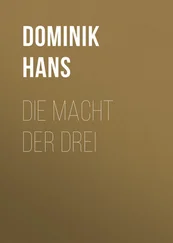Die Abneigung Petrarcas gegen die Ärzte rührte wohl daher: Der Arztberuf war kein angesehener Beruf; er wurde meistens von Badern ausgeübt, das waren Leute, die ein Bad betrieben und Zähne zogen. Petrarca, von seiner Größe überzeugt wie kaum ein anderer seiner Zeit, wollte wohl mit solchen Leuten nichts zu tun haben; Krankheiten begegnete man mit Gebet. Dass er dabei in die Schuhe der von ihm gehassten Scholastiker schlüpfte, die das Gleiche lehrten, dürfte ihm, der sich fast ständig im Zustand der Nabelschau befand, entgangen sein.
Sein Groll könnte aber auch Ausdruck des tiefen Schmerzes darüber gewesen sein, dass Rom, nachdem es nicht mehr Hauptstadt eines Imperiums war, nun auch den Papstsitz hatte an das französische Avignon abgeben müssen, und nicht nur das: Der Hauptsitz der Wissenschaft war Paris geworden, die Macht an das Heilige Römische Reich übergegangen. Diese „translatio“ empfand er als Ausdruck geschichtlicher Unrechtmäßigkeit.
Petrarca wurde im toskanischen Arezzo als Sohn eines Notars geboren. Sein Vater war, wie der mit ihm befreundete Dichter Dante Allighieri, verwickelt in florentinische Kabalen und 1302 aus der Stadt gewiesen worden. Er siedelte in das französische Avignon über, in dem der Papst regierte; ein Notar hatte dort gute Aussichten.
1316, Francesco Petrarca war 12 Jahre alt, schickte sein Vater ihn zum Studium der Rechtswissenschaft zur Universität im französischen Montpellier. Von dort wechselte er 1320 an die Universität Bologna. Als 1326 sein Vater starb, brach er das Jura-Studium ab und widmete sich ausschließlich der lateinischen Literatur. Sein Vater hatte ihm bedeutende finanzielle Mittel hinterlassen, sodass sein Lebensunterhalt vorerst gesichert war.
Die Leidenschaft an lateinischer Literatur hatte sich bei Petrarca schon während seines Jura-Studiums entwickelt. In Montpellier gehörte das Studium der lateinischen Schriftsteller Aesop, Livius und Cicero zu seinem Studienplan. Er las dort die Hauptwerke Vergils, die „Georgica“ und die „Bucolica“.
Petrarca war ein Mann, der die Einsamkeit liebte, weil nur die Stille ihm den Genuss an den Lateinstudien gewährte, den er sich wünschte und regelmäßig erlangte. Aber er war auch ein Mann der Selbstdarstellung und -inszenierung. Avignon war durchaus ein geeignetes Pflaster für diese Neigung. Am Sitz des Papstes trafen sich Diplomaten, Geistliche, Philosophen, Wissenschaftler aus aller Welt; dort verkehrte die geistige Elite. Petrarca stürzte sich in die Szene. In Briefen aus späteren Jahren an seinen Bruder pflegte er von diesen Jahren zu schwärmen, in denen man miteinander um die prachtvollste Kleidung wetteiferte, um das schönste Gesicht mit und ohne Bart.
In den Zeitabschnitten der Stille, die er trotz des ansonsten aufregenden Lebens zu gewinnen wusste, entstand sein erstes großes Werk, die erste Rekonstruktion von Livius' „Ab urbe condita libri“ in klassischer lateinischer Sprache. Bis dahin lag sie nur in der Sprache von mittelalterlichem Gebrauchslatein vor.
Schon als die Familie Petrarca noch in Arezzo weilte, war Giacomo Colonna, der zweitgeborene Sohn der mächtigen römischen Adelsfamilie Colonna, mit der sein Vater befreundet war, auf den drei Jahre jüngeren Francesco Petrarca aufmerksam geworden. Als Giacomo Colonna mit 29 Jahren zum Bischof von Lombez in Südfrankreich ernannt wurde, nahm er Petrarca mit. Dieser, auf kirchliche Pfründe bedacht, empfing die niederen Weihen und wurde zum „capellanus continuus“ an Giacomos Bruder Giovanni Colonna weitergereicht, der am Hofe des Papstes in Avignon residierte. Seine Existenz war nun nicht seinem Selbstwertgefühl entsprechend, aber doch ausreichend abgesichert. Später sollten einige Kanonikate an verschiedenen Orten hinzukommen, die ein Leben entsprechend seinen Ansprüchen ermöglichten.
Giovanni ließ seinem Capellan ausreichend Zeit für Bildungsreisen. Seine erste Reise führte ihn in den Norden, nach Paris, dem Ort der von ihm als ungerecht empfundenen „translatio studii“. Er hielt sich hier nur kurz auf, reiste alsbald weiter nach Lüttich. Der unermüdliche Sucher nach antikem Schriftgut entdeckte hier in der Bibliothek eines Klosters Ciceros Werk „Pro Archaia“ und dessen Rede „Ad equites romanos“. Weiter ging seine Reise nach Köln, über das seine Worte des Lobes voll waren. Besonders gefielen ihm die vielen schönen waschenden Mädchen am Rhein, die vielen großen romanischen Kirchen und vor allem das schon fertiggestellte Ostchor des Domes, dessen gotische Architektur den die Antike Verehrenden wohl mehr erstaunt als entzückt haben dürfte.
Eine zweite Reise führte nach Rom. Die Streitigkeiten unter den Adelsfamilien waren so groß, dass er die Stadt nur in Begleitung einer bewaffneten Eskorte eines Schwagers seines Gönners Giacomo Colonna erreichen konnte. Er ist von den Ruinen, den Zeugen vergangener imperialer Größe, ergriffen und berichtet darüber in einem öffentlichen Brief. Die Ruinen werden ihm zu einer Erfahrung der Überlieferung, die zu bewältigen der geschichtlichen Erinnerung aufgetragen sei, die aber ihrerseits ganz vom Interesse und dem Vermögen des Wanderers abhängig sei. Der Brief gilt als literarisches Meisterwerk.
Zurück am Hofe von Giovanni Colonna in Avignon stürzte er sich wieder in seine liegen gebliebene literarische Arbeit. Es entstehen seine wichtigsten Werke: „De viris illustribus“, „Rerum morandum libri“, „Epistole metrice“, „De vita soloria“, „De otio religioso“, das „Secretum“ sowie zahlreiche Liebesgedichte, die „Rerum vulgaria fragmenta“. Es waren seine literarisch fruchtbarsten Jahre.
Petrarcas überbordendem Selbststilisierungsbedürfnis mochte der Gedanke entstammen, dass die Zeit reif sei, zum Dichterkönig gekrönt zu werden. Es sei sein Wunsch von Jugend an gewesen, bekannte er später. Es sollte eine Dichterkrönung nach antikem Vorbild werden, wie er sie bei Statius gelesen hatte.
37 Jahre alt, betrieb er die Krönung mit Plan. Der König von Neapel, Robert von Anjou, musste für das Vorhaben gewonnen werden. Der ihm in Avignon zum Freund gewordene Augustinermönch da Bargo arbeitete nun am Hof in Neapel. Ihn bat er, dem König das Projekt schmackhaft zu machen. Die Prozedur sollte eine für den König einfache sein. Der hochgebildete Monarch sollte Petrarca drei Tage lang examinieren, das heißt, im Garten seines Palastes mit ihm umhergehen, sich mit ihm unterhalten und, so wie es genehm war, Gedichte vortragen lassen. Selbstverständlich waren die drei Tage reine Formsache; so viel Zeit für eine Nebensache hat ein König nicht. Aber eine dreitägige Prüfung durch einen sachkundigen König statt durch ein Gremium von Dichtern, eine Wahl nach Prüfung durch einen König war einem Dichter vom Kaliber Petrarcas angemessen; er hatte sich noch nie gering eingeschätzt. Dass es keine Konkurrenz gab, spielte überhaupt keine Rolle.
Nach der Prüfung sollte die Verleihung des Lorbeers erfolgen. Petrarca bestand darauf, dass diese Zeremonie auf dem Kapitol in Rom erfolge. Die Zustimmung des römischen Senats wurde als sicher vorausgesetzt, da mit der Unterstützung des Colonna-Clans zu rechnen sei. Die Prozedur lief planmäßig ab. Petrarca reiste nach Neapel, besuchte König Robert, nicht ohne nachher dessen Kenntnis von Literatur und Dichtung zu loben. Der Senator Orso del l'Aguillara, ein Verwandter der Colonna, setzte ihm auf dem Kapitol in Rom den Lorbeer aufs Haupt. Anschließend begab sich Petrarca zur Peterskirche, um den Lorbeer auf dem Altar der Hauptkirche der Christenheit niederzulegen.
Die Farce war nicht nur dem Bedürfnis Petrarcas nach Bestätigung seiner Dichtkunst angemessen, sondern diente auch seiner Existenzsicherung. Er wurde zum römischen Bürger ernannt, erhielt den Magistertitel, wurde mit den Professoren der Artistenfakultät gleichgestellt. Er war fortan, wo immer er sich aufhielt, Gast in höchsten Adelskreisen. Sein Ruhm war in ungeahnte Höhen gestiegen. Wie wichtig, aber auch wie gefährlich dieser Ruhm war, sollte sich bald erweisen.
Читать дальше