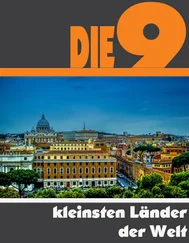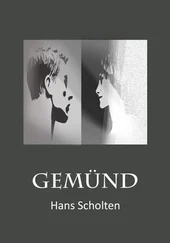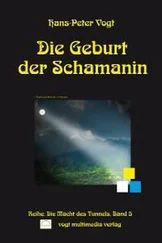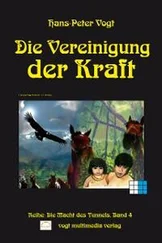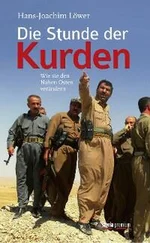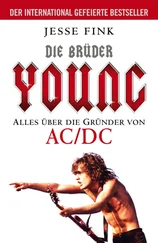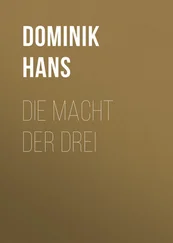In Rom zeichnete sich 1342 eine Entwicklung ab, die es möglich erscheinen ließ, die Träume Petrarcas von der Wiederherstellung römischer Vorherrschaft Wirklichkeit werden zu lassen. Ein junger Jurist, Cola di Rienzo, war dort mit Geschick an die Macht gekommen. Er hatte die nichtadeligen Gruppen der Stadt hinter sich versammelt. Als der alteingesessene Adel, gewohnt die Stadt zu regieren, eine Delegation zum neuen Papst in Avignon sandte, um von ihm als Bischof und Herrn von Rom die Bestätigung seiner angestammten Vorrechte zu erlangen, ließ sich Cola di Rienzo von den nichtadeligen Gruppen gleichfalls nach Avignon entsenden, um dem Papst mitzuteilen, dass der Anspruch des Adels bestritten werde. Der Papst nahm es zur Kenntnis, bestätigte aber den Adel in seinen Rechten.
Jedoch: Er ernannte Cola di Rienzo zum kapitolinischen Notar. Dessen Aufgabe war es, alle amtlichen Schriftstücke, deren wichtigste die Senatsprotokolle waren, von Staatswegen zu bestätigen. Der Papst unterwarf auf diese Weise die Tätigkeit des regierenden Adels der Kontrolle der nichtadeligen Gruppen. Dem Papst waren die Machenschaften des Adels offensichtlich suspekt.
Cola di Rienzo war diese Aufgabe nicht genug. Er arbeitete daran, die „lex de imperio“ wiederherzustellen, die Verfassung des antiken römischen Reiches, die eine gemeinsame Macht des Senates und des Volkes von Rom sowie Volkstribune vorsah.
Am 20. Mai 1347, als ein Heer des Adels unter Führung von Stefano Collonna vor den Toren der Stadt lagerte, versammelte Rienzo das Volk von Rom auf dem Kapitol, um die neue Verfassung bestätigen zu lassen. Der Coup gelang: Die Verfassung wurde per Akklamation gebilligt, Cola di Rienzo wurde zum Volkstribun gewählt und die Herrschaft über die Stadt übertragen. Der anwesende päpstliche Vikar stimmte zu. Dem überrumpelten Adel fiel nichts anderes ein, als ebenfalls zuzustimmen. Cola di Rienzo begann sofort umfangreiche Reformen durchzuführen. Sie betrafen die Justiz, die Finanzverwaltung, die öffentliche Ordnung und die Heeresverwaltung.
Petrarca, von dieser Entwicklung in Kenntnis gesetzt, war berauscht. Er richtete einen begeisterten Aufruf an Cola di Rienzo und das Volk von Rom. Er bezeichnete Rienzo als einen Erneuerer der Sitten und Retter des Volkes, der das Staatswesen von seinen Unterdrückern befreit habe. Adelsfamilien, mehrere wurden wörtlich genannt, darunter die Colonna, wurden als unrömische Barbaren, als Quell aller Missstände und allen Unfriedens tituliert. Er rief das Volk auf, sich hinter Cola di Rienzo zu stellen; dann werde Rom gesunden und ein vereinigtes Italien unter Führung Roms entstehen.
Petrarca, auch bei dieser Gelegenheit auf seinen Ruhm bedacht, stellte für den Fall des Gelingens des Projektes Rienzo di Cola selbstbewusst eine Verewigung in seiner Dichtung in Aussicht.
1347 lud Rienzo Gesandte italienischer Städte nach Rom ein, um den Plan einer Einigung Italiens zu besprechen. Gleichzeitig ließ er sich auf dem Platz vor der Kirche Santa Maria Maggiore zum „Tribunus Augustus“ ernennen.
Das ging dem Papst zu weit; er fürchtete um die Herrschaft über den Kirchenbesitz. Wer sich als Tribun des Namens „Augustus“ bemächtigte, des größten römischen Caesaren nach Caesar, erhob Anspruch, nicht nur über Rom, sondern über ganz Italien zu herrschen und damit selbstverständlich auch über den in der Mitte Italiens liegenden Kirchenstaat. Außerdem hatte der König von Ungarn Erbschaftsansprüche auf das Königreich Neapel angemeldet und drohte, mit einem Heer nach Italien und durch den Kirchenstaat zu marschieren. Der Papst monierte die Erhebung Cola di Rienzos zum Tribunus Augustus. Er entsandte einen Legaten nach Rom, der von Rienzo forderte, die Entscheidung rückgängig zu machen. Doch der widersetzte sich.
Der Adel sah seine Stunde als gekommen an. Er rüstete ein Heer gegen Rienzo, der sich in die Stadt zurückgezogen hatte. Vor der Porta San Lorenzo kam es zur Schlacht. Der Adel erlitt eine bittere Niederlage. Mehrere Colonna verloren ihr Leben.
Doch Rienzo gewann trotz des Sieges nicht die Unterstützung des Papstes zurück. Die Folge war, dass auch die Städte und Fürsten Italiens außerhalb des Kirchenstaates ihm die Gefolgschaft kündigten. Rienzo verfiel in Endzeitstimmung und dankte ab.
Für Petrarca bedeutete die enthusiastische Unterstützung Rienzos das Ende seiner Beziehung zu Giovanni Colonna. Petrarca kündigte dem Kardinal seinen Dienst. Er teilte ihm mit, er müsse nach Italien zurück. In Stunden der Not müsse er Rom beistehen. Er ging jedoch nicht nach Rom, sondern zunächst nach Mailand, dann nach Venedig und landete schließlich in Arquà bei Padua.
„Ich bemühe mich in jeder Hinsicht darum, dass sich nichts mit meinen wichtigen Angelegenheiten überkreuzt, abgesehen von den Bedürfnissen meiner herrischen Natur, das heißt: Schlafen, Essen, eine kurze bescheidene Erholung, die dazu dient, den Körper zu stärken und den Geist zu erfrischen. Bei der Zeitknappheit folge ich Augustus und pflege, während ich mich kämme oder rasiere, zu lesen oder zu schreiben. Manchmal jedoch rebelliert der Geist, meutern die Augen, die mir einstmals in meiner Eitelkeit gefallen haben. Wenn ich mich dann vom häufigen Nachtwachen angestrengt und mit schwarzen Ringen unter den Augen im Spiegel betrachte, wundere ich mich, und frage mich, ob ich das bin.“
Petrarca hatte das 68ste Lebensjahr erreicht und lebte in einem Landhaus in Arquà bei Padua. Er hatte eine Zeitlang in Mailand gewohnt, wo er für den Herrscher der Stadt, den Erzbischof Giovanni Visconti, einige diplomatische Missionen erledigte. Eine solche führte ihn nach Paris zum französischen König, eine andere nach Prag zum Kaiser, wieder eine andere zum Dogen von Venedig. Bei dieser Gelegenheit hatte er ein Abkommen getroffen, dass dem Dom von San Marco die Sammlung seiner Bücher und sein Schatz antiker Schriften vermacht werden sollte. In die Nähe des vor den Toren Venedigs liegenden Padua hatte es ihn verschlagen, weil er sich wegen einer Krankheit in die Behandlung von Ärzten der dortigen Universität begeben musste, zu denen er Vertrauen gefasst hatte. Ein weiterer Grund war, dass zwischen Padua und Arquà der Ort Abano lag, dessen Bäder er gern besuchte. Bei ihm im Haus lebte seine älteste Tochter mit ihrer Familie, er fühlte sich behütet und dem Alter entsprechend wohl. Trotz wegen Krankheit erzwungener Kontaktaufnahme zu Ärzten und Vertrauen zu den ihn behandelnden Ärzten hielt er von diesem Berufsstand immer noch nichts:
„Sie wissen, wie viel Haare der Löwe auf dem Kopf, wie viel Federn der Falke am Schwanz hat. Wenn es dann schließlich wahr wäre, trüge es nichts zu einem glücklichen Leben bei.“
Zu der vielfältigen dichterischen Arbeit, der er sich auch jetzt noch den ganzen Tag widmet, gehört auch die Überarbeitung seiner zahllosen Gedichte, insbesondere auch jene an die Adresse einer Dame namens Laura, die seine Liebe nicht erwiderte, an die er aber bis zu ihrem Tod 263 und nach ihrem Tod 102 Canzonette schrieb. Da es immer eine Laura war, an die er seine hoffnungslosen Liebeshymnen richtete, eine imaginäre Person, die niemand kannte, ging das Gerücht, es gäbe sie gar nicht. Gleich ob es sie gab oder nicht, es waren ergreifende Gedichte, die stilprägend für folgende Jahrhunderte und für die Etablierung des Humanismus wurden. Hier zwei Beispiele:
Gepriesen sei der Tag, der Mond, das Jahr,
die Jahreszeit, der Augenblick,
das schöne Land, der Ort, da mein Geschick
sich unterwarf ein schönes Augenpaar.
Gepriesen sei die erste süße Qual,
die Strahlen ihrer Blicke, die mich bezwangen,
die Pfeile Amors, die mein Herz durchdrangen,
die Herzenswunden, tief ohne Zahl.
Gepriesen seien die Stimmen, die im Leeren
verhallen, nach ihr rufend, dort und hier
das Seufzen, Weinen, Bitten und Begehren.
Читать дальше