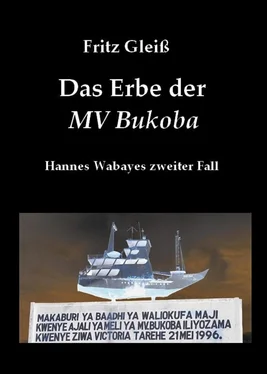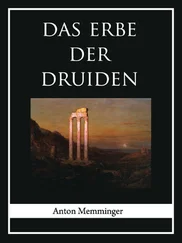„Okay, einverstanden, 300.000 pro Tag. – Sorry, wenn ich handeln musste, aber sonst wird das Unternehmen unbezahlbar.“
„Mit wie vielen Tagen rechnen sie denn ungefähr?“
„Habe mir zwei Wochen frei genommen, das muss reichen. – Dass ich an Bord der Bukoba Diamanten vermute und die fixe Idee habe, danach zu tauchen, wissen sie ja. Ob ich das wirklich mache, weiß ich noch nicht. – Dass daran am Ende überhaupt etwas zu verdienen ist, ist eher unwahrscheinlich. Das ist auch nicht der Hauptgrund meiner plötzlichen Reise. Haben Sie sich vielleicht schon gedacht. Noch ein Bier?“ Ohne meine Antwort abzuwarten, ordert Petermann beim Barkeeper zwei weitere Halbliterflaschen Safari. Im Foyer des Hotels plärrt mittlerweile immer lauter das Radio mit Hip Hop einer diese modernen Urban Music Gruppen. Bald werden wir schreien müssen, um uns zu verstehen.
„Danke. Machen Sie es nicht so spannend, Jens ...“
„Sorry, ich muss kurz pinkeln.“
Wazungu können so schamlos offen sein! Als der Deutsche von der Toilette zurück ist, will er jedoch noch immer nicht recht raus mit der Sprache. „Gibt es hier in der Gegend überhaupt Diamanten?“, fragt er mich stattdessen.
„Klar, seit Jahrzehnten pflügen wazungu den Boden in Mwadui um. Williamson Diamonds, nie gehört? Oberirdisch! Flächenmäßig eine der größten Minen der Welt, wenn ich’s richtig weiß, gigantische Abraumhalden. Liegt südlich von Mwanza“, erzähle ich. Toll, wenn mal jemand nutzloses Wissen abfragt! „Hab mal irgendwann nachgelesen: Um ein Karat zu fördern, ein Fünftel Gramm Edelstein, müssen da hundertfünfzig Tonnen Erde bewegt werden! Als das in den vierziger Jahren losging, waren es nicht mal afrikanische Zwangsarbeiter, sondern italienische Kriegsgefangene, die da schuften mussten. Das Unternehmen hatte allein 200 Wachsoldaten! Es gibt alte Fotos, das sah aus wie ein riesiges Fort im Wilden Westen, mit Wachtürmen und Stacheldraht überall. Die Mine war Mitte des letzten Jahrhunderts eine der ergiebigsten Diamantenminen der Welt, und ist es heute wieder. Gehört zu drei Vierteln De Beers – wem sonst? Das letzte Viertel ist Staatseigentum. Es gibt sogar eine eigene Diamantenpolizei in Tansania! Die kümmert sich aber vor allem um den Schmuggel aus den vielen kleinen, oft völlig ungesicherten Minen. Zwischen Mwanza und Shinyanga buddeln sich da jährlich Dutzende zu Tode.“
Petermann hat höflich zugehört. Jetzt schaut er sich aufmerksam um, dann senkt er verschwörerisch die Stimme. „Hannes, ich muss einen verschwundenen Freund finden. Kenn’ den schon seit der Schulzeit. Mein Freund Gerd ist seit Ostern in Mwanza verschollen. Vor ein paar Tagen hat seine Mutter ihn vermisst gemeldet. Aber ehe unsere Botschaft oder ihre Polizei was unternimmt, ist es möglicherweise zu spät.“
Auf seinen leisen Ton einschwenkend, beuge ich mich zu ihm herüber und frage zweifelnd: „Was macht denn das Verschwinden ihres Freundes so dramatisch, Jens? Kommt doch öfter vor, dass sich hier jemand wochenlang nicht meldet .. .“
„Ja, aber Gerd ist Journalist. Der war hinter einer großen Story her. Hätte sich spätestens Anfang der Woche in seiner Redaktion melden müssen. Gerd ist derjenige, der mir vor Jahren von den Diamanten und dem Al-Kaida-Mann an Bord der Bukoba erzählt hat. Hatte ich ihnen damals von geschrieben. Diesen Dschihadisten hat doch die CIA niemals allein reisen lassen. Und wen noch so alles ... ‚Fünfzehn Jahre nach dem Untergang: Wurden die Verantwortlichen je bestraft?’ – für so eine Geschichte sollte Gerd richtig tief im Dreck wühlen. Das ist ihm eventuell nicht gut bekommen ...“
„Klingt nicht ganz ungefährlich ...“, werfe ich lächelnd ein. „Vielleicht sollten wir meinen Tagessatz nochmal neu verhandeln ...“ Ganz wohl ist mir bei der Sache wirklich nicht. „Oder das Ganze vielleicht doch unserer Polizei überlassen?“
„Nein!“, sagt Petermann sehr bestimmt. „Das reicht nicht. – Auf jeden Fall wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich begleiten würden und die Reiseplanung übernehmen. In Mwanza müssen Sie mir eventuell beim Beschaffen der Taucherausrüstung helfen. Einen Tauchpartner muss ich auch erst noch finden, es sei denn, mein Freund Gerd taucht wieder auf. Der kann das. Sie haben nicht zufällig einen PADI-Schein?“
„Einen was?“
„Eine Taucherausbildung.“
„Nein, Gott bewahre. Kommen Sie mir bloß nicht mit Wasser. Taucher finden sie im ganzen Land nicht viele, da können noch so viele Pötte absaufen, das ändert nichts. Sie wissen doch, damals bei der Bukoba brauchte es Tage, bis Profis der südafrikanischen Navy auftauchten und geeignetes Gerät herangeschafft war. Da waren auch die letzten Überlebenden, die es in den Kabinen im Bauch der Bukoba nachweislich noch gab, tot. Große Scheiße, das alles.“
Unsere leise Unterhaltung wird langsam anstrengend.
„Wollen wir nicht erstmal etwas essen? Kennen Sie ein Lokal in der Nähe?“, fragt der Deutsche wie bestellt. Auf den Magen schlägt das Schicksal der damals Ertrunkenen meinem mzungu anscheinend nicht.
„Ja, gern. Wie wär’s mit pakistanisch?“, entgegne ich ein wenig betroffen. Kurz darauf sitzen wir in Khans Barbecue Garage, „dem besten Paki der Stadt“, wie es heißt. Unter der Decke des großen, schmucklosen Saals verteilen träge rotierende Ventilatoren die mit Kardamom, Pfeffer, Öl, Curry und Fliegen satt geschwängerte Luft. Auch das Mobiliar von Khans Laden, weiße Kunststoffstühle, fleckige Plastikdecken auf wackeligen Rohrtischen, passt zum Garagen-Stil. Das Essen servieren Khans Kellner auf schweren Porzellantellern, Messer und Gabel sind aus Blech. All das mag für einem mzungu wie Petermann gewöhnungsbedürftig sein, mir verdirbt hier garantiert nichts den Appetit. Schließlich geht es doch allein um den Geschmack! Nirgends habe ich jemals köstlichere Fleischspieße in scharfer Kokossauce mit pilau und Tomatensalat genossen. Fantastisch, besonders natürlich, wenn man nicht selbst zahlen muss. Nur Bier schenkt Mister Khan nicht aus, zwei Mango-Lassi tun es auch.
Am nächsten Morgenbin ich früh auf den Beinen. Vom fünften Stock des Crown Hotels habe ich einen fantastischen Blick auf den geometrisch so vollkommenen Kegel des Mount Meru am Horizont. Davor ziehen sich unter dem strahlend blauen Himmel unzählige rostrote Pyramidendächer bis an die grünen Vulkanhänge. Ab und zu blitzt dazwischen auch fabrikneues Blech in der Morgensonne. Auf den Stadionbänken unter mir räkeln sich die bedröhnten Jugendlichen von gestern Abend. Überall verstreut liegen Pappen herum. Jetzt erst sehe ich, dass nicht wenige der darunter Hervorkrabbelnden kleine Kinder sind: verwahrloste Straßenjungs, wie es sie in wachsender Zahl überall im Lande gibt.
Alle Welt behauptet, dass diese verdammeleite Immunschwächekrankheit dafür verantwortlich sei, die Abertausend Eltern dahingerafft habe. Ich mag das ja nicht so recht glauben. Verwaiste Kinder gibt es schließlich seit eh und je, immer haben sich Verwandte um sie gekümmert. Dass das heute nicht mehr überall funktioniert, dürfte doch viel eher an der wirtschaftlichen Not liegen, in der sich immer mehr Familien befinden. Not kann böse machen. So viele Waisenhäuser können da gar nicht gebaut werden, wie nötig wären, um all die verstoßenen, als kostenlose Arbeitskraft oder sogar sexuell missbrauchten Kinder aufzufangen. Das trübt den Blick jetzt doch gehörig. Ich mag mir gar nicht ausmalen, welche asozialen Verhältnisse da auf uns zukommen, wenn diese hoffnungslosen, sich selbst überlassenen Kids ausgewachsen sind und auf uns losgelassen werden.
Читать дальше