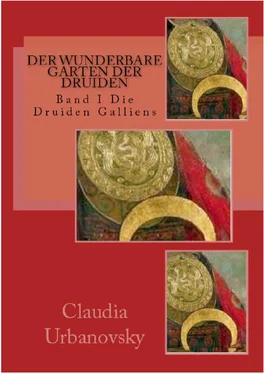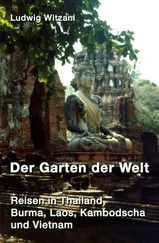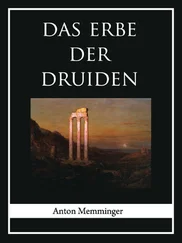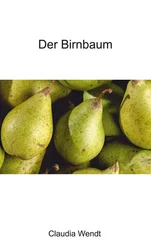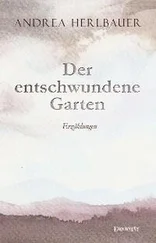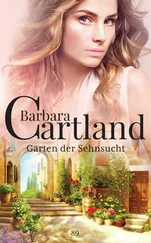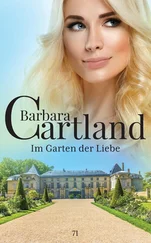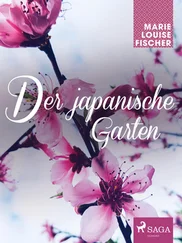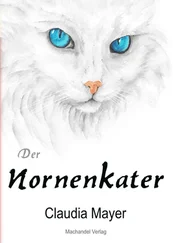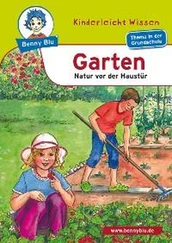Genau wie bei den Kelten auf der anderen Seite des Meeres – in Irland – waren in den Tagen des Leydener Manuskripts die Zentren der Bewahrung und der Verbreitung der Kultur in den Klöstern angesiedelt. Die bretonische klösterliche Tradition ist auf den gleichen Grundlagen gewachsen wie die irische. Alle bedeutenden Klostergründungen wie Dol, Landevennec, Plean oder Redon gehen auf irische keltische Missionare zurück. Diese Einrichtungen bewahrten genauso wie ihre irischen Schwestern Handschriften der Antike auf und vervielfältigten diese. Daneben waren sie selbst literarisch höchst aktiv und verfassten eigene Handschriften in altbretonischer und auch lateinischer Sprache, die sie mit kunstvollen Miniaturen schmückten. Die Christianisierung Armoricas verlief ähnlich wie die von Irland verhältnismäßig gewaltlos. Nach anfänglichem Widerstand und Zweifeln öffnete sich der Druidenorden, vielleicht aus Berechnung, vielleicht aus der Not heraus, auch auf dem Kontinent der neuen Religion. Vielen Druiden gelang es, ebenso wie in Irland, hohe Ämter in der neuen kirchlichen Ordnung zu übernehmen, bei der – unabhängig von Rom und von der römischen Doktrin – die Klöster im Mittelpunkt des religiösen und geistlichen Lebens standen. Genauso wenig wie die Christianisierung Irlands hat die Christianisierung Armoricas echte Märtyrer hervorgebracht. Aber die armoricanischen Druiden brachten wie ihre irischen Brüder ihr über Jahrtausende gesammeltes und mündlich überliefertes Wissen ein; ein Wissen, das sich nicht nur auf religiöse Dinge beschränkte, sondern alle Gebiete berührte: von der Philosophie über die Dichtkunst, die Musik, fremde Sprachen und Geschichte bis zu den klassischen naturwissenschaftlichen Disziplinen wie Mathematik, Physik und Astronomie. Vor allem aber bereicherten sie die Klöster mit ihren außergewöhnlichen Kenntnissen in der Botanik, der Biologie und der Medizin. Und sie brachten dieses Wissen nicht nur mit und ließen zu, dass uralte Kenntnisse in schriftlicher Form festgehalten wurden. Genauso wie in Irland waren die bretonischen Klöster gleichzeitig auch Universitäten, die die gesammelten Kenntnisse und Erkenntnisse weitervermittelten. Auf diese Art und Weise setzte sich die druidische Lehrtätigkeit über die Epoche der offiziellen Christianisierung Armoricas hinaus ungestört und wohl organisiert fort.
Als die Druiden, die großen Weisen Armoricas, in die neuen Klöster des keltischen Christentums eintraten, schworen sie weder ihren keltischen Gottheiten noch ihren philosophischen und religiösen Vorstellungen ab, genauso wenig wie sie ihre Bräuche und Traditionen aufgaben. Sie integrierten diese einerseits einfach in das neue Glaubenssystem und beeinflussten es grundlegend, andererseits überlebte auch die reine und unverfälschte Weisheit der Druiden und ihre alte Religion im Schutz dieser monastischen Gemeinschaften. Oftmals führten die Druiden im Inneren einer columbanitischen Gemeinschaft ein richtiges Eigenleben, getrennt von den christianisierten Brüdern – Stab und Kreuz, so, wie es sich heute noch im Rahmen der orthodoxen keltischen Kirche fortsetzt, in der druidische und christische Würdenträger und Adepten respektvoll und friedlich koexistieren.
Diese columbanitischen Gemeinschaften siedelten bezeichnenderweise regelmäßig an oder unweit von ursprünglichen heiligen Stätten der Druiden; neben besonderen Quellen oder Seen, im Herzen bestimmter riesiger, undurchdringlicher Waldgebiete, die Armorica zu dieser Zeit überwiegend bedeckten, in der Nähe des heutigen Mont Saint Michel und auf dem Tombelaine selbst, auf die kaum zugänglichen Monts d’Arée oder entlang der zerklüfteten Küstenlinie des Atlantiks, direkt am Meer. Auch heute noch befindet sich der Sitz des Erzbischofs der orthodoxen keltischen Kirche in Sainte-Dolay, unweit des den Druiden heiligen Mont Dol im Morbihan.
Erst zu Anfang des 10. Jahrhunderts der Zeitrechnung wurde diese religiöse »Idylle« gestört, als die Normannen, von Rom angestachelt, in die Bretagne einfielen, die Bevölkerung so gut sie konnten massakrierten oder verjagten und die keltischen Klöster bis auf die Grundmauern niederbrannten. Das tiefgreifendste Ergebnis dieses normannischen Wütens war allerdings nicht etwa der Verlust der Unabhängigkeit und Souveränität Armoricas, denn im Jahre 937 gelang es König Alain Barbetorte, die Eindringlinge zu vertreiben und seine Herrschaft wiederherzustellen. Es war nicht einmal die physische Vernichtung der Druiden selbst. Aber die wunderbaren und wertvollen Handschriften, die in den keltischen Klöstern von christlichen Mönchen und christisierten Druiden hergestellt worden waren, waren zum allergrößten Teil unwiederbringlich verloren: zu Asche verbrannt und nur noch eine Erinnerung im Gedächtnis der Überlebenden der Massaker. Diese zogen sich aus ihren gut organisierten »Kloster-Universitäten« wieder in die Wälder und abgelegene Gebiete zurück, wo es eben keine Infrastrukturen für eine gezielte wissenschaftliche und Lehrtätigkeit mehr gab. Nur eine kleine Anzahl von handschriftlichen Fragmenten hat das Wüten der Eindringlinge überlebt. Vor etwa einem Jahr tauchte bei einer archäologischen Ausgrabung in der Bretagne ein neues Manuskriptfragment auf, das höchstwahrscheinlich aus derselben Zeit stammt wie das Leydener Manuskript, vielleicht aber auch ein wenig älter ist. Allerdings wurde von der Grabungsleitung über den Inhalt bis jetzt noch nichts Konkretes veröffentlicht, da das Vellum erst restauriert werden muss.
Neben dem Leydener Manuskript existiert eine weitere Schrift von herausragender Bedeutung. Sie stammt aus dem 4. Jahrhundert der Zeitrechnung und trägt den Titel »De Medicamentis Empiricis Physicis ac Rationalibus«. Der Autor dieses Werkes, Marcellus Empiricus oder auch Marcellus Burdigalensis genannt, war ein hoher Beamter des Kaisers Theodosius. Es ist immer noch eine Streitfrage, ob Marcellus Arzt war oder nur ein medizinisch interessierter Laie. Unumstritten ist jedoch seine keltische Muttersprache, die im Text »De Medicamentis« ständig durchschlägt.
Im Jahre 1847 veröffentlichte Jacob Grimm seine Abhandlung über diesen Marcellus Burdigalensis, in der er die damals ältesten bekannten keltischen Sprachzeugnisse erklärte. Zusammen mit seinem Bruder Wilhelm, der 1813 »Drei Altschottische Lieder« und 1826 »Irische Elfenmärchen« veröffentlichte, war er einer der wichtigsten Impulsgeber der modernen keltischen Philologie. Die Brüder Grimm pflegten nicht nur Kontakte nach Schottland zu Sir Walter Scott und nach Irland zu Crafton Croker, sondern auch in die Bretagne mit De la Villemarque, dem Chronisten der »Barzaz Breiz«. Jacob Grimm war bereits seit 1811 korrespondierendes Mitglied der Keltischen Akademie in Paris. Grimms Arbeit über Marcellus’ »De Medicamentis« ist die Grundlage, auf der die ersten historischen Grammatiken der keltischen Sprache, wie die von Johann Caspar Zeuß, aufbauen konnten. Sie eröffnete auch den ersten echten Einblick in das überlieferte heilkundliche Wissen der keltischen Druiden, ihre Tradierung in der Volksmedizin und ihr Überleben in der medizinischen Praxis sowohl der gallischen Ärzte als auch der einfachen Heilkundigen. Daneben unterstreicht der im »De Medicamentis« überlieferte Wissensschatz noch deutlich die Tendenz, sich an praktischen Mitteln zu orientieren und vorchristliche, gerne als abergläubisch bezeichnete Mittel und Praktiken zu integrieren. Diese Tendenz lässt sich bei der medizinischen Literatur der ausgehenden Antike, die aus dem Osten des Römischen Reiches und aus dem Orient stammt, nicht in so klarem Maße nachweisen, was darauf hindeutet, dass die ursprünglichen Quellen örtlichen und damit keltisch-druidischen Ursprungs gewesen sein müssen. Wenn man nämlich den Marcellus zwei zeitgleichen Werken gegenüberstellt – Cassus Felix’ »Über die Medizin« und Theodorus Priscianus’ »Leicht beschaffbare Heilmittel« –, die aus griechischen Quellen schöpfen, dann sind es genau diese Unterschiede, die zuerst ins Auge springen. Marcellus’ Werk ist ein außergewöhnliches Zeugnis der Naturphilosophie. Obwohl er an einer Stelle schreibt: »Barmherzigkeit empfängt man am besten von Gott«, was darauf hindeuten könnte, dass er vielleicht Christ war, ist seine Materie doch durch und durch mit heidnischem, pantheistischem Gedankengut durchsetzt. Er zitiert in den Quellen, die er für sein Werk verwendet hat, neben Apuleius, Plinius, Celsius, Eutopius und seinem Zeitgenossen Ausonius auch Patera von Bayeux, den Druiden, der zu dieser Zeit Professor für Heilkunde in Bordeaux war, und Phebicius, einen weiteren heilkundigen Druiden, der ebenfalls in Bordeaux lehrte, aber gleichzeitig auch Hüter des dortigen Heiligtums des Belenos war. Der Leser sollte an dieser Stelle nicht vergessen, dass wir uns im 4. Jahrhundert der Zeitrechnung befinden und Marcellus’ Herr, Kaiser Theodosius, gerade außergewöhnlich gewalttätige Edikte sowohl gegen die Heiden als auch gegen Magier aller Art erlassen hatte! Trotzdem zitiert Marcellus freimütig an vielen Stellen die Druiden Patera und Phebicius in seiner heilkundlichen Schrift, von der heute manche sagen, sie wäre nichts anderes als ein haarsträubendes Sammelsurium aus der Drecksapotheke.
Читать дальше