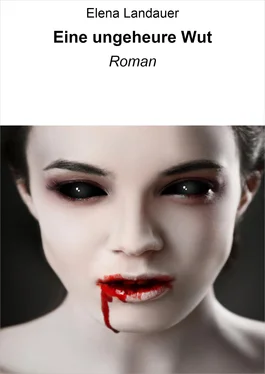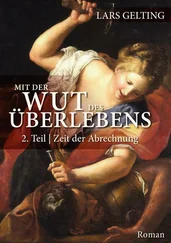Bei Auskünften über seine Ehe war Julian noch zurückhaltender. Er sei achtzehn Jahre verheiratet gewesen. Man habe sich aber auseinandergelebt. Ich gab mich mit dieser knappen Antwort zufrieden, obwohl ich natürlich gerne mehr erfahren hätte; aber offenbar wollte er nicht mehr sagen.
Irgendwann lud ich Julian zu mir ein, weil ich vergeblich darauf wartete, dass er die Initiative ergriff. Ich habe meinen Schreibtisch im Wohnzimmer stehen, weil ich eine Drei-Zimmer-Wohnung habe mit einem Schafzimmer für mich und einem für Judith, meine Tochter. Julian sprach mich gleich auf das Foto an, das auf dem Schreibtisch stand:
„Ist das deine Tochter?“
„Ja, das ist Judith.“
„Ein schönes Mädchen mit einem fröhlichen Lachen im Gesicht.“
„Ja, sie ist ein sehr fröhliches Mädchen, voller Unternehmungslust.“
„Ich habe mich mal im Internet über Columbus informiert“, sagte Julian zögerlich.
„Warum?“
„Nun ja, nachdem du mir erzählt hast, dass sie dort ihr Auslandsschuljahr macht, wollte ich doch einmal wissen, wie es da so aussieht.“
Obwohl Julian sich schon mehrfach erkundigt hatte, wie es meiner Tochter in Amerika ging, war ich doch erstaunt, dass sein Interesse so weit ging, dass er sich mit ihrem Aufenthaltsort befasst hatte.
„Und was hast du herausgefunden?“, fragte ich.
„Ich wusste gar nicht, dass Columbus eine so große Stadt ist“, sagte er. „Sie hat über 700.000 Einwohner.“
„Aha“, sagte ich nur. Mir war das auch neu, ich sagte aber nicht mehr, weil ich darüber nachdachte, warum Julian die Stadt so sehr beschäftigte.
„Fünfundzwanzig Prozent sind Afroamerikaner“, fuhr Julian fort. „Das hat mich auch überrascht. Ich hatte mir gedacht, die Schwarzen leben im Süden, wo ihre Vorfahren auf den Baumwollfeldern arbeiten mussten, oder in Detroit wegen der Autoindustrie, oder in New York, aber nicht in einer so ländlichen Gegend, wo die Farmer mit ihren riesigen Mähdreschern über die Felder fahren.“
„Hast du was gegen Schwarze?“, fragte ich verwirrt, weil ich nicht wusste, wie ich seine Informationen deuten sollte.
„Nein, nein,“ versicherte er, „aber über zehn Prozent der Bevölkerung von Columbus leben unter der Armutsgrenze, und das sind überwiegend Schwarze.“
„Traurig genug“, konstatierte ich, „aber warum erzählst du mir das?“
„Ich meine damit nur, dass Columbus doch nicht so ungefährlich ist, wie ich angenommen habe.“
„Willst du mir Angst machen?“, fragte ich.
„Entschuldige! Nein, das wollte ich nicht. Ich habe mir nur so meine Gedanken gemacht.“
„Solche Gedanken macht man sich nicht nur einfach so. Was ist mit dir los?“
Julian schwieg.
„Ich kann dich aber beruhigen“, sagte ich schließlich. Judith lebt in einem sehr bürgerlichen Viertel. Ich kann´s dir mal im Internet zeigen. Ich klickte auf Google earth, tippte die Straße ein und zoomte dann auf das Haus, in dem Judith lebte, ein typisches amerikanisches Einfamilienhaus mit einer Doppelgarage und einem kleinen Swimmingpool im Garten.
„Und die Schule ist nicht weit weg“, ergänzte ich.
Ich zoomte mich wieder von dem Haus weg und zeigte ihm die Schule, die zwei Blocks entfernt war. Julian schaute nur und sagte nichts. Ich schaltete auf Emails und zeigte ihm Fotos, die die Familie mir zugeschickt hatte. Das sind Ron und Barbara, und das sind ihre beiden Mädchen. Ron arbeitet in der Stadtverwaltung und Barbara ist Lehrerin an Judiths Schule.“
Julian sagte immer noch nichts.
„Und das ist Rex“, fügte ich noch hinzu und zeigte Julian das Foto eines deutschen Schäferhundes.
„Der beißt jeden Eindringling weg. Beruhigt?“
„Entschuldige“, sagte Julian schließlich, „ich bin vielleicht ein bisschen zu ängstlich.“
Mitte August kam Judith aus den USA zurück. Sie war noch einige Wochen über das Schuljahresende hinaus dort geblieben, um mit ihrer Gastfamilie eine Rundreise zur Westküste zu machen: Yellowstone Park, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon und so weiter.
Ich fuhr zusammen mit Julian zum Flughafen, um sie dort abzuholen. Judith kam braun gebrannt und strahlend in die Empfangshalle, fiel mir um den Hals und begrüßte Julian mit der Nonchalance einer Weitgereisten. Sie plapperte ununterbrochen, als wir in Julians Auto nach Hause fuhren. Hinten im Auto sitzend erzählte sie halb Englisch halb Deutsch von Ihrer Familie, von Mom, Dad, Cindy und Meaghan, von ihrer Schule und von der Rundreise. Ich beobachtete Julian von der Seite. Er amüsierte sich köstlich, das Grinsen ging ihm nicht aus dem Gesicht. Er saß da wie ein stolzer Vater, der seine schöne Tochter auf dem Abiball tanzen sieht. Als Judith so ungefähr zum zehnten Mal von ihrer Mom gesprochen hatte, sagte ich: „Excuse me, young lady, I´m your mom.“ „Entschuldigung!“, widersprach Judith heftig, „Barbara ist meine Mom, du bist meine Mutter.“
Sie beugte sich vor und gab mir einen Kuss.
Zum Abendessen waren wir wieder mit Julian verabredet. Wir holten ihn in seiner Festung ab und fuhren in das Lokal, wo ich schon mit Julian die Erledigung der Unfallkosten gefeiert hatte. Judith konnte sich natürlich nicht verkneifen, Julian nach den Gründen für die Schutzmaßnahmen um sein Haus zu fragen. Ob er Goldschätze dort aufbewahre oder Leichen in seinem Keller verstecke? Julian wirkte aber nicht gekränkt, sondern verwies auf die Ängstlichkeit seiner früheren Frau. Beim Essen verlief die Unterhaltung ähnlich wie im Auto: Judith erzählte, inzwischen auch schon überwiegend auf Deutsch, was es alles an Absonderlichem in den USA gab. Immerhin hatten wir manchmal Gelegenheit eine Frage zu stellen, wenn sie gerade mal den Mund voll hatte. Als Erstes ging es um die Tischsitten. Sie sei versucht gewesen, erzählte Judith, als die Suppe serviert worden sei, die Hände unter dem Tisch zu falten und still zu beten. Das habe ihre Familie nämlich getan, wenn sie in ein Restaurant gegangen seien. Zu Hause sei aber immer laut gebetet worden, vor und nach dem Mittagessen, ebenso vor und nach dem Abendessen. Nur zum Frühstück sei nicht gebetet worden. Das habe man verzehren dürfen, ohne Gott um seinen Segen zu bitten oder ihm zu danken. Sie seien aber selten in ein Restaurant gegangen, weil ihre Mom und ihr Dad gerne gekocht hätten, und zwar gut und gesund. Es habe keineswegs jeden Tag Fast Food gegeben, wie wir vielleicht denken würden. Es gebe auch Amerikaner, die nicht nur von Hamburgern und Pommes und Cola lebten; aber natürlich seien die meisten Amerikaner übergewichtig, nicht aber ihre Familie. Dann ging es um die Schule, ihre Lehrer, ihre Freunde, dann wieder um die Rundreise. Julian stellte am Anfang einige Fragen, wurde dann aber immer stiller.
Schließlich meinte Judith: „Ich glaube, ich rede zu viel, Julian wird schon ganz schläfrig.“ Julian protestierte. Es sei ein Vergnügen, ihr zuzuhören; aber er sei wohl in der Tat ein wenig müde. Er entschuldigte sich und bat darum, es ihm nicht übel zu nehmen, wenn er vorzeitig nach Hause ginge. Er wirkte trotz der aufgesetzten Heiterkeit traurig und verließ das Lokal mit hängenden Schultern.
Judith war in den folgenden Tagen kaum noch zu sehen. Sie traf sich mit ihren Freundinnen und Freunden, und bald begann auch die Schule. Ich war schon froh, wenn sie wenigstens beim Abendessen und am Wochenende zu Hause war.
Was mich von Tag zu Tag mehr verwirrte war die Tatsache, dass Julian mich nie zu sich einlud. Wenn wir uns privat trafen, geschah das immer bei mir. Ich überlegte, ob ich ihn fragen sollte, ob er vielleicht, wie Judith gescherzt hatte, tatsächlich eine Leiche im Haus habe, unterließ es aber, um ihn nicht unter Druck zu setzen. Schließlich sagte er von sich aus, es sei doch komisch, dass ich noch nie in seinem Haus gewesen sei, und lud mich für den nächsten Tag ein. Begrüßt wurde ich zunächst vom wütenden Gebell seines Hundes, der sich am Zaun aufrichtete und mir sein Gebiss zeigte, und vom grellen Licht des Bewegungsmelders. Ich hatte schon Angst auf die Klingel zu drücken, weil ich befürchtete, dann ginge ein neues Donnerwetter los. Ich musste es aber erst gar nicht tun, weil Julian schon das Gartentor öffnete.
Читать дальше