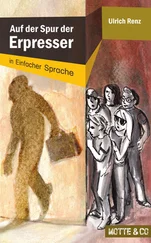Ich hätte deiner Mutter nachgeben sollen. Für sie den Kuchen, für mich die Krümel. Sie: die aufopfernde Mutter, ich: der Versager, der es verdient hat, aus der Familie geworfen zu werden. Ich hätte mich klein machen sollen, damit ihr groß werden und vor allem zusammenbleiben könnt.
Einen Krieg gegen die Polen kann man gewinnen. Einen Krieg gegen die Polinnen? Niemals! Das schrieb der polnische Schriftsteller Andrzej Szczypiorski. Jetzt verstehe ich, was er meint.
Aber dass deine Mutter so weit geht, das ist nicht fair und nicht gut. Sie stellt ihren verletzten Stolz, ihren Egoismus über das Wohl von dir und deinem Bruder. Hat sie noch einen klaren Blick auf die Dinge? Ich zweifele daran.
Ich kann deine gemalten Bilder nicht ansehen, ohne dass sich in mir etwas zusammenzieht. Ich kann die letzten Fotos von dir, von euch beiden zusammen nicht ansehen ohne einen Kloß im Hals. Ich war nie ein weinerlicher Typ und erkenne mich selbst nicht wieder. Es gibt keine Therapie für diesen Schmerz.
Ich danke deiner Mutter, dass sie mir wenigstens deinen Bruder dagelassen hat. So gibt es die Pflicht, weiterzuleben, nicht aufzugeben. Andererseits denke ich manchmal: Hätte sie ihn auch mitgenommen, wäret ihr jetzt nicht alleine. Wäret wie Hänsel und Gretel im dunklen Wald. Könntet euch gegenseitig Mut machen. Euch streiten, vertragen, zanken, wieder Freunde sein. Ihr beide zusammen ward toll. Manchmal saß ich nur da und sah euch zu. Und freute mich darüber, auf was für Ideen ihr kamt. Ich sah euch zu und war glücklich.
Weißt du noch, unsere vielen gemeinsamen Ausflüge, Domi, du und ich? Deine Mutter hat ihre Sprachkurse vorbereitet, hat viel Zeit darauf verwendet, und ich war mit euch unterwegs. Es gibt wohl kein Ziel in der Umgebung, das wir nicht besucht hätten, keinen Zoo, keinen Spielplatz, kein Kinderparadies, kein Schwimmbad, keine Attraktion, wo wir nicht waren. Häufig fuhren wir mit dem Zug in eine Nachbarstadt, schauten nach, was es dort zu entdecken gibt. Immer wieder fuhren wir an den Rhein. Immer wieder zum Flughafen. Ich liebte die Ausflüge mit euch. Sie schweißten uns zusammen. Zu sehen, wie ihr alles entdecktet, ließ auch mich meine Umwelt mit neuen Augen -, mit euren Augen sehen.
Es kann nicht sein, dass diese Zeit mit deiner Entführung verloren ist. Da bleibt etwas, das uns niemand nehmen kann: ein Fundament, auf das wir später wieder neu bauen können.
Wenn wir in Krefeld, meiner Heimatstadt waren, besuchten wir die „alte Oma“, wie ihr sie nanntet, oder sie kam zu unseren Ausflügen dazu. Mit ihrem Rollator. Auf dessen Sitzfläche nahmst du Platz und ließest dich herumfahren. (Es gab die alte Oma aus Krefeld und die Polen-Oma aus Torun, ihr habt die Namen erfunden.)
Die alte Oma. Sie lebt nicht mehr. Domi hat sich von ihr verabschieden können, du nicht. Domi hat die Tragweite von dem, was da passierte, verstanden. Wenn wir über Omas Haus reden, sagt er heute: „Das Wichtigste darin fehlt: Oma“. Am 9. März 2017 ist sie gestorben. Drei Wochen zuvor haben Domi und ich noch bei ihr übernachtet.
Das war schön für mich: Sie schaute, dass er Abendbrot aß und zeitig ins Bett kam, ich konnte ausgehen und Freunde treffen. Domi war erkältet; sie sagte später, dass sie sich bei ihm mit etwas angesteckt habe, dass sie dann nicht mehr loswurde. Es stimmt: Es gab in diesem Jahr einen ziemlich aggressiven Grippevirus, der auch in den Altenheimen, in denen ich arbeite, viele Opfer forderte. Aber Domi hatte keine Grippe, sondern einen grippalen Infekt. So etwas hat er oft; wenn es danach geht, hätte er Oma gar nicht besuchen dürfen.
Eine Woche lang telefonierte ich nicht mit meiner Mutter. Es war die Karnevalszeit; in den Altenheimen, in denen ich arbeite, gab es Feiern, der Straßenkarneval begann, und außerdem waren du und deine Mutter ja schon einige Tage verschwunden. Ich dachte immerzu an dich und kaum an meine Mutter. Schließlich rief sie an und fragte, ob ich nicht wissen wolle, wie es ihr gehe. Es gehe ihr nicht gut. Sie erzählte von ihren Beschwerden. Ich riet ihr zur Antibiotika-Therapie. Dumm, dass sie einen Arzt hatte, der diese kaum je verordnete. Zu viel Antibiotika ist nicht gut, das stimmt schon, aber sollte es bei einer über Neunzigjährigen nicht egal sein, ob sich Resistenzen bilden oder nicht?
Am Sonntag nach Karneval ließ sie sich ins Krankenhaus einweisen. Domi und ich fuhren hin. Sie sah ganz gut aus. In der Notaufnahme fand die Diagnostik statt, ihr Blut hatte hohe Entzündungswerte, sie sollte nun endlich Antibiotika bekommen und bis auf Weiteres im Krankenhaus bleiben.
Beruhigt fuhr ich mit Domi wieder ab, im festen Glauben, sie würde wieder gesund. Ein Jahr zuvor hatte sie so etwas schon einmal durchgemacht. Warum sollte es dieses Mal nicht auch gutgehen? Die Ärzte im Krankenhaus würden schon wissen, was sie tun.
Am Mittwoch darauf, dem Weltfrauentag 8.3., hatte ich frei. Nachmittags hatte ich eine Lesung in Düsseldorf, darauf wollte ich mich vorbereiten und vorher nicht zur Arbeit gehen. Das traf sich gut, so konnte ich vormittags eure Oma besuchen. Was ich sah, gefiel mir gar nicht: Sie war sehr schwach, hatte eine unruhige Atmung und sprach und jammerte leise vor sich hin. Ihr Mund war trocken, ich konnte sie kaum verstehen, aber trinken wollte sie nicht, nicht einmal aus einem Schnabelbecher, den ich holte, damit sie auch im Liegen hätte trinken können. Sie fragte nach euch, fragte, ob ich Nachricht von euch hätte. Ich verneinte. Sie wusste von eurem Verschwinden und machte sich Sorgen. Nach einer Stunde ging ich wieder. Ich hatte mir notiert, was sie noch haben wollte: vor allem andere Kissen für Kopf und Rücken, weil sie auf denen des Krankenhauses schlecht liegen konnte.
Und am nächsten Tag dann erlosch ihr Lebenslicht. Morgens um sieben rief uns der Stationsarzt an: Er wisse nicht, ob sie den Tag überstehen werde. Die Nachricht traf mich sehr. Ich wollte so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Ich fragte Domi, ob er mitkommen wolle oder lieber wie immer in die Schule gehen. Ich sagte ihm, warum ich nach Krefeld ins Krankenhaus fahre. Er wollte mit.
Wir kamen zu spät, um deine Oma noch einmal lebend zu sehen. Wir verpassten einen Zug, wir holten ihr wie gewünscht bessere Kissen, und im Krankenhaus dann führte ich noch ein Telefonat. Wenn wir das alles gelassen hätten und gleich zu ihr gefahren wären, hätten wir sie vielleicht noch lebend angetroffen. Vielleicht. Vielleicht hätte sie Domi und mich erkannt, hätte uns einen letzten Blick geschenkt, einmal die Hand gedrückt, wer weiß.
Als mein Vater starb, 2000, blieb in mir das Gefühl zurück, in den entscheidenden Momenten versagt zu haben, nicht da gewesen zu sein. Ein wenig ist es auch jetzt so. Und wenn ich an dich denke, dann war meine Passivität in den Tagen vor deinem Verschwinden wohl mein größtes Versagen. Ich fühle mich zwar nicht nur als Versager im Leben, dafür habe ich zu viel erreicht. Aber Feigling darfst du mich nennen. Wenn es ernst wird, ducke ich mich weg.
In diesen schweren Stunden ließ ich Domi selbst entscheiden, woran er teilnehmen wollte und woran nicht. Er wollte noch einmal ins Zimmer, Oma sehen. Öfters wollte er dann nicht, denn er fand es etwas gruselig, wie er sagte. Klar: Die Mimik eines Toten ist anders als die eines Lebenden. Ich berührte Omas Hände, die waren noch warm. Eine Schwester fragte mich, ob ich ihren Ehering mitnehmen wolle, ich bejahte. Die Schwester hatte ganz schön Mühe, ihn vom Finger zu bekommen. Schließlich schaffte sie es, reinigte ihn und gab ihn mir.
Ich ging noch einmal ins Zimmer, um Omas Sachen mitzunehmen, nicht alle, aber die wichtigsten. Und die Schokolade aus dem Nachtschränkchen, die sie nicht gegessen hatte.
Ich bin ein großer Fan des Kindeswillens, sagte ich? Was aber war in der Zeit der Trennung mit deinem Willen? Wer nahm deinen Willen, wer nahm dich ernst? Wer fing dich auf mit deinen Ängsten, die dich Bilder wie am Fließband malen ließen?
Читать дальше