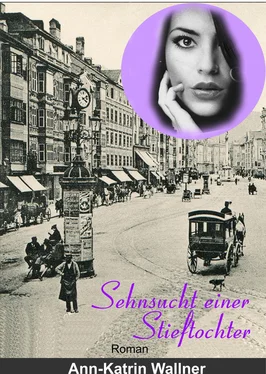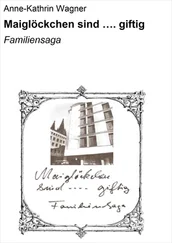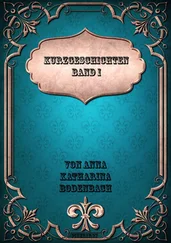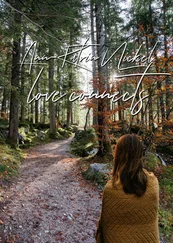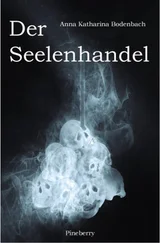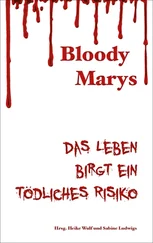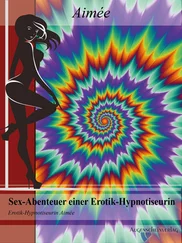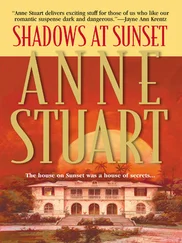Ann-Katrin Wallner - Sehnsucht einer Stieftochter
Здесь есть возможность читать онлайн «Ann-Katrin Wallner - Sehnsucht einer Stieftochter» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Sehnsucht einer Stieftochter
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sehnsucht einer Stieftochter: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Sehnsucht einer Stieftochter»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Sehnsucht einer Stieftochter — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Sehnsucht einer Stieftochter», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Vom Frankfurter Hauptfriedhof kommend, biegen sie in eine breite Straße ein. Der Wagen eines Fuhrwerks steht quer auf der Fahrbahn. Zwei Pferde beginnen zu scheuen und galoppieren die Straße entlang, den Wagen wie einen ägyptischen Streitwagen hinter sich herziehend.
"Halt ... halt! Oh Gott verdammt, meine Pferde!"
Der Mann, der auf dem Fuhrwerk sitzt und sich mit akrobatischen Bewegungen auf der Sitzbank zu halten versucht, schreit wieder nach seinen Gäulen. Lena gestikuliert ängstlich mit den Händen, schaut nach Paul, der auf die Straße rennt, sich den Pferden auf Höhe der hier einmündenden Bergerstraße entgegenstellt und sie mit erhobenen Armen zum Stehen bringt. Die Passanten, die das beobachten, klatschen, und Lena ist in diesem Moment mächtig stolz auf den Vater. Laut wiehernd und mit viel Schaum vorm Maul ziehen die Tiere den Wagen zur Seite.
"Brav, brav, ganz brav", sagt der völlig verstörte Mann hoch oben auf dem Wagen und beginnt, die Autofahrer zu beschimpfen. Die umstehenden Passanten versuchen, den aufgebrachten Mann zu beruhigen, was irgendwann auch gelingt.
"Warum hat der Mann so ein puterrotes Gesicht?", fragt Lena.
"Stress, purer Stress, wenn einem die Gäule durchgehen, ist das kein Zuckerschlecken. Vielleicht hat er auch einen zu viel gezischt", meint Paul und bemerkt Lenas fragende Augen.
"Der hat einen gesoffen! Heute ist Zahltag. Viele bekommen ihren Lohn und manche vertrinken ihn gleich wieder. Hast du noch nie die Frauen beobachtet, die die Männer aus den Gasthäusern holen, manchmal sogar unter Androhung von Prügel?"
"Nein, das habe ich noch nie gesehen."
"Wenn die eigene Frau im Anmarsch ist, ducken sich die Männer einfach weg, meist unter den Tisch, was von ihren Saufkumpanen nicht nur toleriert, sondern regelrecht gedeckt wird. Wenn es ums Saufen geht, halten die wie Pech und Schwefel zusammen."
"Hast du das auch schon mal gemacht?"
"Nein, ich gehöre nicht zu der Fraktion dieser Kampftrinker, denn das ist eine böse Sache", versucht er sie zu beruhigen.
Mittlerweile stehen sie vor der Eingangstür des Hauses, in dem sie zur Miete wohnen. Als Lena die Wohnung betritt, brennt im Wohnzimmer noch immer der Ofen, verbreitet eine wohlige Wärme. In der Küche steht nur ein Gasherd. Den neuen Herd haben sie vor Kurzem angeschafft, denn durch die Senkung der Gaspreise und den bezuschussten Kauf von Gasgeräten, haben sie sich so etwas Modernes leisten können. Staatliche Förderprogramme haben Mitte der Dreißigerjahre dazu geführt, dass neue Gasherde, Warmwasseranlagen und Waschmaschinen gekauft werden konnten. Von diesem "staatlichen Segen" haben auch sie profitiert.
"Du musst mit dem Hund raus, der will bestimmt mal Pipi machen", ruft Paul, ist sich aber nicht sicher, ob sie es gehört hat, denn sie hebt nur den Kopf und schaut, in jugendlicher Selbstvergessenheit, ins Wohnzimmer. Ihr Blick fällt auf die dunklen schweren Möbel, die einst für Generationen gezimmert wurden, dem Raum etwas Staubiges und zugleich Liebenswertes geben.
Ein aufregender Abend
Obwohl erst wenige Monate vergangen sind, empfindet sie die Zeit seit Agnes’ Tod schon wie eine Ewigkeit.
"Weißt du, seit die Mutter tot ist, habe ich nur noch meinen Hund, den ich drücken kann."
Da er sein nicht mehr ganz hörfähiges Ohr von ihr abgewendet hat, versteht er ihre Worte nicht gleich. Als er jedoch den Sinn begreift, steht er auf, nimmt sie in den Arm. Die Wärme, die von seinem Körper ausgeht, empfindet sie als wohltuend. Immer wenn er neben ihr steht und sie in die Arme nimmt, durchflutet sie dieses besondere Gefühl. Sie spürt, wie es sich im Körper ausbreitet, weiß, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlt. Eigentlich sind diese Empfindungen nicht neu, seit dem Tod der Mutter sind sie jedoch stärker geworden. Zunächst will sie diese Gefühle noch beiseiteschieben, irgendwann lassen sie sich aber nicht mehr verdrängen. Als er aus der Tür geht, sieht sie ihm nach, beobachtet seinen aufrechten, etwas schlaksigen Gang. Obwohl sie ihn nicht mehr sehen kann, hat sie noch immer sein Bild vor Augen und verliert sich wieder in ihren Träumen. Eigentlich ist sie froh, dass er noch einmal ins Zimmer zurückkommt, sich neben den Sessel stellt, ihr die Hand auf die Schulter legt. Der Duft von frisch gebackenem Kuchen zieht vom Treppenhaus in die Wohnung und versüßt die Atmosphäre.
"Könntest du mir einen Kaffee kochen? Jetzt, wo Agnes tot ist, musst du das übernehmen."
Kurz nickend geht sie in die Küche zur Anrichte, auf der die Kaffeemühle steht, und als wäre die Mühle federleicht, nimmt sie sie mit einer Hand, fängt zu mahlen an. Manchmal seufzt sie, denn schnell bleibt ihr die Kraft weg, doch sie ist wie besessen, dieses Gerät bedienen zu dürfen. Paul, der wieder vor dem Küchentisch steht, sieht kurz auf, bemerkt die zweite Tasse.
"Du sollst keinen Kaffee trinken", ruft er ihr zu. Diesen Satz hat sie schon so oft gehört, er verbindet ihn meist mit einem schrägen Blick, verpasst seiner Stimme zudem etwas Strenges, was sie nicht gut findet.
"Außerdem besteht Kaffeeknappheit wegen der brasilianischen Exportbeschränkungen. Kaffeeproduzenten dürfen nur noch die von der Kaffee-Überwachungsstelle vorgeschriebene Menge rösten", erklärt er ihr.
"Ach nein, nicht schon wieder. Ich werde bald sechzehn, da darf ich Kaffee trinken, die Mutter hätte es mir auch erlaubt. Außerdem interessieren mich die Exportbeschränkungen herzlich wenig", antwortet sie mit dem leicht aufmüpfigen Ton eines jungen Mädchens. Kaum hat sie die Worte ausgesprochen, wird ihr Blick sanfter. Er schaut von der Zeitung auf. Schwerfällig, fast polternd, steht er auf, als habe er vergessen, wie das anders und leiser geht.
"Oh, das ist aber seltsam!"
"Was ist seltsam?", fragt sie.
"Die haben eine Familie verhaftet. Ihren Sohn, einen vierjährigen Jungen, den haben sie nicht gefunden."
"Und warum hat man die Leute verhaftet?"
"Weiß der Geier, das geht aus diesem Artikel nicht hervor."
Er schaut noch einmal auf die Zeitung.
"Aber ... warte mal, hier steht etwas von Volksverrätern."
"Komisches Wort. Und was machen diese Volksverräter?"
"Lena, da fragst du mich zu viel, sie passen der Regierung wahrscheinlich nicht", knurrt er und sie spürt, dass er um den heißen Brei herumreden will. Sie ist lieber still, denkt kurz nach, es kommt jedoch nichts Sinnvolles dabei heraus. Stattdessen reibt sie sich die Augen und im nächsten Moment ist sie mit ihren Gedanken wieder ganz woanders, denkt an die Geier, die sie gestern im Biologieunterricht behandelt haben. Geier seien Faulsäcke, hat die Lehrerin gesagt, weil sie nur am Himmel kreisen und darauf warten, dass andere Tiere Beute machen, um sie dann zu verscheuchen und ihnen den Fang abzunehmen. Die Unterlippe vorgeschoben, sieht sie in den Spiegel, betrachtet ihr langes dunkles Haar. Unter der weißen Bluse zeichnen sich millimetergenau ihre großen Brüste ab. Der viel zu enge Rock, der ihr den Bauch einschnürt, betont ihre sanften Beckenrundungen. Paul steht plötzlich neben ihr, nimmt sie in den Arm und sie bemerkt das Schlagen seines Herzens, spürt, wie er seinen Körper an sie drückt.
Blick zurück
Der soziale Abstieg von Lenas Familie begann mit dem Aufstieg des Wilhelminischen Kaiserreichs. Um den genauen Zeitpunkt streiten sich noch die Geister.
Lenas Mutter Agnes wuchs in einem kleinen Dorf in Franken bei einer Tante auf. Sie war ein uneheliches Kind. Ihre Mutter wollte sich nicht zu ihrer Tochter bekennen, zog kurz nach der Geburt an die schöne Mosel nach Bernkastel, denn ledige Mütter versuchte man lieber aus der konservativ-religiösen Welt auszuschließen. Der Vater, wahrscheinlich ein Scherenschleifer, ein Vagabund, der den jungen Mädchen nur schöne Augen gemacht haben soll, sonst aber nichts bieten konnte, hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Staub gemacht. Er habe sehr gut Klarinette gespielt, erzählte man sich im Dorf. Eigentlich sollte die Tochter auf den klangvollen Namen Maria Magdalena getauft werden. Doch diejenigen in Familie, Dorf und Kirche, die etwas zu sagen hatten, nannten sie lieber Agnes. Die Menschen in dem Bauerndorf waren fromm. Die Worte des Priesters waren Gesetz, seinen Ansichten wollte und konnte sich niemand widersetzen, denn Widerstand gegen die Autorität des Pfarrers hätte Ausgrenzung bedeutet. Und die Ansichten des Priesters waren nicht immer sehr barmherzig, hatten wenig von der Einfühlsamkeit und dem Tröstlichen, das man von einem Mann der Kirche erwartet hätte. Unehelich geborene Kinder waren für ihn Bastarde. Kein schönes Wort, für viele dieser Kinder auch eine lebenslange Bürde. Und so dachten auch die Menschen in dem kleinen fränkischen Dorf, das sich in eine Senke zwischen ein paar Weinbergen in die ansonsten eher flache Landschaft duckte. In dieser Welt wuchs Lenas Mutter auf. Mit sechzehn Jahren verließ sie das Haus der Tante, ging zunächst nach Würzburg in Stellung, doch irgendwann zog sie die Freiheit der Großstadt Frankfurt magisch an. Dort lernte sie einen Jurastudenten kennen, heiratete und brachte ihre Tochter Lena zur Welt. Schon früh bemerkte Lena, dass die Mutter zahlreiche Briefe verfasste. Manchmal schrieb sie Abend für Abend wie besessen unter einer kleinen Leselampe, deren Licht unruhig zu flackern begann. Am nächsten Morgen übergab die Mutter Lena ein Kuvert, das sie zur nächsten Post bringen musste. Sie tat es gerne, denn sie spürte, dass diese Briefe für Agnes etwas Befreiendes hatten. Doch die Mutter sprach weder über ihren Inhalt, noch gab sie etwas über die Familienverhältnisse preis. Aber Lena wusste, dass diese Schreiben zur Großmutter nach Bernkastel gingen. Und ihr fiel auf, dass sie von dort nie eine Antwort zurückbekam. Lena fragte die Mutter danach, die aber gab sich wortkarg, wollte nichts über die Beziehung zur Großmutter verraten und behauptete sogar, die Briefe würden sie nicht interessieren. Doch Lena wusste, dass Agnes schwindelte. Irgendwann hörte sie auf zu fragen und gab sich ihren Fantasien hin, träumte sich in eine Zeit hinein, die für sie zwar nicht zu durchschauen, aber dennoch lebendig war.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Sehnsucht einer Stieftochter»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Sehnsucht einer Stieftochter» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Sehnsucht einer Stieftochter» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.