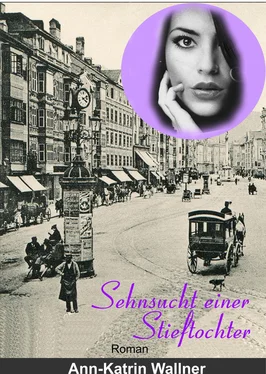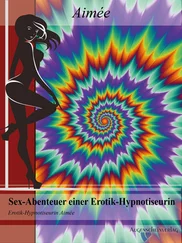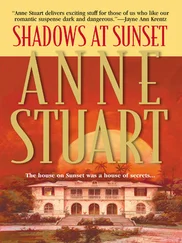Ein kalter Herbsttag im Jahr 1938. Es ist Mittag, kurz nach zwölf. Lena pfeift, erst leise, dann wird ihr Pfeifen lauter. Die Melodie, ein Ohrwurm, hat sie heute in der Schule aufgeschnappt. Alle pfeifen sie dort das Lied. Sogar die Lehrer pfeifen es, wenn auch leise und nur dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Erschrocken sieht sie sich um, hofft, dass ihr lautes Pfeifen von niemandem bemerkt wird. Ein Mann mit Bart, keinem Spitzbart, sondern einem altmodischen Zwirbelschnurrbart, kommt ihr auf der Straße entgegen. Als er das hübsche, dunkelhaarig gelockte Mädchen bemerkt, strafft sich seine Haltung und er versucht, den Bauch einzuziehen, was ihm bei seiner Leibesfülle schwer gelingt. Da er genau auf sie zusteuert, wird ihr sofort klar, dass sie mit diesem Mann, den sie überhaupt nicht kennt, wird reden müssen.
"Hast du eben etwas gesagt?"
Sie überwindet die erste Verdutztheit, taumelt aus den Gedanken.
"Nein, nichts, was soll ich gesagt haben? Gepfiffen habe ich. Kennen Sie das Lied nicht?"
Statt zu antworten, runzelt der Fremde nur die Stirn und in der Tat entwickelt sich ein kurzes Gespräch, wenn auch kein sehr anspruchsvolles. Hin und wieder beginnt sie sogar, bis zu den Haarspitzen zu erröten, dreht jedoch so geschickt den Kopf, dass er nicht sehen kann, wie sich ihre Gesichtsfarbe verändert. Eine Tomate wird nicht röter als ich, denkt sie, ärgert sich über ihre mangelnde Selbstsicherheit. Verwundert, gleichzeitig irritiert über das vollmundige Grinsen dieses Mannes, dessen schlechte Zähne ein allzu verschwenderisches Lächeln überhaupt nicht begünstigen, geht sie weiter.
In ihrem schwarzen, wie Samt glänzenden Mantel, der vielleicht ein wenig zu leicht für die Jahreszeit ist, beginnt sie zu frieren. Die breite Straße, die in der Mittagssonne liegt, kommt ihr wie ausgestorben vor, denn sonst fahren hier Busse, die sich durch den Verkehr hupen. Heute scheint alles wie leer gefegt. Einige Häuser tragen bereits weit sichtbare Narben des Verfalls, die dem Straßenzug etwas Trostloses verleihen. Sie biegt ab, sieht einen großen, mit einer Plane überzogenen Lastwagen vor einem Haus stehen, das etwas zurückgebaut ist. Schon öfter ist ihr dieses Gebäude aufgefallen, denn es wirkt großzügig und gepflegt, passt eigentlich nicht in diese verwahrloste Gegend, die ihre beste Zeit längst hinter sich gelassen hat. An der Vorderfront des Hauses rankt Efeu wie ein alles überdeckender grüner Vorhang an der Wand empor. Das Tor des Gartens steht weit offen, als hätte man vergessen, es zu schließen. Ein paar Vögel in den Bäumen zwitschern aufgeregt, fühlen sich durch irgendetwas gestört. Vor dem Gartenzaun sieht sie Holzverschläge, die frisch gestrichen sind, und entdeckt das Gesicht eines kleinen Jungen, der vor einer der hübsch herausgeputzten Hütten kauert. Sie schaut näher hin, betrachtet das blasse Gesicht des Kindes, seine Augen, die starr, wie zwanghaft, auf die Straße gerichtet sind. Regungslos steht der Junge da und es sieht aus, als würde er durch etwas hindurchschauen. Temperamentvoll reibt sie sich die Stirn, sieht wieder zu dem Jungen, der aber plötzlich verschwunden ist. Das Haus liegt vor ihr, zweistöckig, weiß, doch niemand ist zu sehen. Unheimlich! Sie geht ein paar Schritte zur Seite, behält das Gebäude immer im Blick. Kein Schild "Betreten verboten", keine angsteinflößenden Drahtzäune, stattdessen bemerkt sie die imposante braune Eingangstür, die von einem Metallgitter umrahmt wird. Der Krach eines zuschlagenden Fensters dringt ihr ans Ohr. Das muss der Wind gewesen sein, denkt sie, läuft ein paar Schritte, bleibt stehen, biegt in einen mit Kies bedeckten Weg ein. Zaghaft klopft sie an die braune Eingangstür, erst leise, dann lauter. Niemand öffnet, noch immer keine Spur von irgendwelchen Bewohnern. Der Rasen neben dem Kiesweg sieht aus, als hätte ihn vor Kurzem jemand niedergetrampelt. Sie klopft wieder. Nichts! Vielleicht hat sie auch nicht laut genug geklopft, versucht es mit der Faust, geht eine Treppenstufe hinab, bleibt stehen und murmelt "dann eben nicht".
Beeindruckt von dem großen Gebäude beobachtet sie den daneben liegenden Garten, doch das Kind sieht sie nicht mehr. Gestern haben sie in der Schule darüber gesprochen, dass man helfen soll, wenn jemand in Not ist, und sie ist sich sicher, dass der Junge Hilfe braucht. Das Erlebnis mit dem Kind, das nicht älter als drei oder vier Jahre gewesen sein kann, beschäftigt sie noch lange. Sie wirft die Arme in die Luft, geht die Straße entlang, gefolgt von einem weißen Spitz, der ihr seit Minuten nachläuft.
"Ich kann dich nicht mitnehmen", ruft sie dem Tier zu, streicht ihm über den Kopf. Der versteht es, dreht sich um, läuft in eine andere Richtung, verschwindet in einer kleinen Bäckerei und wird dort liebevoll in Empfang genommen, als habe man schon auf ihn gewartet.
In Gedanken sieht sie wieder das Gesicht des Jungen, erinnert sich an den erstarrten, leeren Blick. Während sie sich umschaut, tippelt sie weiter, wäre beim Rückwärtsgehen beinahe gegen einen Laternenmast gelaufen, erreicht das Haus, in dem sie im ersten Stock wohnt. Keuchend betritt sie die kleine Küche, beginnt zu husten, was sich nach einer nicht auskurierten Erkältung anhört. Wenn sie nicht hustet, hört sie ihre Bronchien pfeifen. Nachdenklich schaut sie aus dem Fenster auf die Straße, zu den Häusern. Obwohl es erst Mittag und taghell ist, wirkt die Straße wie ausgestorben und zudem noch so düster, als müsse man erst das Sonnenlicht hineinpumpen. Beklemmend still ist es in diesem Moment.
Es ist früh am Morgen, als sie aus dem Fenster schaut. Fast alle Gebäude sehen gleich aus, sind schon ein halbes Jahrhundert alt. In vielen gibt es nur einen Ofen, der meist mit Kohle befeuert wird. Gedanken belasten sie seit Tagen, meist nachts, heute aber sind sie schon am frühen Morgen da. Manchmal versucht sie, sie durch Lesen zu bezwingen, und wenn sie Glück hat und sich nur tief genug in ein Buch vergräbt, gelingt ihr das auch, denn für ein spannendes Buch vergisst sie schon mal die Welt. Doch heute nicht, sie hat es nach dem Aufstehen versucht, vergeblich! Je heller es wird, desto größer wird ihr Unbehagen. Im Bauch, in der Brust wird es eng, es ist kein Schmerz, eher so ein mulmiges Gefühl. Gedanken wirbeln ihr durch den Kopf und sie sieht schemenhaft den Stiefvater, der sich gerade laut fragt, wo er die Zeitung hingelegt haben könnte. Er ist schlank, sein Gesicht hat etwas Liebenswertes, selbst im Sitzen erscheinen seine Schultern auffallend breit. Ein hochgewachsener Mann, tadellos gekleidet, alles an ihm lässt den Schluss zu, dass er jedes Staubkorn, jeden noch so kleinen Fussel an sich verachtet, immer auf Makellosigkeit bedacht ist. Seine Augen strahlen so braun wie die Mohrenköpfe, die es in den Jahrmarktsbuden jetzt überall zu kaufen gibt.
Etwas steif, mit unbeweglicher Miene, steht er vom Sessel auf, sieht zu Lena herüber, die mit ausgestreckten Beinen, ganz in sich versunken, auf dem Sofa sitzt und vor sich hin summt. Er hebt den Kopf, läuft ein paar Schritte, seine Stimme klingt seltsam verklärt, hat etwas Großväterliches, obwohl sie gar nicht versteht, warum er auf einmal so komisch spricht.
"Lena, was summst du da überhaupt?"
Sie schmettert die Frage mit einer beherzten Handbewegung ab und schweigt. Ob sie seine Frage beantworten könne oder ob das zu viel verlangt sei, will er wissen.
"Ich summe ein Lied, alle haben es gestern in der Schule gesummt, die meisten sogar gepfiffen."
"So, so, gepfiffen, dir ist klar, dass es kein schönes Lied ist."
"Geschmackssache."
Er lächelt, es ist jedoch kein richtiges, eher ein in sich gekehrtes Lächeln. Mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzt sie inmitten brauner weicher Kissen, fasst sich in die Achselhöhle, bemerkt zunächst überhaupt nichts, dann einen leichten Schweißgeruch, der vom Parfum, das sie sich heute Morgen ein bisschen zu großzügig aufgetragen hat, überlagert wird. Vom Fenster aus beobachtet sie wieder die Straße, hat einen hervorragenden Blick auf die gegenüberliegenden Häuser. Es ist eine typische Innenstadtstraße, breit, geradlinig, ist früher vielleicht eine Allee gewesen, von deren einstmaliger Pracht nichts mehr zu sehen ist. Wie ein ozeanischer Strom, der zwei Kontinente voneinander trennt, klemmt sie sich zwischen die beiden Welten, hier ein armes Arbeiterviertel, dort ein Viertel der wohlhabenderen Gesellschaft.
Читать дальше