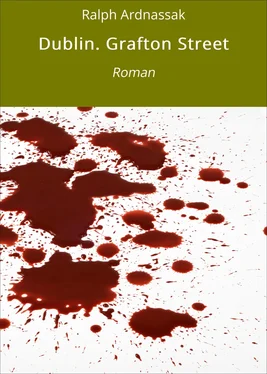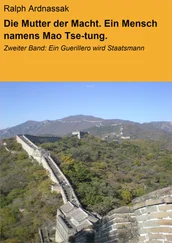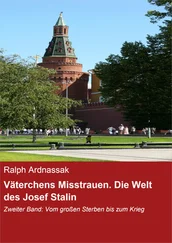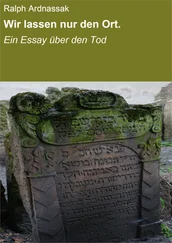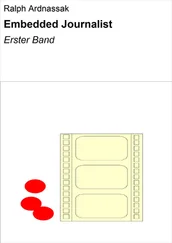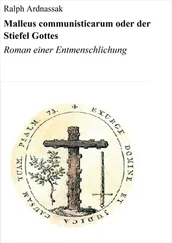Ralph Ardnassak - Dublin. Grafton Street
Здесь есть возможность читать онлайн «Ralph Ardnassak - Dublin. Grafton Street» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Dublin. Grafton Street
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Dublin. Grafton Street: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dublin. Grafton Street»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dublin. Grafton Street — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dublin. Grafton Street», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Demnach ideale Bedingungen für die Ausbreitung der Kartoffelfäule.
Aus Nordamerika gelangte der Pilz nach Europa, wo bereits für den Spätsommer 1845 Ernteausfälle bei Kartoffeln für die Niederlande, Belgien und Frankreich vorhergesagt wurden.
Ab August erkannte man auch in England Pflanzenschäden. Im September ließen in Irland Blattverfärbungen der Kartoffelpflanzen darauf schließen, dass auch die dortige Ernte betroffen sein könnte. Man hoffte jedoch darauf, dass der weitaus größte Teil nicht befallen sein würde.
Mit Beginn der Erntezeit, im Oktober, wurde jedoch offenbar, dass de facto die gesamte Kartoffelernte des Jahres vernichtet worden war.
Wo immer Menschen Not leiden und hungern, da ist die Politik gefordert, denn schließlich ist sie kein Selbstzweck, sondern dafür ins Leben gerufen, das Dasein der Menschen zu organisieren und erträglich zu gestalten, Leid abzumildern und Elend zu lindern, so zumindest sagt es die Theorie.
Die wirtschaftspolitische Maxime jener Zeit war das Prinzip des laissez-faire, wonach der Staat sich so wenig, als nur möglich, in wirtschaftliche Entscheidungen, in den Handel und die Regularien der Verteilung von Nahrungsmitteln einzumischen hatte.
Sinnvoll und angebracht wären wirtschaftspolitische Entscheidungen gewesen, die sich bereits bei früheren Missernten als zweckmäßig erwiesen hatten, wie beispielsweise ein Verbot des Exportes von irischem Getreide oder die Einschränkung der üblichen Destillation von Lebensmitteln zu Alkohol. Allein diesmal, unter der Ägide des laissez-faire, unterblieben solche wirtschaftspolitischen Entscheidungen vollständig.
Die europaweiten Missernten hatten gegen Ende der 40-er Jahre des 19. Jahrhunderts zu einer signifikant steigenden Nachfrage nach Weizen geführt und während viele europäische Länder unter dem Eindruck drohender Hungersnöte nun den Export von Lebensmitteln einschränkten oder sogar vollständig unterbanden, exportierten Irland und Großbritannien nun weit mehr Weizen als in den Jahren zuvor.
Während Hunderttausende Iren im Lande verhungerten, wurden während der fünfjährigen Notzeit gewaltige Mengen an Lebensmitteln außer Landes und nach England verbracht.
Der britische Premierminister Sir Robert Peel, 2. Baronet Peel of Clanfield, der als Begründer der Konservativen Partei gilt, ergriff im November 1845 zögerlich Gegenmaßnahmen, indem er ohne Zustimmung des Kabinetts für 100.000 britische Pfund Mais in den Vereinigten Staaten orderte. Dieser Mais sollte in Irland zu Selbstkosten verkauft werden. Tatsächlich jedoch wurde dieser Mais auf Anweisung der staatlichen Relief Commission zu Marktpreisen angeboten, so dass kaum ein Ire sich dieses Nahrungsmittel tatsächlich leisten konnte.
Die Relief Commission führte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ein und koordinierte diese, während in der politischen Landschaft Großbritanniens ein Streit um die Abschaffung der Einfuhrzölle für Getreide, die sogenannten Corn Laws, entbrannte.
Als schließlich für das Jahr 1846 eine noch weitaus schlechtere Kartoffelernte prognostiziert wurde, konnte Premierminister Peel endlich die Abschaffung der Corn Laws durchsetzen, verlor jedoch die Unterstützung seiner Partei, so dass die regierende Tory-Partei durch die Whigs abgelöst wurden und John Russell, ein entschiedener Protagonist und Befürworter des laissez-faire, zum Premierminister gewählt wurde.
Die Whigs ignorierten das Hungersterben in Irland und fürchteten stattdessen eine zunehmende Abhängigkeit Irlands von Subventionen und staatlichen Hilfen.
Viele radikale Anhänger des Freihandels hatten inzwischen Sitze im britischen Parlament gewonnen, wo sie mit Nachdruck für eine Reduzierung der Staatsausgaben zu Gunsten des notleidenden Irlands votierten. Auf ihr Betreiben hin wurde die Relief Commission schließlich abgeschafft und Irland allein für die Finanzierung sämtlicher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen verantwortlich gemacht.
Das Wetter des Jahres 1846 gestaltete sich überaus ungünstig, so dass nun nicht mehr nur die Kartoffel-, sondern auch die Weizen- und die Haferernte schlecht ausfiel.
Ungeachtet dessen waren die kleinen irischen Pächter dazu verpflichtet, weiterhin die volle Pachtsumme zu entrichten und dazu Getreide und Vieh verkaufen, das nach England abtransportiert wurde.
Zeitgenossen berichteten davon, dass auf jedes Schiff, das Nahrungsmittel nach Irland brachte, mehrere Schiffe kamen, die Nahrungsmittel unter militärischer Bewachung aus Irland ausführten.
Pächter, die nicht mehr in der Lage waren, ihre Pachtsumme zu entrichten, wurden von Grund und Boden vertrieben, häufig wurden ihre Häuser abgerissen oder verbrannt.
Eine große im Auftrag der britischen Landlords angeordnete polizeiliche Vertreibungsaktion war „Ballinglass Incident“, wobei die etwa 300 Einwohner des irischen Dorfes Ballinglass, obwohl sie in der Lage gewesen wären, die Pacht zu entrichten, auf Betreiben der Großgrundbesitzerin Mrs. Gerrard, die auf den Ländereien eine Viehfarm errichten wollte, durch Polizei und Armee von ihren Ländereien vertrieben und ihre Häuser und Anwesen demoliert wurden. Den Nachbarn war verboten worden, den Vertriebenen Obdach zu gewähren.
So erging es Abertausenden.
Zwar war auch in Irland das englische Armengesetz „Poor Law“ seit 1838 offiziell eingeführt worden, jedoch sah dieses Gesetz keinerlei direkte materielle Hilfe für die Hungernden und Notleidenden vor.
Allein in den fürchterlichen „Work houses“, den Armenhäusern, konnten die Betroffenen unterkommen, wobei diese allerdings mehr Gefängnissen oder Todeslagern glichen.
Mit voller Absicht abschreckend eingerichtet, sollten sie Bedürftige eher verschrecken und davon abhalten, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Seit 1847 musste Irland nun selbst für seine Armenhäuser aufkommen, mit der Konsequenz, dass die ansteigende Flut der Insassen nun permanent unterernährt war und dabei noch härteste körperliche Arbeiten verrichten musste.
Unter entsetzlichsten hygienischen Bedingungen grassierten Seuchen in den Armenhäusern, deren Todesrate nun bei annähernd 5 Prozent der Insassen lag.
Das Frühjahr 1847 brachte starke Schneefälle, die das Überleben der geschwächten Bevölkerung immer weiter erschwerten. Der Typhus grassierte und der größte Teil der irischen Bevölkerung war derart geschwächt, dass er nicht mehr in der Lage war, einer geregelten Arbeit nachzugehen, um sich die staatliche Unterstützung zu verdienen. Überall im Lande, an Sümpfen und Tümpeln, an Straßen, Gassen und Wegen und auf den Feldern, lagen Sterbende, für die jedwede Art von Hilfe zu spät gekommen wäre.
Um Kosten zu sparen, beendete die britische Regierung im Frühjahr 1847 die staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, war jedoch entgegen ihrer Absicht auf Grund der hohen Todesraten dazu gezwungen, nun staatliche Suppenküchen in Irland einzurichten.
Im Sommer nahmen etwa 3 Millionen Menschen diese Suppenküchen in Anspruch, um zu überleben.
Der Leiter des britischen Schatzamtes, Sir Charles Trevelyan, erklärte die Hungersnot im September 1847 offiziell für beendet und stellte die Kreditvergabe an die Suppenküchen ein. Dessen ungeachtet ging das Elend weiter.
Auch 1848 und 1849 fielen die Kartoffelernten aus. Bereits im Jahre 1848 versuchte eine Bewegung unter William Smith O’Brien und Charles Gavan Duffy, die sich „Junges Irland“ nannte, die Unabhängigkeit von Großbritannien zu erkämpfen. Schlecht organisiert und mangelhaft ausgerüstet wurde der Aufstand rasch militärisch niedergeschlagen und beendet.
Das Ende der irischen Hungersnot mag zwischen 1849 und 1851 eingetreten sein, die Armut und die politischen Folgen waren mit dem Ende des Sterbens jedoch keineswegs beendet.
Neben den schätzungsweise fast 2 Millionen Iren, die auf den sogenannten coffin ships ,„Sargschiffe“, geplagt von Krankheiten und Seuchen nach Nordamerika oder Australien ausreisten, zog es zahlreiche Iren in die großen Industriezentren Englands und Schottlands.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Dublin. Grafton Street»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dublin. Grafton Street» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Dublin. Grafton Street» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.