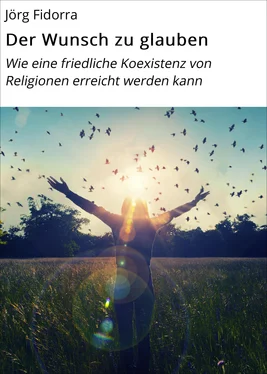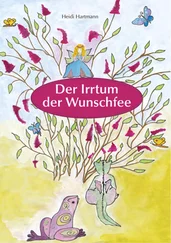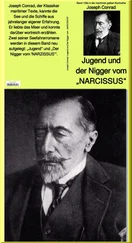Trotzdem wird im Folgenden die Evolutionslehre als Grundlage für die Erklärung des Auftretens von Spiritualität und Religion herangezogen, weil diese Lehre sich eben auch mit den neurowissenschaftlichen Befunden verträgt.
Mit einer evolutionsgeschichtlichen Betrachtung soll versucht werden, die Hintergründe für das Entstehen eines Gottesglaubens und von Religionen aufzudecken, um damit ein Verständnis gegenüber allen Religionen zu wecken. Mit diesem Ansatz wird die Hoffnung verbunden, das Verständnis für die Einflussgrößen, die bei der Entstehung verschiedener Religionen eine Rolle gespielt haben, zu wecken und damit einen Beitrag für einen Entspannungsprozess zwischen den verschiedenen Religionen zu liefern. Aufforderungen nach einem Dialog zwischen den Religionen, wie sie immer wieder und vor allem in jüngster Zeit erhoben wurden [31], soll mit dieser Abhandlung eine zusätzliche Stütze gegeben werden, indem der evolutionsgeschichtliche Hintergrund hervorgehoben wird. Allerdings ist einzuräumen, dass ein Diskussionsprozess unter den Religionen erst nach einer längeren Phase reformerischer Bemühungen von Erfolg gekrönt sein dürfte.
Spirituelle und religiöse Grundlagen
Die früheste Phase in der evolutionsgeschichtlichen Entwicklung des Menschen, nämlich als die Schwelle vom Tier zum Menschen überschritten wurde, stellt auch heute noch, lange nach der Veröffentlichung der Darwinschen Lehre, ein unbekanntes Entwicklungsstadium dar, das auf absehbare Zeit noch lange auf seine Enträtselung warten wird. Weder sind die biologischen, und damit insbesondere die genetischen Modifikationen, die zur Menschwerdung geführt haben, noch die damals vorherrschenden Einflussgrößen der Umwelt hinreichend bekannt. Nach der Darwinschen Lehre beruhen die bekannten Daseinsformen einer Art auf einer Variation der Spezies selbst, und das bedeutet nach heutigem Verständnis: auf Mutationen in der Erbsubstanz dieser Spezies.
Eine Rekonstruktion der frühesten menschlichen Entwicklungsschritte, die nur auf dem heutigen Wissensstand beruhen kann, geht von einer Rückextrapolation von den bisher bekannten geologischen und klimatischen Veränderungen auf die damals vorherrschenden Umwelteinflüsse aus, denen die Menschwerdung über viele Entwicklungsstufen ausgesetzt war. Ein Nachzeichnen der möglichen relevanten Entwicklungsschritte unter den damaligen vorherrschenden Bedingungen beruht daher auf sehr allgemeinen Annahmen, denen nur wenig gesicherte prähistorische und paläologische Befunde zugrunde liegen.
In der nachfolgenden Betrachtung wird jedoch nicht die gesamte Menschwerdung, sondern es werden vornehmlich die Einflussgrößen, die auf die Entwicklung des menschlichen Gehirns eingewirkt haben können. in den Fokus gestellt, wobei die neuesten Erkenntnisse aus der neurobiologischen und kognitionswissenschaftlichen Forschung Berücksichtigung finden sollen.
Zunächst soll die mögliche Lebenssituation der frühen Menschen, soweit sie für die hier gewählten Aspekte von Bedeutung ist, nachgezeichnet werden.
1.1 Spirituelle Vorstellungen
Die Menschwerdung beginnt nach allgemeinem Verständnis mit der Entwicklung der Sprachfähigkeit. Bereits die „Vorläuferversionen“ des Menschen bargen das Potential zur Sprachfähigkeit. Sie bildet das herausragende Merkmal eines Menschen, das ihn von allen anderen Lebewesen auf unserer Erde unterscheidet. Die Entwicklung eines Sprachvermögens scheint bisher nur der menschlichen Spezies vorbehalten geblieben zu sein und stellt damit eine Besonderheit in der gesamten belebten Natur dar.
Da nach der Darwinschen Lehre alles in der belebten Welt aus Vorformen hervorgegangen ist, erhebt sich die Frage, ob es auch für die Sprache eine Vorform gibt oder gegeben hat. Ein Blick in die Tierwelt zeigt in der Tat eine Reihe von Beispielen, die eine Vorform des Sprachvermögens darzustellen scheinen. Bekannt sind die wunderschönen Melodien, die einige Vogelarten beherrschen. Warn- und Weckrufe vieler Vögel dienen einer einfachen Kommunikation, um nur einige Beispiele zu nennen. Papageien können Klanggebilde sehr gut nachahmen, und ihre situationsbezogenen Wortgruppen sorgen regelmäßig für Heiterkeit. Eine Vogelart, die die Bezeichnung Leierschwanz trägt, ist im Nachahmen von Geräuschen so perfekt, dass sie sogar das Geräusch einer Kettensäge imitieren kann. Aber es sind nicht nur Vögel, die akustisch Informationen austauschen. Auch Säugetiere, zu denen schließlich auch der Mensch gehört, verfügen über die Fähigkeit, sich mit gesangsähnlichen Lauten über große Entfernungen zu verständigen. Markante Beispiele für eine akustische Verständigung unter Säugetieren sind bekanntlich die Delphine und Wale. Akustische Signale spielen zudem bei vielen Tieren eine wichtige Rolle bei der Partnerwahl und bei der Aufzucht von Jungtieren.
Angesichts dieser Tatsachen stellt sich die Frage, ob nicht diese Fähigkeiten einer Klangerzeugung die Vorform eines Sprachvermögens darstellen. Damit würden die Sprachanfänge auf eine gesangsähnliche Ausdrucksform zurückgehen. Schließlich ist der Gesang ein elementares Kommunikationsmittel, das über alle Sprachbarrieren hinweg Verständigung ermöglicht, Emotionen weckt und zum Mitsingen anregen kann.
Nach Johansson soll sich die Sprache des Menschen vor etwa zwei Millionen Jahren entwickelt haben [20]. Dabei bleibt unbestimmt, ob bereits das Aussprechen sinnbehafteter Einzelworte als Sprache zu bezeichnen ist. Für die Existenz als Jäger und Sammler ist eine ausgeprägte Sprache nicht unbedingt erforderlich, wie die Beispiele aus der übrigen Tierwelt belegen. In Rudeln jagende Löwen oder Wölfe beispielsweise verständigen sich auch ohne irgendwelche Lautsignale. In der Brutpflege von Jungtieren dagegen spielen Lautsignale sehr wohl eine wichtige Rolle, ohne die ein Kontakt mit dem Muttertier nicht gewährleistet ist.
Die anatomischen Voraussetzungen zur Ausbildung eines Organs, das Sprache hervorbringen kann, sind zweifellos in der Erbsubstanz codiert. Gleichzeitig muss dort aber auch die genetische Information gespeichert sein, die dazu befähigt, eine systematische Anordnung von Worten und Sätzen zu konstruieren. Fehlt eine neurologische Weiterentwicklung in diesem Zusammenhang, wie es etwa bei Papageien der Fall zu sein scheint, so bleibt nur die Fähigkeit zur Imitation von Klängen und Geräuschen bestehen.
Wenn Sprachfähigkeit und Bewusstsein einander bedingen, so müsste die Ausprägung eines Bewusstseins ebenfalls von der Erbsubstanz her bestimmt sein. Die Ausprägung eines Sprechapparates und die Entwicklung einer zugehörigen Gehirnarchitektur, die im Stande ist, Laut- und Wortgebilde zu koordinieren, müssen daher in der Erbsubstanz festgelegt sein. Somit ist davon auszugehen, dass mit der Ausbildung eines Sprachzentrums im Gehirn nach heutigem Kenntnisstand auch eine Entwicklung des Bewusstseins, wenn nicht eingesetzt, so doch gefördert wurde. Allerdings scheint es Einschränkungen zu geben. Studien an höher entwickelten Tieren, wie etwa Raben, Menschenaffen und Delphinen, dokumentieren, dass auch bei diesen der Ansatz eines Bewusstseins vorzuliegen scheint, ohne dass gleichzeitig eine Sprachentwicklung stattgefunden hat [2]. Demnach wäre die Ausbildung eines Bewusstseins nicht zwingend mit einer gleichzeitigen Sprachentwicklung verknüpft, wie ursprünglich angenommen wurde [15]. Das Bewusstsein scheint umgekehrt eher die weitere Ausprägung der Sprachfähigkeit zu begünstigen, sobald die anatomischen Voraussetzungen für die Ausbildung eines Sprechapparats geschaffen sind.
Ab dem Zeitpunkt, ab dem sich Sprachvermögen und Bewusstsein ausgebildet hatten, dürfte sich die Ausdrucksfähigkeit aufgrund von Lernprozessen, die sich bei der Ausübung handwerklicher Tätigkeiten ergeben, ständig verbessert haben. Zu den ersten wichtigsten handwerklichen Tätigkeiten gehören sicherlich die Herstellung von Werkzeugen und das Beherrschen des Feuers.
Читать дальше