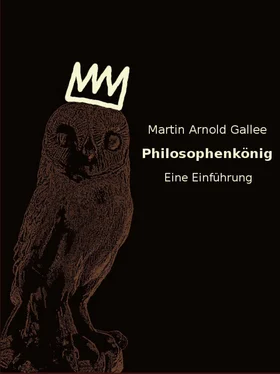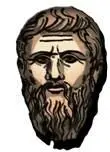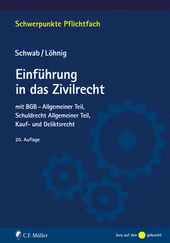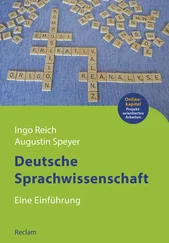was fromm, unfromm, edel, unedel, gerecht, ungerecht sei, was Besonnenheit, Tollheit, Tapferkeit, Feigheit sei, auch, was ein Staat, ein Staatsmann, eine Regierung und ein Regent sei. [41]
Mit dieser beständigen Nachfrage „was jedes Ding sei” [42]verunsicherte Sokrates seine Gesprächspartner regelmäßig – wenn sie denn die Frage überhaupt verstanden. In nicht wenigen Fällen, etwa im Euthyphron , bekommt Sokrates als Antwort nämlich den Verweis auf Beispiele und Einzelfälle. So beantwortet Euthyphron die Frage, was fromm sei, auf die folgende Weise: „Ich sage eben, dass fromm ist, was ich jetzt tue, den Übeltäter nämlich […] zu verfolgen” [43]!. Das aber, so macht ihm Sokrates klar, verfehlt den Sinn der Frage völlig: „Du hast mich […] nicht hinlänglich belehrt auf meine Frage, was wohl das Fromme ist , sondern du sagtest mir nur, genau das sei zufällig fromm, was du jetzt tust” [44]. Um aber das überhaupt sagen zu können, so Sokrates, muss man bereits wissen, was das Fromme an sich ist – und genau darum geht es ihm.
Der tiefere Sinn des Sokratischen Fragens ist, das hatten wir oben gesehen, praktischer Natur: Dem Gesprächspartner soll klar werden, dass er noch nicht einmal erklären kann, worin eigentlich der thematische Bereich dessen besteht, über das er sich gerade äußert. In diesem Einsehen des eigenen Nichtwissens, dieser Reflexion also, besteht für Sokrates der erste Schritt zum wahren Wissen [45]!. Sein beständiges Fragen nach der Sache selbst ist – so könnte man aus heutiger Sicht sagen – das theoretische Mittel zu einem praktischen, lebensweltlichen Zweck: dem Einsehen des eigenen Nichtwissens und dem sich Öffnen für das Wissen um das Gute und Wahre.
Das Problem besteht nun darin, dass weder Platon noch Aristoteles dieses vorwiegend praktische Interesse ihres Lehrers in ihren jeweiligen Darstellungen respektiert haben, sondern ihn als wesentlich theoretischer und abstrakter ausgerichteten Philosophen portraitieren. Dabei stimmen beide darin überein, es sei Sokrates nicht etwa um Einzelfälle, sondern das damit im Zusammenhang stehende Allgemeine gegangen. Sie unterscheiden sich aber deutlich in ihren Meinungen, was dieses Allgemeine genau ist.
Dabei bringt Platon schon recht früh, nämlich im Euthyphron , vorsichtig seine eigenen Gedanken ins Spiel, insofern er Sokrates im Rahmen von dessen Frage nach dem Frommen und Unfrommen die Worte in den Mund legt, „dass alles, was unfromm sein soll, soviel nämlich seine Unfrömmigkeit betrifft, eine gewisse Gestalt hat” [46]. Dabei wird sich die griechische Entsprechung von ‚Gestalt’ – idea – in der Folge zu einem der wichtigsten Begriffe der Philosophiegeschichte entwickeln. Was es genau mit der platonischen Ideenlehre auf sich hat, werden wir im nächsten Kapitel untersuchen, hier ist zunächst einmal relevant, in welcher Hinsicht Platons Darstellung von Sokrates und seinem Denken abweicht. In diesem Zusammenhang gehört es zu den Besonderheiten der philosophisch einmaligen Athener Konstellation, dass die Frage der Adäquatheit der Darstellung von Sokrates durch Platon auch von einem Schüler Platons erläutert wird – der aber eben selbst philosophische Ambitionen hat und Platon nicht zuletzt deshalb hinsichtlich seines Umgangs mit Sokrates kritisiert, weil er sich als dessen wahren Schüler und Bewahrer seiner Gedanken präsentieren will: Aristoteles.
Dabei basiert die generelle Stoßrichtung der aristotelischen Kritik an Platon und seinem Verständnis des Allgemeinen auf einer bestimmten Perspektive, die Aristoteles auf das Werk seines Lehrers hat. Die Kritik, die Aristoteles an der Ideenlehre Platons übt, beinhaltet vor allem den Vorwurf der unangemessenen Vereinnahmung von Sokrates, der das Allgemeine aus Sicht von Aristoteles nicht als jenseitige Sphäre verstanden hat: „Sokrates setzt […] das Allgemeine […] nicht als abgetrennte Wesenheiten an; die Anhänger der Ideenlehre aber trennten es und nannten es Ideen der Dinge” [47]. – Allerdings gibt auch Aristoteles bei der Darstellung von Sokrates und seinem Denken kein glückliches Bild ab. Denn er interpretiert das Allgemeine, um das es diesem ging, schlicht als Begriffe und behauptet, Sokrates habe sich vor allem um deren Sinn Gedanken gemacht. Der Moralphilosoph Sokrates war hingegen nicht an der Begriffstheorie interessiert, sondern letztlich nur an einem: der Praxis des Handelns in der menschlichen Lebenswelt. Die immer aggressiver werdenden Reaktionen von dort sind wohl auch vor keinem anderen Hintergrund wirklich erklärbar.
Gerade diese Gebundenheit an seine Lebenswelt macht aber auch klar, wo die Grenzen dessen liegen, was uns Sokrates heute noch zu sagen hat. Denn, um es sehr milde auszudrücken: Seine Lebenswelt ist nicht mehr die unsere. Und wir bekommen in einer Welt, in der sich verschiedene Kulturen und Lebensentwürfe unversöhnlich gegenüberstehen, einen (immer noch vergleichsweise schwachen) Einblick in das, was uns als Menschen oder auch als Bürger vom Gründer der Disziplin trennt, die wir trotzdem auch als die unsere ansehen. Das gilt umso mehr, als Sokrates sich – in unserer Terminologie – als praktischer Philosoph verstand, der auf das Leben und Handeln seiner Mitmenschen Einfluss nehmen wollte.
Man hat gerade bei den unzähligen philosophisch geprägten Einlassungen zum heutigen Zustand der Welt manchmal den Eindruck, als stünde das Athen des Sokrates tatsächlich als Alternative zur unübersichtlichen und, sagen wir, suboptimalen Situation des hier und jetzt zur Diskussion. Und eine solche Haltung kann nur aus dem mangelnden Wissen darüber resultieren, was als breiter Konsens in der Antike auch von Sokrates geteilt wurde – von der Beschränkung des Wahlrechts auf eine kleine Minderheit über die Legitimität der Haltung von Sklaven bis hin zu der Klassifikation von Frauen als gegenständliche Dinge. – Kurz: Was uns Sokrates heute noch zu sagen hat, beschränkt sich auf die Philosophie, und dabei sollten wir es auch belassen. Zumal das, wie wir in diesem Kapitel gesehen haben, alles andere als wenig ist und wir uns darüber hinaus bei dem Versuch, ihn als Philosoph zu verstehen, durch die Notwendigkeit, unser eigenes Vorverständnis explizit zu machen, auch immer ein Stück weit selbst den Spiegel vorhalten. Und genau darin sieht auch Platon, zu dem wir jetzt kommen, ein ganz wesentliches Element der Philosophie seines Lehrers:
Du scheinst eines gar nicht zu wissen: Wer der Rede des Sokrates ganz nahe kommt […], wird von ihm unvermeidlich […] so lange ohne Ruhe in der Rede herumgeführt, bis er dahin gerät, dass er über sich selbst Rechenschaft ablegen muss […]. [48]
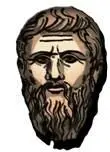
Platon (427 – 347 v. Chr.)
An Platons Lebensdaten ist zu erkennen, dass er zum Zeitpunkt des Todes von Sokrates noch ein junger Mann war. Er hatte seinen Lehrer etwa acht Jahre lang begleitet, dessen Hinrichtung stellte für ihn ohne jeden Zweifel ein traumatisches Erlebnis dar. Es sollte nicht die einzige Enttäuschung in seinem langen Leben bleiben, wenn auch die größte. Und ganz abgesehen von dem persönlichen Schmerz, den Platon aufgrund des Todes seines Lehrers erlitten haben mag, haben ihn sowohl dieses Ereignis als auch dessen Umstände nicht zuletzt als Philosoph geprägt. Die von Platon aus dem Tod von Sokrates gewonnene Einsicht, die sein gesamtes Werk bei allem Facettenreichtum durchzieht, lautet: Mit dieser Welt stimmt etwas nicht.
Das ist zunächst einmal ganz nahe liegend auf die politischen Verhältnisse in Athen zu beziehen, denen Platon denn auch umgehend für über zehn Jahre entfloh, bevor er im Jahr 387 zurückkehrte und seine berühmte Akademie gründete. Es ist aber noch wesentlich mehr als das gemeint. Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, bilden die für uns heute getrennten Bereiche der Gesellschaft und des Staates in der griechischen Antike noch eine Einheit. Die moderne, erst von Thomas Hobbes (1588‐1679) eingeführte Unterscheidung zwischen Mensch und Bürger ist für Platon folglich genauso wenig relevant wie die zwischen Ethik und Politik. Der Schritt von der Verurteilung der politischen Zustände in Athen (und ganz grundsätzlich aller Staaten, wie er in seinem Siebten Brief erklärt) zu einem Denken, das die Welt überhaupt als im Verfall befindlich ansieht, ist für einen in der griechischen Antike beheimateten Philosophen wie Platon also wesentlich kleiner, als er uns heute erscheinen mag. Und auch wenn die diesbezügliche Gleichsetzung von Athener polis und der Welt insgesamt (wie alle kulturellen Selbstverständlichkeiten) in den Schriften Platons nicht explizit auftaucht, durchzieht seine pessimistische Sicht der Dinge Platons gesamtes Werk. – Dabei belässt er es allerdings nicht bei der Feststellung des Verfallens der Welt, sondern sucht darüber hinaus nach Lösungen hinsichtlich der Frage, wie der Mensch einer solchen zerfallenden Welt gegenüber tritt und treten sollte. Sein Erfolg als Philosoph verdankt sich stark diesem therapeutischen Gesichtspunkt.
Читать дальше