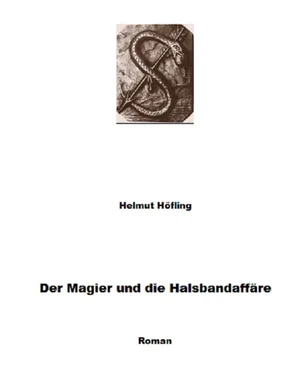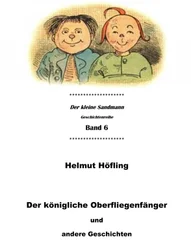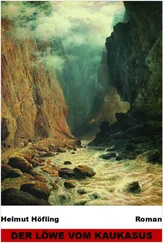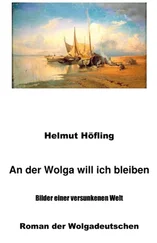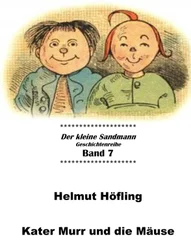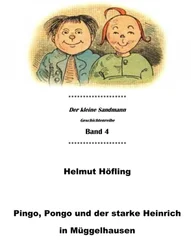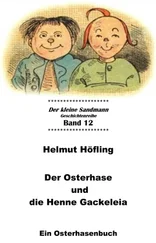Bis in die höchsten sächsischen Hofkreise hinein fand Schrepfer Anhänger, mit denen er seine Geisterzitationen betrieb, wobei ihm die Kunst des Bauchredens wie auch die stark benebelten Sinne seiner Gäste sehr zustatten kamen, die, nachdem er sie vorher tagelang hatte fasten lassen, nun reichlich mit Punsch bewirtet wurden. Im Übrigen wirkte er auf die Einbildungskraft seiner Schäflein durch die gewöhnlichen Taschenspielereien und mit dem dazu gehörigen Hokuspokus. Skeptiker, denen es gelungen war, sich unerkannt in den Kreis der Wundergläubigen einzuschleusen, beobachteten allerdings, wie die zitierten Geister gleich sterblichen Menschen die Klinke drückten, wenn sie durch die Tür eintraten, statt nach altem Geisterbrauch einfach durch Türen oder Wände ins Zimmer zu schweben - ja sie sahen sogar ganz deutlich einen schwangeren Geist zu einer Zeit, als - welch eine wunderbare Duplizität der Ereignisse! - Schrepfers Frau gesegneten Leibes war. Bei einer anderen Gelegenheit hatte ein Spaßvogel heimlich die Tür zugeriegelt, so dass trotz aller beschwörenden Rufe des Magiers der Geist zwar verzweifelt an dem Schloss drehte, um dennoch zu erscheinen, letztlich aber draußen bleiben musste.
Sobald Schrepfer durch die guten Beziehungen zu den einflussreichsten Persönlichkeiten Sachsens fest im Sattel saß, darunter Graf Brühl, Hofprediger Stark, Minister von Wurmb sowie der Herzog von Kurland, ein Sohn des Kurfürsten von Sachsen, gab er sich als Bastard des Herzogs von Orleans aus und trat unverfroren als französischer Oberst auf. Auch ließ er nun verlauten, er habe einen Teil des Gesellschaftsvermögens des aufgelösten Jesuitenordens in Verwahrung, einen Betrag von rund einer Million Reichstalern in sächsischen Staatspapieren, die als Paket in einer Frankfurter Bank deponiert sei. Nach einem Vertrag mit Minister von Wurmb sollten die höchsten Staatsbeamten daraus eine Gehaltszulage erhalten - für gute jesuitenfreundliche Arbeit. Doch dazu kam es erst gar nicht: Unter merkwürdigen Umständen erschoss sich Schrepfer in Leipzig, und sein in Frankfurt am Main hinterlegtes Paket enthielt nur leeres Papier, was die Frage aufwarf, ob er wirklich ein Agent der Jesuiten gewesen war oder sich nur für seine Schwindeleien dafür ausgegeben hatte. Kennzeichnend für die geistige Verwirrung so vieler Menschen war es, dass gleich nach seinem Selbstmord das Gerücht aufkam, man habe die Kugel gefunden, die er sich in den Mund geschossen habe, jedoch keine Verletzung festgestellt. Die höheren Geister, unter deren Schutz er stand, hätten ihn „entrückt“.
Der Boden war also gut beackert, als Cagliostro drei Jahre später in Leipzig auftauchte. Der Unsinn von dem vermeintlichen wahren Geheimnis, das Schrepfer angeblich besessen hatte, saß als fixe Idee in den Köpfen unzähliger Menschen und war auch weiterhin in den tonangebenden Gesellschaftskreisen so weit verbreitet, dass nun auch Cagliostro es leicht hatte, seine dreisten Schwindeleien darauf zu gründen wie sein toter Schrittmacher. Trotz dessen unrühmlichen Endes war die Begierde nach den Mysterien noch nicht erloschen. Die Brüder von der strengen Observanz, die sich ihm im Gasthof vorstellten, erkannten bald, welch außerordentlichen Mann voll tiefer Kenntnisse ihnen das Schicksal gesandt hatte. Natürlich trug Cagliostro auch das Seine dazu bei, indem er sich in ihrer Gesellschaft das Ansehen einer wichtigen Persönlichkeit zu geben verstand und mit seinem außerordentlichen Wissen in der Alchimie prahlte. Beim Festessen, das ihm zu Ehren von der Loge Minerva zu den drei Palmen gegeben wurde, achteten die Leipziger Freimaurer sorgfältig darauf, dass ihrem Ritus gemäß die Dreifaltigkeit gewahrt wurde: Flaschen, Schüsseln, Gläser und anderes mehr standen auf der Tafel immer zu dritt nebeneinander.
Bei Tisch wurde auch die Logensitzung abgehalten, was Cagliostro dazu nutzte, gegen die Ruchlosigkeit der Ordensbrüder zu eifern, die sich mit Zauberkünsten abgaben, und prophezeite ihnen, ihr Oberer werde noch vor Ablauf eines Monats von Gott abberufen, falls sie nicht von ihrer unheilvollen Neigung abließen. In erbaulichen Reden stellte er ihrer entarteten Freimaurerei sein ägyptisches Lehrgebäude entgegen und ermahnte sie, künftig nur auf diesem Pfad zu wandeln.
Seine Saat schien aufzugehen, zu seiner Freude auch auf einem Nebenacker, denn bei seiner Abreise fand er im Gasthof seine Rechnung schon durch seine bewundernden Anhänger bezahlt, und außerdem gab ihm ein Leipziger Bruder noch einen höheren Geldbetrag mit auf den Weg.
In Berlin, wo er bald darauf eintraf, hielt er sich entgegen seiner ursprünglichen Absicht nur kurze Zeit auf. Denn da die dortigen Logen unter dem Schutz des Preußenkönigs standen, wagte er nicht, die Berliner Freimaurerei nach seinem ägyptischen System zu erneuern.
Dagegen besuchte er in Danzig alle Logen der strengen Observanz und sprach, wie gewohnt, stundenlang von der Reinigung der Freimaurerei durch seinen ägyptischen Ritus, wobei Gott ihn leite. Seine Vorträge, in die er hin und wieder gelehrt klingende Brocken aller geistlichen und weltlichen Wissenschaften streute, irgendwann aufgeschnappt oder angelesen, wurden zwar nicht immer voll verstanden, aber dennoch mit allgemeinem Beifall aufgenommen.
Guten Muts reiste Cagliostro weiter nach Osten, der Hauptstadt des russischen Riesenreiches entgegen, wo er sich schon in den Palästen der reichen Großen ein und aus gehen sah und vor allem im vertrauten Gespräch mit der erhabenen Zarin. Dort in Petersburg hoffte er den rechten Wirkungskreis für seine Taten zu finden.
Einen Dämpfer erhielt er jedoch im preußischen Königsberg, wo er am fünfundzwanzigsten Februar 1779 im Gasthaus Schenk in der Kehrwiederstraße abstieg. Obwohl der Fremdenanzeiger die Ankunft des Grafen Cagliostro und seiner Gemahlin meldete, erregte er nicht die erwartete Aufmerksamkeit. Gewiss, man hatte von ihm gehört, kannte ihn jedoch noch zu wenig. In einer Universitätsstadt, in der ein so weltberühmter Denker wie Immanuel Kant lehrte, war, wie der Apostel des ägyptischen Ritus schmerzlich einsehen musste, die philosophische Luft seinem System nicht zuträglich. Da er kein Wort Deutsch verstand, kam er auch nicht mit dem Volk in Berührung, und auf die wenigen Vornehmen, die ihn zu Hause empfingen, machte er nicht den erhofften Eindruck.
Der Kerl sei wahrhaftig ein verkleideter Diener, fand Kanzler von Korff, der in Königsberg durch seine Urteile den Ton angab. Man dürfe ihm nicht über den Weg trauen, was immer er einem auch vorschwatze. Die Gesellschaft, an die er sich wandte, nickte ihm beifällig zu, und wer den fremden Grafen schon von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, der steuerte sein Teil dazu bei: Zwar könne er nichts dafür, dass er klein, wohl aber dafür, dass er dick sei, und ob Bauch hin oder Bauch her, die gedrungene Stirn, die dicken, runden Lippen, die so seltsam auseinandergerissen seien, die trübschimmernden, stets rollenden Augen, schielte er nicht gar ein bisschen...? Kein Körperteil von Kopf bis Fuß blieb unerwähnt, und auch das wenige, woran sie nichts auszusetzen hatten, vermochte nicht den Eindruck zu verwischen, dass sein Äußeres genauso wenig anziehend war wie sein Benehmen. Auch von seinem angeblichen Grafentitel oder was er sonst vorgab zu sein, wollte Kanzler von Korff nichts wissen, er hielt ihn eher für einen Jesuiten oder zumindest ihren Emissär. Man höre ja so mancherlei von ihnen, seitdem der Papst ihren Orden vor wenigen Jahren aufgehoben hatte. Mit dem Todesurteil gegen die Gesellschaft Jesu sei ihre Macht noch nicht gebrochen, die Jesuiten sollten unterirdisch weiter wühlen, wie es hieß. Man müsse auf der Hut sein, dass sie es nicht zu bunt trieben.
Die Jesuitenfurcht, so maßlos übertrieben sie auch war, hatte sich in den Köpfen so fest eingenistet, dass man den Tod von Papst Clemens XIV., dreizehn Monate nach Aufhebung des Ordens, als Racheakt der Jesuiten ansah, die den Heiligen Vater vergiftet hätten. Um ihren Einfluss aufs Neue zu begründen, unterstützten und förderten sie die geradezu krankhafte Hinneigung zur Mystik, begründete ein protestantischer Pastor seine Ablehnung. Der Glaube an die neue Magie, die okkulte Richtung der Geheimgesellschaften sei ihren Zwecken sehr dienlich, denn in der dünnen Höhenluft rationalistischer Denkart könnten jesuitische Pläne nicht gedeihen.
Читать дальше