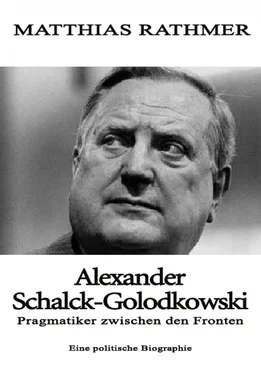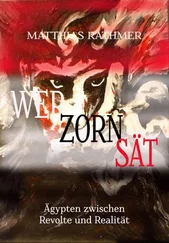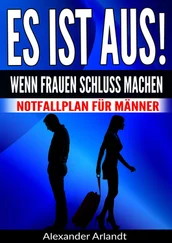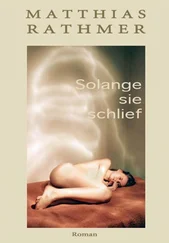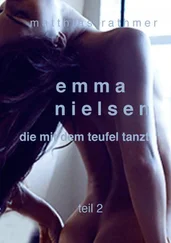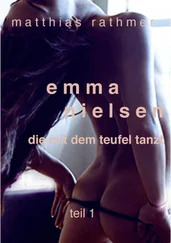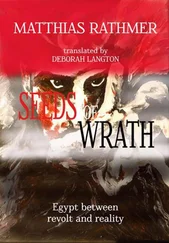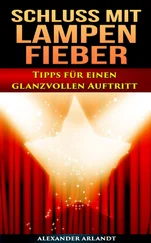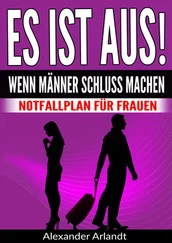Fruck war Politiker. Schon als Jugendlicher hob er die Faust zum Zeichen seines ausgeprägten, sozialistischen Kampfeswillens. Während seine Kameraden dem anderen Geschlecht nachstellten, diskutierte er über die Theorien von Marx und Engels. Mit 19 Jahren trat er in die Kommunistische Partei Deutschlands. Als Redakteur zur Aushilfe schrieb er für deren Verlag des „Reichskomitees der Revolutionären Gewerkschaftsopposition". Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ging Fruck in den Widerstand. Er betreute die Gruppe um Walter Husemann und bildete den Widerständler Herbert Baum aus. Sein Aufstieg zu einem wichtigen KPD-Funktionär brachte ihn schließlich ins Gefängnis. Im August 1943 wurde Fruck von der Gestapo verhaftet und wegen „Hochverrat" zu fünf Jahren Haft verurteilt. Im Zuchthaus Brandenburg saß gleichfalls Erich Honecker ein. Am 27. April 1945 stürmten sowjetische Soldaten das Gefängnis, und Fruck schloss sich sofort der Roten Armee auf deren Marsch nach Berlin an. „Wir wussten, dass jetzt jeder gebraucht wird (...)." 33 Er verfolgte SS-Anghörige, Gestapo-Spitzel und KZ-Wächter. Die Abteilung „K5" wurde gegründet, ein Vorläufer des Ministeriums für Staatssicherheit. Fruck wurde Leiter der Berliner Filiale. Zu seiner Abteilung gehörte auch Paul Laufer, der erste Führungsoffizier von Günter Guillaume.
Für die Kaderpolitik und die Schulungsarbeit in der sowjetisch besetzten Zone war Erich Mielke seit 1946 verantwortlich. 34 Aus seinem Dunstkreis wollte Fruck jedoch so rasch als möglich entfliehen. Gegen den intriganten Mielke hegte er eine tiefe Abneigung. Mit der Gründung des MfS 1950 wurde Fruck zum Chef der Berliner Verwaltung. Als 1952 Markus Wolf von Walter Ulbricht zum Leiter der Spionageabteilung ernannt wurde, verfügte Hans Fruck bereits über schlagkräftige Agentenringe. Selbst Mielke, neidisch und eifersüchtig ob der Erfolge Frucks, konnte den so Erfolgreichen nicht mehr angreifen. Der hatte seinerseits gewichtige Fürsprecher gefunden: von Frucks exklusiven deutsch-deutschen Nachrichtenkanälen profitierte nämlich ein weiterer „befreundeter Dienst": der sowjetische Geheimdienst KGB. Fruck hatte es mit Beginn seiner Arbeit geschafft, zwei Ziele zu vereinen. Seine Agenten spionierten in bundesdeutschen Ministerien und spähten die Akten der Verbündeten aus, und über Libermann und Goldenberg gründete er als Privatunternehmen getarnte MfS-Filialen, die die bittere Warenknappheit kommunistischer Planwirtschaft mildern halfen. Über diese Unternehmen knüpfte er ein Netz, von Ost nach West, in die ganze Welt. Die Verbindung von Handel und Wirtschaftsspionage war seine oberste Prämisse. Als Markus Wolf Chef der neu gegründeten Hauptabteilung Aufklärung wurde, benötigte er die Begabung und Kontakte Frucks. Der wiederum willigte nur ein, wenn Wolf ihm den „unberechenbaren Überzeugungstäter" Mielke fern hielt. 35
Erst als Hans Fruck 1957 Wolfs Stellvertreter wurde, erlebte die HVA ihre nachrichtendienstliche Blütezeit, kam auch die illegale Umgehung der Rechtsvorschriften im innerdeutschen Handel richtig in Schwung. Die HVA als „Sperrspitze des Kommunismus" war nicht mehr allein reines Aufklärungswerkzeug. Sie beeinflusste durch konspirative Verbindungen zu Bonner Politgrößen quer durch alle Parteien gleichfalls deutsch- deutsche Politik, und sie garantierte die Versorgung der DDR-Wirtschaft mit Embargogütern. In dieser Gesellschaft bestehend aus Intellektuellen, Kommunisten, aber auch Kriminellen und politischen Desperados, begann die Karriere Schalcks. Seine Ausbildung startete er von ganz unten.
Herausforderung Außenhandel
Die wirtschaftlichen Voraussetzungen beider deutscher Staaten, unter denen Schalcks Aufstieg begann, hätten ungleicher kaum seien können. Währen in der Bundesrepublik das sog. „Wirtschaftswunder" seinen Lauf nahm, litt die DDR unter den extremen Reparationsforderungen der UdSSR Nach den Unterlagen des sowjetischen Amtes für Reparationen und nach Berechnungen westlicher Wirtschaftsexperten beliefen sich die Verluste für die östliche Volkswirtschaft bis zum Ende der Zahlungen 1953 auf die gewaltige Summe von über 70 Milliarden DM. 36 Die UdSSR beutete die DDR hemmungslos aus. Allein in Berlin wurden 460 Industriebetriebe demontiert, Brikettfabriken und Kraftwerke gingen komplett in die Ukraine. Alle Konten wurden gesperrt, sechs Milliarden Reichsbanknoten beschlagnahmt. Das zweite Eisenbahngleis wurde von den Schwellen gerissen, das Inventar der Zeiss-Werke komplett abtransportiert. Dann ließen sich die sowjetischen Machthaber noch ihre Besatzung bezahlen: jährlich neun Milliarden DM-Mark, die die DDR mit einem enormen Warenstrom zu quittieren hatte. „Raubt, so viel Ihr könnt", hatte Stalin aufgefordert. 37 Und: die Infrastruktur samt Logistik, für ein gesundes Wirtschaftswachstum unerlässliche Faktoren, waren durch den Krieg fast völlig zerstört.
Der ostdeutsche Nachbarstaat ordnete sich allein dem wirtschaftspolitischen Willen seines Besatzers unter. Die sozialistische Planwirtschaft war von Moskau als nationales Credo verordnet worden, ausschließlich die Sowjetische Militäradministration (SMAD) entschied bis zur Staatsgründung 1949 über die Binnen- und Außenwirtschaft. Mit dem „Sequesterbefehl" 1946 wurden die wichtigsten und effektivsten Betriebe beschlagnahmt und zu „sowjetischen Aktiengesellschaften" umgewandelt. Die Bodenreform enteignete alle Privatbesitzer von mehr als 100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche entschädigungslos von Grund und Boden. 38 So waren die Startbedingungen für einen internationalen Handel in der DDR wesentlich ungünstiger als in der BRD, obwohl die Wirtschaftsstruktur einiger Regionen wie z.B. Sachsen und Thüringen seit langer Zeit einen traditionell hohen Industriestandard aufwiesen. 39
Als 1949 schließlich die DDR gegründet wurde und die zentrale Planwirtschaft in die Verfassung verankert wurde, war auch der Außenhandel der DDR zum staatlichen Monopol geworden. Der erste Außenhandelsminister, Heinrich Rau, begründete mit bekannt leeren Worthülsen führender SED-Funktionäre, warum dieses Prinzip in die Staats- und Wirtschaftsordnung der DDR aufgenommen wurde: „Das Vorhandensein des staatlichen Außenhandelsmonopols ist für jeden sozialistischen Staat eine politische und ökonomische Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, dass alle außenwirtschaftlichen Operationen unseres (...) Staates (...) den Interessen, der Festigung und Stärkung unserer Arbeiter- und Bauernmacht dienen müssen. Nur auf der Grundlage des staatlichen Außenhandelsmonopols können die außenwirtschaftlichen Beziehungen entsprechend den Erfordernissen unseres Staates geplant, gelenkt, kontrolliert und mit dem höchsten volkswirtschaftlichen Nutzeffekt geleitet und durchgeführt werden." 40
Die ordnungspolitischen Institutionen zur Durchsetzung dieser monopolistischen Ansprüche waren rasch installiert: das „Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel (MAI)" wurde 1949 gegründet, 1967 in „Ministerium für Außenwirtschaft" umbenannt, um dann 1973 wieder „Ministerium für Außenhandel" zu heißen. Als handelspolitische Instrumente des Ministeriums wurden im ganzen Land sog. „Außenhandelsbetriebe" (AHB) gegründet, die ihren Hauptsitz in Ost-Berlin hatten. 41 Alle Produktionsmittel waren „gesamtgesellschaftliches Volkseigentum", das von der staatlichen Plankommission (SPK) kontrolliert wurde.
Zusammen mit dem Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel gab die SPK den Außenhandelsbetrieben Zielprogramme vor, deren verlässliche Erfüllung Voraussetzung für weitere Aufträge war. In den 60er Jahren erfuhr das Wirtschaftssystem zwar einige Veränderungen, doch an den strukturell bedingten ökonomischen Defiziten sozialistischer Planwirtschaften änderte sich, wie zu sehen sein wird, wenig. 42 So wurde z.B. der Außenhandel 1963 durch die Reform des „Neuen Ökonomischen Systems (NÖS)" grundlegend neubewertet. 43 Bis dahin kamen den Importen die bloße Funktion zu, nur das einzuführen, was die eigenen Betriebe nicht herstellen konnten. Die Exporte hatten die Aufgabe, diese Importe zu finanzieren. So war der Außenhandel streng von der Binnenwirtschaft getrennt. Der Handel wurde ausschließlich durch das MAI abgewickelt, das die Waren durch die AHB auf den Märkten ein- oder verkaufte. In- und ausländische Preisrelationen aber wichen z.T. so erheblich voneinander ab, dass die entstandenen Verluste aus dem Staatshaushalt getragen werden mussten. Mit dem NÖS, im DDR-Jargon als „wissenschaftlich-technische Revolution" ausgerufen, übernahmen die Kombinate und VEB selbständig den Import und Export ihrer Waren. Dazu wurden Kommissionsverträge zwischen dem zuständigen AHB und den Produktionsbetrieben abgeschlossen. Der AHB verkaufte zwar immer noch die Waren, aber auf Rechnung der Betriebe. Die neuen Handels- und Organisationsformen wurden im Laufe der Jahre in verschiedene Wirtschaftsbereiche eingeführt. Einige exportstarke Betriebe waren dadurch sogar in der Lage, ihre Waren ohne Mitwirkung der AHB auf den Weltmärkten zu veräußern, so z.B. die WB Schiffbau, das Uhrenkombinat Ruhla, das Kombinat Carl Zeiss Jena, Robotron und das Strumpfkombinat ESDA in Thalheim. 44
Читать дальше