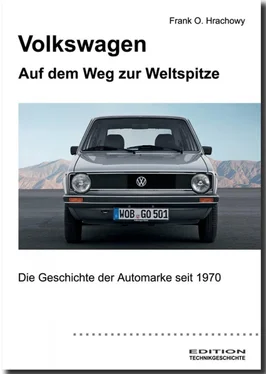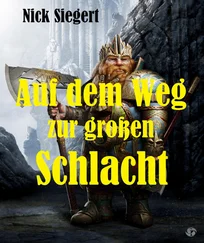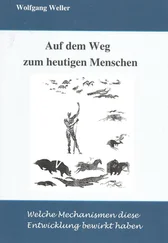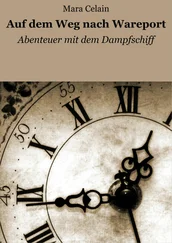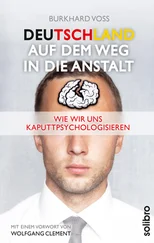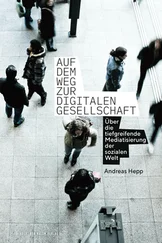Mittlerweile konnten sich bereits Angestellte und sogar einfache Arbeiter ein gebrauchtes Automobil leisten. Die Auswirkungen bekamen vor allem die deutschen Motorradhersteller deutlich zu spüren, von denen seit Mitte der fünfziger Jahre viele aus Mangel an Nachfrage in Konkurs gegangen waren. Konkreter ausgedrückt: Der Niedergang der deutschen Zweiradindustrie hatte bereits dutzende Firmen in den Ruin gerissen und selbst Marktriesen wie NSU verabschiedeten sich vom Motorradbau, um sich dem Automobilbau zuzuwenden.
Die »Volkswagenwerk GmbH« wuchs immer stärker und wurde dem folgend im Jahr 1960 zur »Volkswagenwerk AG« umfirmiert. Wie stark der VW-Konzern zu dieser Zeit war, zeigte sich nicht zuletzt daran, dass sich die Volkswagenwerk AG am 1. Januar 1965 zu 50,28 Prozent an der Auto Union GmbH, die sich seit dem Jahr 1958 im alleinigen Besitz von Daimler-Benz befand, beteiligte. Durch diese Zusammenarbeit mit Daimler-Benz konnte die Volkswagenwerk AG nicht nur ihre Fertigungskapazitäten deutlich ausweiten, sie hatte damit auch Zugriff auf die bereits von Daimler-Benz neu entwickelte Motorengeneration, die für eine kleinere Modellreihe konzipiert worden war.
Bekannt wurde diese neue Motorengeneration unter dem Begriff »Mitteldruckmotor«. Durch ein vergleichsweise hohes Verdichtungsverhältnis und hohe Arbeitsdrücke sollte dieser Motor besonders sparsam sein. Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren war der Audi 72, der im September 1965 auf den Markt kam und den Grundstein des Erfolgs für die Marke aus Ingolstadt legte. Auf die Weiterverwendung des Markennamens DKW wurde verzichtet, weil nach Meinung des Marketings DKW vorrangig mit Zweitaktmotoren in Verbindung gebracht wurde. Das Markenzeichen der Auto Union, die vier Ringe für die Marken Audi, DKW, Horch und Wanderer, wurde jedoch beibehalten.
Schon im Jahr 1965 hatte VW-Konzernchef Heinrich Nordhoff weitere 24,97 Prozent der Aktien der Auto Union GmbH erworben, im Laufe des Jahres 1966 kamen nochmals 24,75 Prozent hinzu. Insgesamt hatte VW damit 297 Millionen Mark (ca. 150 Millionen Euro) für das finanziell angeschlagene Unternehmen Auto Union GmbH an Daimler-Benz bezahlt. Die Fertigungskapazitäten sollten als zusätzliche Produktionsstätte für den VW Käfer dienen, doch der Bau des Audi 72 zwang zum Umdenken. Historisch betrachtet war der kurzfristig aus dem DKW F 102 entwickelte Audi 72 kein überragender Markterfolg, er bildete jedoch den Ausgangspunkt für die Eigenständigkeit der Marke Audi innerhalb des VW-Konzerns.
Zur Übernahme der Auto Union GmbH fasst das Historische Notat 7 der Historischen Kommunikation der Volkswagen Aktiengesellschaft zusammen: »Als Aktivposten konnten die Fabrik mit einer Jahreskapazität von 100.000 Fahrzeugen, 11.000 Mitarbeiter, ein Vertriebssystem mit 1.200 Händlern und eine neue Motorengeneration verbucht werden. Diesem Potenzial standen auf der Passivseite ein hoher Lagerbestand und eine handfeste Finanzkrise gegenüber, denn die Auto Union baute auf vergleichsweise niedrigem Produktivitätsniveau ein zu teures und deshalb schwer verkäufliches Fahrzeug.« 1
Der VW Käfer und das Wirtschaftswunder
Statt Motorrad oder Rollermobil fuhren mittlerweile viele Deutsche einen gebrauchten Käfer. Viele weitere sparten, um möglichst bald ebenfalls auf ein Auto umsteigen zu können. Der Bedarf der westdeutschen Bevölkerung an einfachen, kostengünstigen Automobilen schien unbegrenzt, ebenso wie das Wachstum der westdeutschen Wirtschaft unbegrenzt schien. Die vom ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard 1957 in seinem Buch Wohlstand für Alle beschriebene Vision schien sich zu erfüllen, rückten doch immer mehr Deutsche dank eines gut bezahlten, sicheren Arbeitsplatzes in die Mittelschicht auf.
Doch so groß der Erfolg des VW Käfer in der Vergangenheit war, so wurde doch von Jahr zu Jahr offensichtlicher, dass der luftgekühlte Hecktriebler nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entsprach. Zwar hatten die Wolfsburger Ingenieure den Käfer ständig weiterentwickelt, so dass nahezu jedes Bauteil im Laufe der Jahre verändert worden war, doch das Grundkonzept war unangetastet geblieben. Mit anderen Worten: Der VW Käfer war ein ausgereiftes Automobil, doch seine kritische Straßenlage, die unzureichende Heizleistung des luftgekühlten Motors und der im Verhältnis zu den Fahrleistungen hohe Benzinverbrauch waren nicht wegzudiskutieren.
Gleiches galt für den VW Typ 3, der bereits 1961 als größeres Modell dem Käfer zur Seite gestellt worden war. Dieses VW 1500 genannte Stufenheckmodell basierte auf der Technik des Typ 1, es war jedoch von seinem Maßen her länger und breiter als der Käfer. Der bewährte Boxermotor besaß knapp 1.500 cm 3Hubraum und war leistungsstärker geworden. Er leistete jetzt 45 PS. Wichtiger aber war, dass der Ölkühler und das Radialgebläse zur Motorkühlung umgesetzt worden waren, so dass der Motor nun sehr flach baute.
Wie beim Käfer war die Karosserie mit einem Plattformrahmen verschraubt. Optisch wirkte der Typ 3 deutlich erwachsener, vor allem aber besaß er viel mehr Stauraum als der VW Käfer. Vorne standen 200 Liter für Gepäck zur Verfügung; hinten, direkt über dem flach im Heck liegenden Motor, nochmals 180 Liter. Das wirkte wohl auf den ersten Blick recht überzeugend, doch in der Praxis boten beide Kofferräume nur Platz für flaches Stückgut. Auch von seinen Platzverhältnissen her überzeugte der Typ 3 nicht, denn der Radstand war mit dem des Typ 1 identisch. Fakt war: Obwohl der Typ 3 von seiner äußeren Erscheinung deutlich größer aussah als der VW Käfer, war er innen genauso eng.
Den Typ 3 gab es in drei Karosserieversionen zu kaufen, namentlich als Limousine, als Kombi sowie unter dem Label »Karmann-Ghia« als Coupé (Typ 14). Auf ein geplantes Cabriolet wurde für den Serienbau aus Kostengründen verzichtet. Bereits im Herbst 1963 erschien der VW 1500 S mit einer Leistung von 54 PS. Der VW 1500 S wurde im August 1965 vom VW 1600 TL (»Touren-Limousine«) mit Fließheck abgelöst, der zwar nicht stärker, dafür aber etwas breiter war.
Wie wenig dieses Modell den Erwartungen der Käufer entsprach, zeigte sich bei der Verballhornung des Kürzels »TL«, das bald als »Traurige Lösung« die Runde machte. Für kaum mehr Begeisterung sorgte der neue, vorrangig für die Deutsche Post entwickelte VW Kleintransporter Typ 147 »Fridolin«, der kostensparend aus Komponenten der bereits vorhandenen VW-Modelle entwickelt worden war.
Zum VW Typ 3 schrieb Buchautor Jerry Sloniger: » [...] die Hälfte der Wagen mußten außerplanmäßig die Werkstatt aufsuchen – für VW-Verhältnisse etwas völlig Absurdes. Nicht genug, daß dieses Auto so viel kostete wie andere, die mehr boten und schneller waren – auch sein Durst war infolge eines leicht veralteten Motorkonzeptes nicht gerade gering. Doch viel schlimmer war, wie Käuferbefragungen inzwischen ergaben, dass es sowohl hinter heimischen wie ausländischen Konkurrenten in puncto Zuverlässigkeit und Qualität zurückfiel.« 2
Das Ziel war klar, VW wollte den Typ 3 in die nächsthöhere Klasse hieven, wo mit ertragreicheren Preisen und Margen kalkuliert werden konnte. Die deutsche Bevölkerung war anspruchsvoller geworden – und die neuen Ansprüche galt es nun zu bedienen. Zur zeitgenössischen Marktsituation schrieb das Nachrichtenmagazin FOCUS : »Die Mittelklasse war Mitte der 1960er Jahre zum wichtigsten Umsatzbringer fast aller deutscher Automobilhersteller geworden. Audi, BMW, Ford, Glas, Mercedes, Volkswagen und bald auch NSU, alle wollten ihren Anteil am lukrativsten Marktsegment, das sich Opel anfangs fast nur mit Borgward teilen musste.« 3
Das Jahr 1967 markierte in Deutschland einen Umbruch, denn das Wirtschaftswunder stockte und die Wirtschaft schrumpfte. Die Steuereinnahmen waren niedriger ausgefallen als erwartet, während die Staatsausgaben stark gestiegen waren. Nach den Boomjahren des Aufbaus mit Wachstumsraten von teilweise über 10 Prozent rutschte die deutsche Wirtschaft plötzlich in eine Rezession. Dabei stiegen die Arbeitslosenzahlen von 0,7 Prozent 1966 auf 2,1 Prozent im Jahr 1967. Gleichzeitig stieg die Inflation, weshalb die Bundesbank die Zinsen erhöhte. Der Effekt war, dass Investitionen verschoben oder nicht getätigt wurden. Nach dem stetigen Wachstum der vergangenen Jahre musste die Volkswagenwerk AG so 1967 erstmals einen Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr hinnehmen.
Читать дальше