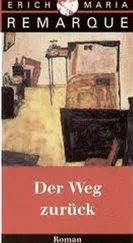Als der Leutnant uns bat, ihm dem Weg zu zeigen, fragte ich ihn: „Wann werde ich endlich mal abgelöst, ich bin nun seit dem 27. August immer hier draußen.“ „Dafür sollen Sie auch belohnt werden.“ „Ich verzichte auf Ihr Eisernes Kreuz und das Eisen ins Kreuz!“ Wie mir später erzählt wurde, hatte er sich beim Regiment folgendermaßen über mich ausgedrückt: „Frech ist der Slawinski ja, aber Angst hat er keine.“ Bezüglich der vielen herrenlos verletzt herumlaufenden halbwüchsigen Kälber meinte er: „Sie müssen die Kälber alle einsammeln und zum Regiment bringen!“ „Was wollen Sie denn damit?“ „Bouletten backen!“ „Hier kommen jeden Abend drei Feldküchen und bieten ihr Essen an, ich weiß nicht wo ich Essen fassen soll.“ Was ich dachte, möchte ich hier nicht äußern.
Jetzt saß der Russe oben auf der Düne und konnte jeden einzelnen beobachten, denn hier war eine freie Fläche. Wir mussten unsere Stellung nochmals zurücknehmen bis auf einen Teil des zweiten Bataillons, der in einem Wäldchen Unterschlupf gefunden hatte. Dorthin konnte die Feldküche im Schutze von Kiefer-Kusselgelände 7 sogar am Tage das Mittagessen sowie die Post bringen, bis eines Mittags, als gerade die Küche vorgefahren war, der Iwan ein kleines Gefecht veranstaltete. Alle stoben auseinander, jagten dann aber die Russen wieder zurück. Weil der Koch nicht zu finden war, teilte ein anderer das Essen aus. Er schöpfte und schöpfte, bis er es merkwürdig fand, dass da noch dicke Fleischstücke drin zu sein schienen. Es war der Kopf des Kochs. Ich konnte mir so etwas nicht vorstellen, denn ich kannte die Russen noch nicht gut genug!
Dem zweiten Bataillon wurde nach all den Verlusten ein Hauptmann von Knobelsdorf vorgesetzt, ein feiner Mensch, der jeden respektierte. Wenn wir uns morgens in der Frühe bei der körperlichen Entleerung trafen: „Guten Morgen, Herr Hauptmann.“ „Guten Morgen, Slawinski. Was gibt es Neues? Was meinen Sie, wie das Wetter wird?“
Während des Rückzugs von Kursk lagen wir irgendwo ohne jegliche Verbindung zu den nächst höheren Truppen. Ich sah eine Freileitung an einem Telefonmast herunterhängen und sprach Oberleutnant Abresch, den Bataillonsadjutanten an, das wäre die Gelegenheit zu versuchen, irgendwelche Telefonverbindung zu bekommen. Alle waren gegen mich. Ich also am Mast hoch bis zum Blankdraht, Telefon angeschlossen und durchgeklingelt. Es meldete sich der Gefechtsstand des Armeekorps. Ich stellte mich als Gefreiter des Regimentsnachrichtenzuges vor, gab unsere Abteilung und Position anhand einer Landkarte durch. Es hat mich keiner von dort angebrüllt. Im Gegenteil, man war dankbar, Nachricht über unseren Stand zu haben, da man durch den Rückzug tagelang nichts von unserer Einheit gehört hatte.
3. November 1943 – Ich musste wie alle morgens aus unserem Erdbunker raus, nachdem ich schon eine Zeit lang gedacht hatte: „Was ist das nur für ein merkwürdiges Dröhnen? Die ganze Erde vibriert ja!“ Ich raus aus dem Erdbunker, den wir erst vor einigen Tagen mühsam erstellt hatten. Ich kam nicht mehr zum pinkeln. Ich rief nur: „Die Russen sind da!“ Alle waren im Nu hellwach. Werner Hinrichs war sofort bei mir und wir nichts wie ab Richtung Glebowka. Es war das nächste Dörfchen, hinter einem Wald gelegen. Wir wussten nicht, ob die Iwans schon dort waren oder nicht. Immer weiter liefen wir Richtung Südwesten, bis wir am Nachmittag in Dymer ankamen. Dort befand sich, wie ich erst später im Urlaub erfuhr, die Divisionsapotheke mit unserem Ortsapotheker Heinrich Büscher! Dymer selbst war voll gestopft mit Gespannen, die nicht vorwärts noch rückwärts konnten. Alle suchten nach Verpflegung, denn man war gerade dabei, das Lager zu räumen, als auf einmal ein ganz merkwürdiges Geräusch zu hören war, das ich bis jetzt noch nicht kannte: Die Stalinorgel 8 . Wir liefen in all dem Chaos um unser Leben! Ich wollte mich nach etwa 150 Metern zu meiner Linken in einen Straßengraben legen, aber da war schon einer vor mir. Noch weiter, da legte sich auch schon einer gerade vor mir in den Straßengraben. Verdammt! Noch mal zehn Meter, da machte es auf einmal „wupp“ auf meinem linken Ellenbogen. Ich rief: „Werner, ich bin verwundet!“ Ich hatte Glück gehabt, denn die Falten meines Mantels hatten mich vor dem Verlust meines Armes durch Granatsplitter bewahrt!
In meiner Neugier ging ich nochmals zurück und stellte fest: An der Stelle, die ich zuerst ausgesucht hatte, war ein anderer für mich gefallen; der zweite, seinetwegen musste ich ja noch weiter laufen, hatte einen Arm ganz verloren, der andere Arm baumelte nur noch unterhalb der Schulter. Wir konnten ihm mit meinen Marschriemen den Arm abbinden, etwa zehn Zentimeter Knochen unter dem Schultergelenk waren noch vorhanden! „Helft mir, helft mir!“, waren seine Worte. Am Horizont sah man ganze Fahrzeugkolonnen wild durcheinander gegen Westen ziehen. Wir halfen ihm auf und sagten ihm, in welche Richtung er laufen müsse, um ein Fahrzeug zu erreichen, das ihn mitnehme. Auch wir flohen, weil wir nicht wussten, was der Iwan weiter vorhatte und landeten bei der 216. Division, die dort wohl ausgerüstet in Reserve lag, wie im tiefsten Frieden! Wir suchten eine Sanitätsstelle wegen meines Arms auf. Zum Glück war es nur eine Fleischwunde am linken Ellenbogen. Ich wurde verbunden, aber die Verwundung wurde im Soldbuch nicht bestätigt: „Das kann ich nicht anerkennen, ich brauche einen Sanitäter, der das gesehen hat.“ Ich dachte armes Deutschland, mit solch einer Bürokratie kann man nicht viel anfangen! Später, als ich wieder bei meiner Einheit war, habe ich unter Zeugenaussage von Werner Hinrichs den Vorfall dort gemeldet, und er wurde akzeptiert.
Wir waren nun versprengt und von unserer Einheit getrennt. Richtung Westen landeten wir schließlich beim Armeekorps, als der Herr General sich gerade davon machte! Keiner wusste etwas von den Geschehnissen des Vortages! Man dokumentierte im Soldbuch, dass wir uns vorschriftsmäßig bei der nächst höheren Befehlsstelle gemeldet hatten, denn hätten wir das nicht getan, hätte man uns wegen Fahnenflucht sofort erschießen können! Man wies uns an, nach Borodyanka zu gehen. Dort könne man uns eher Auskunft geben. Von da nach Radomyshl', wo sich eine große Verpflegungsstelle befand. Aber der Oberzahlmeister in seiner Gewissenhaftigkeit war nicht bereit, uns, die nun schon den fünften Tag nichts zu essen bekommen hatten, auch nur die geringste Kleinigkeit zu geben. Lediglich eine große Packung Zigaretten bekamen wir aus seinem persönlichen Vorrat, da er Nichtraucher war. Was er uns anbot, war ein Duschbad in einem riesigen Baderaum. Da es gerade Samstag war, passte das ganz gut. Wir waren von den langen Märschen hundemüde und schliefen im Nachbargebäude so fest, dass wir nichts davon mitbekamen, als in der Nacht Partisanen alles ausraubten und das Verpflegungsgebäude in Schutt und Asche legten. Der Zahlmeister und seine nächsten Untergebenen mussten dabei ihr Leben lassen.
7. November 1943 – Irgendwelche Lastwagen nahmen uns mit nach Schitomir. Im Nachhinein bin ich immer noch der Meinung, dass es Partisanen waren, denn es wurde nichts gesprochen, wie es sonst üblich war. Keiner stellte Fragen, lediglich als sie plötzlich von hinten kommend anhielten und fragten: „Wohin?“ „Nach Schitomir.“ Auf dem Weg dorthin kamen wir an einem kleinen Obstgeschäft vorbei. Ich erstand dort für fünf Reichsmark den teuersten Apfel meines Lebens! Spät am Sonntag landeten wir in Schitomir und meldeten uns bei der entsprechenden Wehrmachtsstelle, die unsere Meldung im Soldbuch bestätigte. Das war wichtig! Man wies uns in die Wehrmachts-Übernachtungsstelle zum Schlafen. Die war in einer großen Kirche eingerichtet mit mindestens 100 doppelstöckigen Feldbetten. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so gut geschlafen wie in dieser ehemaligen Kirche! Da niemand den ständig wechselnden Frontverlauf kannte, schickte man uns erst nach Korosten, dann nach Malyn, von da wieder zurück nach Korosten. Dort trafen wir einen namens Helmes aus Weidenau und den Sohn aus der Spedition Pracht in Dillenburg, zwei Landsleute von mir. Von Korosten mussten wir durch ein Partisanengebiet nach Sarny! Den Zug, den wir eigentlich nehmen wollten, hatten wir aus irgendwelchen Gründen versäumt. Ich war verärgert. Doch als wir dann später mit der Bahn nach Sarny fuhren, stand dort der vorausgefahrene Zug auf einem Nebengleis – gesprengt. Alle tot, die meisten verstümmelt. Es waren Frontsoldaten, die endlich mal Urlaub bekommen hatten. Mit manchen hatten wir uns noch kurz vorher unterhalten und ausgetauscht. Sie hatten sich gefreut, dass sie endlich nach Hause konnten! Es sah aus wie in einem Schlachthof! Ich wusste jetzt, warum ich den Zug mit aller Gewalt nicht bekommen sollte!
Читать дальше