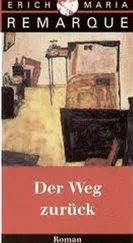19. Juli nachmittags – Der Sturm vom Vormittag hatte sich gelegt. Was war nun zu tun? Als einer der Jüngsten fragte ich Unteroffizier Adolf Gangelmeier, einen österreichischen Funkunteroffizier. Seine Antwort: „Das muss jeder selbst entscheiden.“ Ich war wieder einmal von einem Vorgesetzten enttäuscht. Am Abend setzten wir uns mit 14 Mann leise in Bewegung. Die russische Artillerie war abgezogen. Es war recht dunkel, zu unserem Vorteil. Aber wir hatten nichts zu essen! Wasser fanden wir in den Fahrspuren der Pferdewagen. Es schmeckte nach Benzin und Pferdepisse! Die Folgen davon habe ich etwas später zu spüren bekommen.
20. Juli – Wir, noch 14 Mann, hatten uns tagsüber in ehemaligen alten Betonbunkern verborgen, von Polen stets beobachtet!
21. Juli abends – Wir hatten einen Bahnübergang passiert, waren gerade einzeln über die Straße, als vor uns plötzlich ein russischer Lkw auftauchte. Wohl aus Sparsamkeit leuchtete nur die linke Lampe. 100 Meter von uns blieb das Ding stehen, es hatte eine Panne und wir im Scheinwerferlicht! Hatte uns die Besatzung gesehen oder nicht? Wir blieben liegen, wie lange weiß ich nicht mehr. Es müssen zwei oder drei Stunden gewesen sein. Jetzt mussten wir dringend aus dem Scheinwerferlicht verschwinden, denn wenn der Lkw anfuhr, hätte man uns in jedem Fall gesehen! Es gab ein leises „Ssst“ und auf ging´s. Aber, oh weh, ich konnte nicht aufstehen. Beide Beine waren eingeschlafen, weil ich, was ich damals noch nicht wusste, völlig ausgetrocknet war. „Das ist das Ende“, dachte ich. Ich durfte nicht rufen, sonst hätte ich uns alle in Gefahr gebracht. Ich robbte wie eine Eidechse, waren es 20 oder 30 Meter? Ich betete vor Angst! Meine Beine wurden langsam wieder „wach“, waren aber ohne Gefühl, das kam erst später zurück. Ich ging wie auf Stelzen. Die anderen hatten mein Fehlen in der Dunkelheit gar nicht bemerkt.
22. Juli – Den Tag über hatten wir uns in Feldern versteckt und zwar immer zu zweit, möglichst weit verstreut. Falls wir entdeckt würden, so doch nur zwei von uns. Denn wir hörten den ganzen Tag lang Stimmen von Frauen, die mit der Ernte des Getreides beschäftigt waren. Bei Anbruch der Dunkelheit versuchten wir, uns im Dorf etwas zu essen zu besorgen. Oh weh! Das Dorf war schon von der Roten Armee besetzt. Während sich die Soldaten in Quartieren ausruhten, standen draußen die Posten auf Wache. „Stoi, kto idiott?“ „Halt, wer kommt da?“, ertönte auf einmal eine Stimme dicht vor uns rechts aus einem Toreingang. Wir ergriffen sofort die Flucht nach links durch einen Wassergraben. Ach, du Schreck! Auf der anderen Seite befand sich auf der Uferkante ein Stacheldrahtzaun. Ich war Erster. Mein Gewehr blieb aber im Stacheldraht hängen. So ließ ich es los, um mein Leben zu retten. In dem Augenblick schossen die Wachposten Leuchtraketen hoch, und wir lagen alle flach, dem Erdboden möglichst gleich, um nicht entdeckt zu werden. Ich vermute, dass die Wachen von dem plötzlichen taghellen blau weißen Licht geblendet wurden, sodass sie uns als Menschen nicht erkannten. Sonst wären wir ja früher unseren Feinden in die Hände gefallen. Sobald die Helligkeit nachließ, versuchten wir in größter Eile uns robbend und in jede mögliche Versenkung verkriechend davonzumachen. Wieder hatten wir nichts zu Essen und zu Trinken gefunden!
23. Juli – Nach einer Nachtwanderung sahen wir vor uns ein einzelnes Haus links an der Straße. Wir gingen darauf zu und da ich inzwischen geringe russische Sprachkenntnisse erworben hatte, ging ich hinein. Ein Pan 11 kam mir entgegen in Hemd und Unterhosen aus selbst gewebtem groben Leinen. Er machte durch Halten des Zeigefingers an die Lippen Zeichen, dass wir nicht sprechen sollten. Dann gab er uns etwas Brot und winkte uns hinaus, nachdem er uns klargemacht hatte, dass Russen im Haus waren. Er hat uns nicht verraten! Es sollte noch ärger kommen. Wir wendeten uns ab auf die andere Straßenseite, gingen etwas zurück einen Weg hinauf über eine kleine Brücke in Richtung eines Gehöftes. Oh Schreck! Durch dichten Nebel hatten wir nicht erkannt, dass wir einer russischen Reiterschwadron gegenüber standen, die ihrerseits unser leises Herankommen nicht bemerkt hatte und somit keinerlei Notiz von uns nahm, sodass wir unbehelligt unseren Rückzug antreten konnten.
24. Juli – Vom Feind unerkannt, in irgendeinem Wald versteckt, gab es Meinungsdifferenzen. Fazit war: Wir teilten uns auf in zwei Gruppen von je sieben Soldaten. Wir Nachrichtenleute blieben zusammen. Die andere Gruppe mit Feldwebel Hauschild aus Bremen, 1,95 Meter groß, war bis zur Weichsel gekommen, wie wir später im Lager Przemyśl erfuhren. Der Siebte in unserer Gruppe, ein Oberschlesier, war der polnischen wie auch der russischen Sprache mächtig. Wir wussten nie, was er in seinem Kauderwelsch mit Partisanen oder anderen besprach. Wie er erfahren hatte, sollte sich im nächsten Dorfe ein Lager mit deutschen Kriegsgefangenen befinden. Für diese sei der Krieg aus und sie bekämen amerikanische Verpflegung. Er war entschlossen überzulaufen. Normalerweise hatte unser Unteroffizier das Recht, einen Fahnenflüchtigen zu erschießen. Aber es wurde Abstand davon genommen. Er musste nur seine Feldflasche abgeben, sodass wir nun mit sechs Leuten drei Feldflaschen besaßen. Darüber waren wir glücklich. Jetzt mussten wir nur noch Wasser finden. Nach einem weiteren Nachtmarsch löschten wir unseren Durst wieder aus Pfützen.
25. Juli – Wie uns die Partisanen vorausgesagt hatten, durchsuchten russische Reiterpatrouillen das von ihnen zurück eroberte Land nach versprengten deutschen Soldaten. Einzelpersonen sowie kleinere Gruppen wurden sofort erschossen. Was wir verschiedentlich zu sehen bekommen haben, war kein Heldentod. Es war Mord! Totschlag! Eine Versündigung an jungen Menschen, an Geschöpfen Gottes. Wir hatten wieder mal Glück gehabt, dass uns keiner von den Reiterpatrouillen gesehen hatte, obwohl man von einem Pferd aus eigentlich gut erkennen kann, ob ein Getreidefeld platt getreten ist und sich dort versprengte Soldaten in Feldgrau – besonders kontrastreich zum gelben Weizenfeld – abzeichnen. Zu allem Unglück bekam ich wieder Durchfall, mit Schleim und Blut. Jede Viertelstunde musste ich aus den Hosen, was natürlich für alle einen Zeitverlust mit sich brachte.
26. Juli – Wir lagen in einem Niederwald an einer Wegkreuzung. Russische Panzerspähwagen passierten die Wege vor uns und neben uns. Wir hatten noch nichts Essbares gefunden, denn jedes Mal, wenn wir uns am Abend einer ländlichen Ortschaft näherten, fingen die Hunde im Dorf an zu bellen, erst einer, der uns Fremde zuerst gewittert hatte, dann alle anderen. Das bedeutete, falls das Dorf von Russen besetzt war, stand alles sofort in Bereitschaft. Um die Mittagszeit hörte die Fahrerei auf. Auf der anderen Straßenseite stand eine mit Stroh gedeckte Bauernkate. Da wir keine Menschenseele dort ein- oder ausgehen sahen, fasste ich den Mut mit einem jüngeren Kameraden namens Krahwinkel, ebenso Fernsprecher wie ich – wir beide mit einem Stock bewaffnet – über die Straße zu dem hinter einem Gebüsch versteckten Haus zu schleichen, um dort etwas Essbares zu ergattern. Wir hatten sogar Erfolg. An dem Haus angekommen, die Tür stand offen und eine Frau trat heraus, fragte ich wie immer: „Chleb jest?“ 12 Sie gab uns etwas Brot und gekochte Eier. Glücklich kehrten wir zu unseren Kameraden zurück und teilten die Beute. Jeder bekam ein Ei und ein Stückchen Brot. Wir beide, die die Eier besorgt hatten, bekamen zwei Eier. Alle waren zufrieden, bis gegen Abend der Älteste, Alfred Höfer, 38 Jahre, anfing zu meckern, die Eier seien nicht gerecht verteilt worden. Ich war stinksauer. Schließlich kam heraus, dass Kamerad Krahwinkel noch zwei weitere Eier für sich behalten hatte. Von da an fiel mir immer wieder auf, dass die Älteren stets meinten, sie kämen zu kurz. Das nur so nebenbei. Als wir mit unserer Beute zu den Kameraden zurückkehrten, schaute ich noch einmal nach dem Haus der Spenderin und erschrak. Hinter dem Haus stand ein hochrangiger Offizier der Roten Armee; er hatte wohl nichts von unserem Hausbesuch mitbekommen? War es wieder die Fügung einer höheren Macht?
Читать дальше