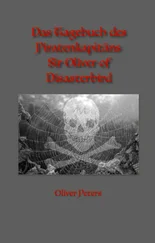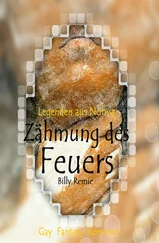Conni zog einen Dolch. Lazlo lachte.
Sie kämpften.
Lazlo wurde verletzt und Conni rannte davon.
»Ich wusste, dass das passiert«, lachte Derrick neben mir.
»Versuch du doch dein Glück und fang sie wieder ein«, rief Lazlo sauer. Fluchend wischte er sich das Blut von der Hand, durch die Conni ihre Dolchklinge gestoßen hatte.
Derrick schüttelte nur den Kopf, denn Derrick fasste Conni nicht ein. Aber nicht, weil er Mitleid mit ihr gehabt hätte, er ekelte sich nur vor benutzten Frauen. Jedenfalls behauptete er das stets.
Mir war das egal, ich bestieg alles. Ich hätte auch mit einem Astloch vorliebgenommen, wenn es denn eng und warm gewesen wäre. Viel Freude empfand ich dabei ohnehin nicht, mir ging es nur darum, den stetigen Druck in meinen Lenden loszuwerden. Und das konnte ich bei Conni ebenso gut wie ich es bei unberührten Frauen oder einer bezahlten Hure loswerden konnte. Am liebsten mochte ich es ohnehin, wenn sie sich wehrten. Aber Conni werte sich nicht, nicht einmal, wenn ich sie schlug oder sie würgte. Sie hatte für mich über die vielen Jahre einfach an Reiz verloren. Während mir als Junge nur ihre großen Brüste und ihr warmes Fleisch genügt hatten, spürte ich nun immer mehr, dass ich mehr benötigte als das.
Aber meine fleischlichen Gelüste waren mir ohnehin nicht so wichtig. Wie gesagt, solange ich irgendwo Druck loswerden konnte, war ich zufrieden, wenn auch nicht befriedigt.
Wichtiger war mir nur, mein Leben endlich drastisch zu verändern. Es war an der Zeit, dass ich zurückeroberte, was mir nun rechtmäßig zustand.
Und zwar mir allein.
Ich stand auf und drängte meine Männer zur Eile. Ich schickte Lazlo, damit er Conni zurück zerrte. Ich kannte sie, sie würde uns nicht verlassen, egal was wir ihr antaten. Sie war vom gleichen Schlag, sie war auch eine Schurkin, eine Schwester, sie brauchte uns. Und ich vergeudete kein nützliches Leben, wenn es nicht unbedingt von Nöten war.
»In zwei Wochen müssten wir zurück bei Menards Zuflucht sein«, vermutete Derrick, als wir nebeneinander auf unsere Pferde stiegen.
Ich ließ meinen Blick über das Waldgebiet wandern, das sich vor uns erstreckte. »Meinst du?«, fragte ich gedankenverloren, mein Gesicht war unergründlich und spiegelte nicht die Ungeduld wieder, die ich seit einigen Monaten nicht mehr auszuhalten versuchte.
Ich ließ sie einfach zu.
Menard war schuld an meiner schlechten Laune. Er bremste mich aus, ich wusste nur noch nicht, wieso mich der Mann, der mir einst wie ein Vater gewesen war, an meinen Plänen zu hindern versuchte.
Ich drehte Derrick das Gesicht zu und sagte: »Es wird Zeit, das wir heimkehren, Sir Derrick Einar.«
Und ich sprach nicht von der Zuflucht des Schamanen.
»Alles zu seiner Zeit«, sprach Derrick auf mich ein. »Vielleicht spuckt der Alte noch etwas Nützliches aus.«
»Das hoffe ich.«
Oh, und wie ich hoffte, dass er noch etwas ausspucken würde.
***
»Unser Land ist vom Feind besetzt und Menard schickt mich in Tempel um Abschriften anzufertigen.« Ich schüttelte verdrossen den Kopf, meine Arme waren vor meiner Brust verschränkt und die Gerüche aus der Küche des Gasthauses kitzelten mir in der Nase.
Was war das? Wildbret? Mir lief das Wasser im Mund zusammen, ich hatte seit Tagen nichts Warmes mehr gegessen.
»Der Feind besetzt unser Land nicht«, warf Derrick ein, der vor mir saß und ebenso hungrig aussah wie ich. »König Amon hat sich mit dem Feind verbündet«, erinnerte er mich. »Wir gehören jetzt zum Kaiserreich der Elkanasai.«
Ich schlug wütend die Faust auf den von Kerben gezeichneten Tisch, die einzelne Kerze, die uns Licht spendete, hüpfte dabei einmal und drohte, umzukippen.
Derrick verstummte.
Ich konnte nicht genau sagen, ob ich wütend darüber war, weil er mich daran erinnerte, das Carapuhr sich unterworfen hatte, oder weil er den Namen des Mannes ausgesprochen hatte, den ich zu meinem Erzfeind ernannt hatte, nachdem er meine Familie abschlachtete.
König Amon ... Dieser Verräter, der sein eigenes Volk verkaufte, nur um sich weiterhin König nennen zu können. Wenn der alte Mann Mut gehabt hätte, dann wäre er den zahlreichen Armeen der Elkanasai trotz seiner Unterlegenheit entgegengetreten, statt sich auf ein feiges Abkommen einzulassen.
Gut, man sollte ihm zugestehen, dass er dadurch viele unschuldige Leben vor dem Tod bewahrt hatte. Allerdings lebte die Hälfte dieser verschonten Leben nun in Sklaverei. Denn das ist es, was die Elkanasai mit Menschen machten. Sie versklavten uns.
»Carapuhr ist noch nicht verloren«, knurrte ich und lehnte mich zurück.
Mein Blick durchforstete das düstere Innere des Gasthauses. Seit dem frühen Nachmittag besetzte ich mit meiner Truppe aus siebenundsiebzig Mann – Conni eingeschlossen – dieses Gebäude und den angrenzenden Hof. Nur meine engsten Vertrauten hatten das Privileg mit mir im warmen Inneren an Tischen zu sitzen, alle anderen durften bei den Tieren hausen.
»Das sage ich auch gar nicht«, hörte ich Derrick erwidern.
Ich sah ihn an. Sein Antlitz machte mich wütend. Es machte mich oft wütend, ich wusste aber nicht einmal, wieso. Sein Gesicht war mittelmäßig. Markant. Ohne besondere oder abscheuliche Merkmale, die mich stören könnten. Derrick war äußerlich betrachtet durchschnittlich. Weder hässlich noch besonders hübsch. Aber irgendetwas in seinem Gesicht machte mich wütend. Wenn ich ihn ansah, brodelte Zorn in mir. Die Wut bezog sich nicht auf ihn, sondern auf mich selbst. Aber genau das war es, was mich daran störte.
Durchforschend betrachtete ich ihn, auf der Suche nach der Lösung dieses Rätsels, aber ich fand nichts, was mich im Besonderen zornig machte. Alles ärgerte mich gleichermaßen. Seine grauen Augen, die mich an die Silberklinge meines kostbaren Schwerts erinnerten, ebenso die langen, dunklen Wimpern, die sie umrandeten, und die unaufdringliche Nase mit der abgerundeten Spitze, die ein wenig nach oben zeigte und seine Nasenlöcher groß erscheinen ließ, die ebenholzfarbenen, schulterlangen Locken, die Ohren, die weder abstanden noch seltsam eng am Kopf lagen, die Lippen, die weder voll noch schmal waren.
Derrick runzelte die Stirn. »Ist was?«
Ich atmete gereizt ein und aus.
Derrick lehnte sich zurück. Er spürte, dass er der Grund war, wegen dem ich kurz davor war, die Beherrschung zu verlieren.
»Mein Bruder«, Derrick sprach ruhig, was mich wiederum noch mehr verärgerte, »wir werden schon noch einen Weg finden, die Elkanasai zu vertreiben.«
»In ein paar Jahren bin ich ein alter Mann«, gab ich kopfschüttelnd zurück, »was kann ich dann noch ausrichten, Derrick?«
Derrick wollte wissen: »Was willst du tun?«
Mit dieser Frage hatte er mich wieder besänftigt. Derrick maßte sich nicht an, mir zu sagen, was das Beste wäre oder was ich seiner Meinung nach tun sollte, jedenfalls vermied er es, wenn ich ohnehin mieser Laune war.
Ich zuckte mit den Schultern, nun nervte mich meine eigene Unfähigkeit. Ich wusste es nicht, so schwer es mir fiel, es zuzugeben, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Menard war mein engster Vertrauter, ich würde sogar soweit gehen, ihn als Freund zu bezeichnen. Aber weshalb bremste er mich so aus?
Als hätte er meine Gedanken belauscht, vermutete Derrick: »Vielleicht hat er nur Angst um dich.«
»Angst ist etwas, das wir uns nicht leisten können«, gab ich zurück. Ich hatte mich oft genug in meinem Leben der Angst hingegeben, es war an der Zeit, zurückzuschlagen, egal welche Verluste ich zu erwarten hatte. Angst würde mich nicht aufhalten ... nein, nicht mehr.
»Entweder sterben für die eine Sache, die uns am leben hält ...«, murmelte ich.
»Oder wir opfern alles um zu siegen«, beendete Derrick mein Gemurmel.
Читать дальше