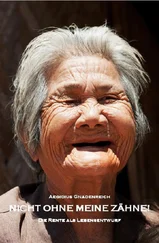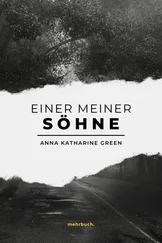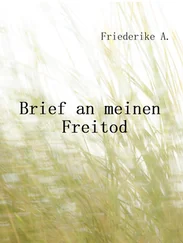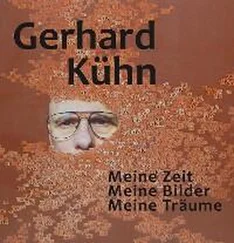Bereits seit Tagen stehen Stasi-Leute vor einem Mietshaus in der Gotlandstraße im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg. Ihr Auftrag lautet: Überwachung von Siegbert Schefke, der hier in einer Wohnung lebt. Von seinen Fenstern aus kann er seine Bewacher sehen. Damit sie sich nicht an seine Fersen heften, steigt er auf den Dachboden und klettert aus der Luke raus. Über ein paar Häuser weiter gelangt er wieder ins Freie. An der Schönhauser Straße wartet bereits sein Freund Aram Radomski. Er ist Fotograf, Schefke Kameramann. Beide wollen die Demonstration von DDR-Bürgern in Leipzig filmen und die Bilder der ARD zuspielen. „Denn wenn dort Schüsse fallen, soll es die Welt erfahren.“ Sie wissen, West-Korrespondenten dürfen schon seit Wochen nicht nach Leipzig reisen, geschweige denn dort drehen.
10.30 Uhr Berlin – Leipzig / auf der Autobahn nach Sachsen
Mit einem Trabant machen sie sich auf den Weg nach Sachsen. Kamera und Fotoausrüstung liegen im Kofferraum. Auf der Autobahn wird ihnen erstmals sehr mulmig zumute. Sie kommen an einem langen Konvoi mit Einsatzwagen von Militär und der Volkspolizei vorbei. „Das war ein sehr beängstigender, bedrohlicher Anblick.“ Beide schweigen minutenlang. In der Leipziger Innenstadt hoffen sie, nicht kontrolliert zu werden. Überall sind hier längst Polizei und Stasi präsent.
13.00 Uhr Leipzig / Ringstrasse
Schefke und Radomski laufen über den Ring. Die Kamera haben sie in einer Plastiktüte versteckt. Sie sind auf der Hut. Überall sind Polizisten und Sicherheitskräfte. Sie machen sich auf den Weg zur evangelisch-re- formierten Kirche am Tröndlinring, denn vom Kirchturm aus kann man gut bis zum Hauptbahnhof sehen. Sie klingeln bei Pfarrer Hans-Jürgen Sievers, berichten ihm kurz, dass sie die Kameramänner seien, von denen das Material für die DDR-Dokumentationen der westlichen Sendungen „Kontraste“ und „Kennzeichen D“ stamme. Sie erzählen weiter, dass sie heute noch das Friedensgebet filmen wollen. Der Pfarrer nickt und gibt sein Einverständnis, sie auf den Turm zu lassen.
16.00 Uhr Leipzig / Tröndlinring 7
Die beiden Männer steigen auf den Turm. Der Hausmeister schließt hin- ter ihnen die Tür ab.
19.00 Uhr Leipzig / Tröndlinring 7
Schefke und Radomski haben sich auf der Kirchturmspitze im Tau- bendreck in Stellung gebracht. Sie blicken um sich und entdecken Stasi-Männer auf den Dächern gegenüber. „Werden sie auch gesehen?“ Sie halten das Rotlicht an der Kamera zu. Was sie dann filmen und fo- tografieren, hätten sie selbst nicht erwartet. Trotz eines Großaufgebots von Bereitschaftspolizei und Staatssicherheit gehen tausende Menschen auf die Straße. Es ist die bis dahin größte Montagsdemonstration in der Stadt. Arm in Arm ziehen die Demonstranten friedlich an der Kirche vor- bei und rufen „Wir sind das Volk!“, „Schließt Euch an!“ und „Gorbi, Gorbi!“ und „Wir sind keine Rowdies“. Die Männer auf dem Turm denken unwill- kürlich an das Massaker auf dem chinesischen Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Juni desselben Jahres. Doch in Leipzig wird nicht geschossen. „Zum Glück!“
21.00 Uhr Leipzig / Tröndlinring 7
Sie schalten die Kamera aus. Sie trauen sich noch nicht auf die Straße. Lange sitzen sie noch bei Pfarrer Sievers in der Küche. Ihnen werden Stullen geschmiert, sie haben Hunger. Erst als es ihnen draußen ruhig erscheint, gehen die beiden ins Hotel „Merkur“. Dort wartet der DDR-Korrespondent des westlichen Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“, Ulrich Schwarz. Er hat seinen Wagen mit Diplomatenkennzeichen am Flughafen Berlin-Schönefeld stehen lassen und ist mit der Reichsbahn nach Leipzig gekommen. Ihm geben sie das Material. Gemeinsam geht es zu dritt mit dem Trabi zurück. Der Motor macht schon etwas schlapp. Mit nur knapp Tempo 60 auf der Autobahn erreichen sie Berlin.
Mitternacht / Berlin
Schwarz schmuggelt das Videoband und die unentwickelten Filme in seiner Unterwäsche in den Westen. Schefke steigt über die Dächer zurück in seine Wohnung. Vor dem Haus lungern nach wie vor Stasi-Leute. Am nächsten Morgen folgen sie ihm wieder zum Bäcker.
10. Oktober 1989 – Tagesthemen ARD
„Wir sind das Volk!“ erklingen die Rufe von 70.000 Demonstranten in Leipzig in den ARD-Tagesthemen. Bürger in beiden Teilen Deutschlands können sehen, dass aus dem Widerstand gegen das SED-Regime eine Massenbewegung geworden ist. Um die Urheber der Bilder zu schüt- zen, sagt Tagesthemen-Moderator Hanns-Joachim Friedrichs, die Bilder stammten von einem italienischen Kamerateam.
2014, Leipzig, ein Vierteljahrhundert später
Wir treffen Siegbert Schefke an seinem Arbeitsplatz beim MDR in der Leipziger Südvorstadt. Inzwischen kann er überall in Deutschland seine Kamera aufstellen, ohne verfolgt zu werden. Er zeigt uns das Funkhaus auf dem alten Schlachthofgelände, führt uns durch Studios, Schnittplätze und Redaktionsräume. Im 17. Stock nehmen wir in einer Sitzecke in großen schwarzen Ledersesseln Platz. Von hier oben kann man gut über die Stadt blicken, die seit der Wende einen enormen Strukturwandel erlebt hat. Schefke ist hier gern zu Hause. Auch der Revolutionsheld von einst hat sich gewandelt. Inzwischen sind seine schulterlangen Wuschelhaare kürzer und grauer geworden. Der Bart ist ab. Falten haben sich in das markante Gesicht des groß gewachsenen Mannes gegraben. Er trägt ein helles Hemd, Jeans und schwarze Halbschuhe. Bequem. Er wirkt entspannt und gelassen.
Der Mauerfall hat sein Leben gewissermaßen in ein Davor und ein Da- nach geteilt. Darauf zurückzublicken, damit ist er inzwischen bestens vertraut. Denn als Chronist der Leipziger Montagsdemonstrationen und Verfolgter der Staatssicherheit ist er als Zeitzeuge rund um den Globus gefragt und bekommt dazu viele Fragen gestellt. Journalisten gibt er ein- mal folgenden Satz auf einen gelben Klebezettel gekritzelt mit auf den Weg: „Je besser wir Diktatur begreifen, um so besser können wir Demokratie gestalten.“ Damit will er für die Arbeit der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin werben. „Schon aus dem einfachen Grund, dass die Stasi über mich acht Aktenordner angelegt hatte und bisher nur drei aufgetaucht sind. Ich will wissen, was da noch drin stand.“ Denn eins weiß er bereits in jungen Jahren genau: „Ich wollte das DDR-System stürzen und nicht irgendwie reformieren, sondern ganz klar beseitigen.“ Natürlich geht ihm diese Aussage heute viel leichter über die Lippen als damals.
Siegbert Schefke wird im Februar 1959 in Eberswalde in Brandenburg geboren. Seine Mutter ist Hausfrau, sein Vater Maurer. Ohne Geschwister wächst er als „Kind der DDR“ in der Generation auf, in der es durchaus noch Hoffnungen und einen Glauben an einen Sozialismus als die bessere Gesellschaftsordnung der beiden deutschen Staaten gibt. Im Laufe seines Lebens aber muss er zusehen, dass viele daran scheitern, resignieren, sich in private Nischen zurückziehen und versuchen, minimale Kompromisse im System DDR zu finden. Einige gehen für ihre Überzeugungen ins Gefängnis. Andere ertragen das Eingesperrtsein nicht mehr, wollen fliehen, stellen Ausreiseanträge, flüchten unter Todesgefahr. Wieder andere protestieren, wollen bleiben, so auch Schefke. „Denn es ist auch meine Heimat, und in der will ich frei leben.“ Dabei erlebt er auch die, die um ihres Vorteils willen Menschen ausspionieren und verraten und so das System über viele Jahre stützen. Schon als Kind erfährt er „den fernen Westen ganz nah“. Denn die Familie lebt in beiden Teilen Deutschlands. Alle drei Geschwister seines Vaters sind noch vor dem Bau der Berliner Mauer 1961 in den Westen, ins Ruhrgebiet gegangen. Kommen sie zu Besuch, holt er sie gemeinsam mit seinem Vater am Grenzbahnhof Friedrichstraße in Berlin ab. „Da bekam ich von den Verwandten oft Mars-Riegel und Adidas-Turnschuhe geschenkt“, erinnert er sich. Seine Schulzeit verläuft DDR-typisch: Er ist bei den Pionieren und in der FDJ. Auch die Teilnahme an der sozialistischen Jugendweihe mit 14 Jahren gehört dazu. Parallel dazu besucht er einmal in der Woche den Gottesdienst in der Kirche. Er wird konfirmiert. „Ansonsten habe ich mich wie viele andere Jugendliche auch für Briefmarken, Mopeds und Judo interessiert.“
Читать дальше