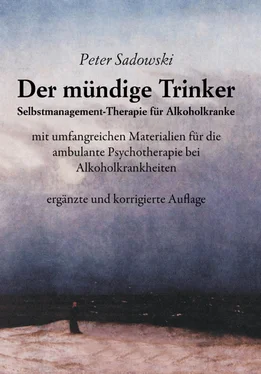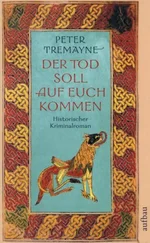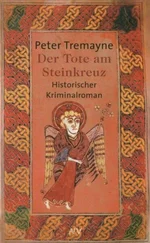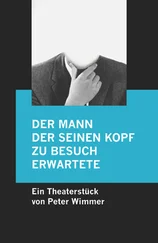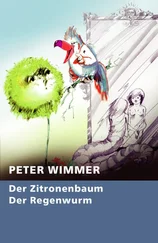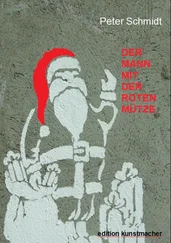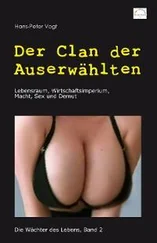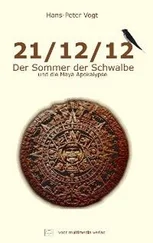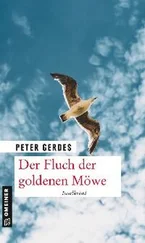Das Erarbeiten eines individuellen Plausiblen Modells über Entwicklung und Bewältigung der Störung Alkoholabhängigkeit ist ein systematischer Weg, den Patienten in den Prozess des Identifizierens von individuellen Therapiezielen einzubeziehen.
Die zweite Quelle für das Identifizieren von individuellen Therapiezielen ist das Alltagsleben innerhalb der Klinik. (Aus diesem Grund ist das Tagesprogramm für Patienten auch nicht vollständig mit Vorgaben gespickt; es bleiben Zeiten, in denen Patienten auch ohne Anregung von außen die eigene Individualität präsentieren.) Im Klinikalltag findet ein fortlaufendes „Scannen“ der Patientenvariablen statt. Auch dieser Prozess soll von Patienten und Therapeuten gemeinsam getragen werden. Jede Auffälligkeit im Erleben und Verhalten von Patienten wird unter dem Gesichtspunkt bewertet, ob es sich bei dieser Auffälligkeit um eine Bedingung handeln könnte, die die Abhängigkeitsentwicklung angestoßen oder aufrechterhalten hat. Alle Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben des Patienten werden dem Patienten zur ausdrücklichen Bewertung angeboten.
Ergebnis dieser Bewertung wird sein, ob die gezeigten Auffälligkeiten etwas Personentypisches sind oder sich aus der Situation oder aus der Wechselwirkung von Situation und Person ergeben haben. Eine Teilmenge der typischen Personenmerkmale sind dann kritische Merkmale, das heißt, diese Merkmale könnten die Abhängigkeitsentwicklung gefördert haben. Aus dieser Menge wiederum werden nur wenige mit großer Intensität verändert werden können. Die veränderungswürdigen Personen-variablen werden möglicherweise vom Therapeuten vorgeschlagen, ausdrücklich als Arbeitspunkt jedoch erst benannt nach einer Entscheidung des Patienten.
Wenn sich die psychotherapeutische Intervention nicht in die gewünschte Richtung entwickeln lassen sollte, wäre es die Aufgabe des Therapeuten, diese Beobachtungen zu einer Hypothese zu verdichten und sie in seinen internen Pool von Hypothesen aufzunehmen. Bei weiteren psychotherapeutischen Interventionen mit diesem Patienten wären diese Hypothesen immer wieder zu testen.
Der Therapeut beobachtet z.B., dass der Patient Konflikte vermeidet. Der Therapeut entwickelt die Hypothese, dass der Patient die mit einem Konflikt verbundenen unangenehmen Gefühle vermeidet.
Im weiteren Verlauf der Behandlung müsste der Therapeut entscheiden, ob er von sich aus diesen möglichen Arbeitspunkt häufiger in den Vordergrund der Aufmerksamkeit bringt oder ob er andere Arbeitspunkte bevorzugt, weil jene vordringlicher oder Erfolg versprechender zu bearbeiten sind.
Der Patient könnte denken, dass er nur besonders oft seine Interessen benennen müsste, um dadurch die Menge seiner Konflikte gewissermaßen automatisch zu verringern. Der Arbeitspunkt des Patienten wäre dann nicht das Aushalten oder Verändern unangenehmer Gefühl im Konfliktfall, sondern das Üben des Thematisierens eigener Interessen bzw. Bedürfnisse.
Auch diese therapeutischen Entscheidungen sind grundsätzlich mit dem Patienten verhandelbar oder wenigstens transparent zu gestalten.
Wenn sich im therapeutischen Alltag Gelegenheiten ergeben, gemeinsam mit Patienten zu lachen oder zu schmunzeln, sollten diese Gelegenheiten genutzt werden. Natürlich ist sorgfältig darauf zu achten, dass Patienten (und natürlich auch Mitarbeiter der Einrichtung) sich nicht verletzt fühlen. Manchmal werden Gelegenheiten zum Lachen verpasst, weil Beteiligte fürchten, dass Herauskehren eines witzigen Aspektes oder Gelächter würden dem heiligen Ernst der Sache nicht angemessen sein. Andererseits kann man überlegen, ob ein befreiendes Schmunzeln oder Gelächter nicht gelegentlich manchem Drama die Spitze nimmt. Grundsätzlich erzeugt das Lachen beim Einzelnen Wohlbefinden. Eine therapeutische Situation wird auf diese Weise mit angenehmen intrapsychischen Zuständen verbunden. Patienten und Therapeut können nach gemeinsamem Schmunzeln oder Lachen hoffen, dass
zum ersten Therapie auch mit angenehmen Gefühlen verbunden wird und dass
zum zweiten in der weiteren Entwicklung auch angenehme Gefühle den Zugang zu Erinnerungen an die Therapie verbessern (siehe auch Kapitel „Zustandsabhängiges Lernen“ Kapitel 1.2.3).
Die Selbstmanagement-Therapie lebt davon, die Wahlmöglichkeiten des Patienten zu vergrößern. Wenn ein Patient nach der Therapie vermehrte Möglichkeiten hat, eine Situation sowohl mit heiligem Ernst zu betrachten als auch die Position eines milde belustigten Beobachters 9einzunehmen, wird er Krisen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit bewältigen.
Zum Grundlagenwissen der Psychologie gehört es schon lange, dass schlecht definierte Probleme die Problemkomplexität erhöhen (siehe z.B. Dörner, Kreuzig, Reither & Stäudel, 1983; Hussy, 1984). Negativ definierte Ziele sind außerordentlich schwierig zu verwirklichen. Die Gestaltpsychologen illustrieren diesen Sachverhalt gelegentlich mit der Formulierung: Woran denkst du, wenn nicht an blau denkst? Kanfer illustrierte das gleiche Problem angehenden Therapeuten (oder Therapeuten in der Weiterbildung) bei mehreren Anlässen Mitte bis Ende der achtziger Jahre in einer Fachklinik in Daun in der Eifel mit dem Reisebüro-Spiel:
Der Therapeut gab den Verkäufer in einem Reisebüro und Kanfer den Kunden. Der Kunde wünschte vom Verkäufer, fortzukommen aus der hiesigen Situation. Und der Verkäufer mühte sich redlich, Vorschläge zu machen. An jedem Vorschlag hatte der Kunde etwas „herumzumäkeln“. Er vermied es auch hartnäckig, Alternativen zum ungeliebten Ist-Zustand zu nennen. 10
In der Lebenspraxis von Mitarbeitern in Kliniken und Beratungsstellen kommen solche Kunden häufig vor: Sie wollen keine weiteren Krampfanfälle und sie wollen die Folgen ihrer Polyneuropathie nach Möglichkeit auch mindern. Stattdessen wollen sie Abstinenz. Und übersehen gelegentlich dabei, dass Abstinenz eigentlich nur das Vermeiden der Verhaltensweisen „Konsum von Alkohol“ bedeutet; das Verschwinden der nachteiligen Folgen wird als weiterer Effekt gesehen. Aus der Sicht des Lösens komplexer Probleme ist das Problem auf diese Weise auf keinen Fall gut definiert. Es handelt sich im Gegenteil um ein negativ definiertes Ziel.
Wenn es Therapeuten gelingt, das ohne Zweifel beim Patienten vorhandene motivationale Potenzial auszurichten, sagen wir, auf zufriedene Abstinenz, dann ergibt sich die Möglichkeit, Zufriedenheit positiv zu definieren.
Als nettes Hilfsmittel hat sich unser „Problemlösetraining“ (siehe Kapitel 8.2) bewährt; in diesem Training ergibt sich für den einzelnen Patienten die Notwendigkeit zum Hierarchisieren von Bedürfnissen und Interessen.
Wer will, kann eine vertikale Verhaltensanalyse als Bottom-up-Strategie verstehen, mittels derer Patienten ihre Oberziele identifizieren können (siehe z.B. Grawe, 1998). Das Hierarchisieren von Bedürfnissen und Interessen wäre demnach eine Top-down-Strategie. Patienten ordnen hier ihre Bedürfnisse und Interessen nach der Wichtigkeit; es werden Entscheidungsregeln vorgeschlagen, die zuerst das Überleben sichern.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.