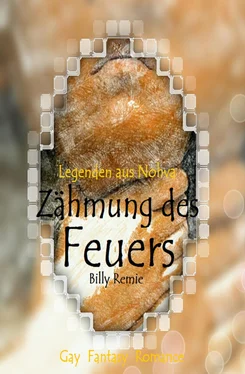»Haben wir Mittel, ihn zu fangen?«, fragte Rahff verzweifelt. »Ihn zu bändigen?«
Der Lord sah ihm eine Weile stumm in die Augen, ehe er bedauernd den Kopf schüttelte. »Wie können wir ohne Magie einen Drachen fangen und zähmen, mein König? Die Kirche ließ alle Hexen verbrennen, die praktizierten.«
Ja, natürlich, jetzt war wieder nur die Kirche daran schuld, obwohl Schavellen selbst ein enthusiastischer Hexenverfolger gewesen war.
So eine verdammte Scheiße … Wäre Rahffs Vater nicht schon tot, hätte er ihn jetzt für all das Chaos umgebracht. Hätte er sich kein anderes Fundament als die Kirche für seine Herrschaft aussuchen können? Verflucht seien die Götter, wie sollten sie das überleben?
Rahff stützte das Gesicht in die Hände und trug ihnen auf: »Findet einfach meinen Sohn.«
Cohen war ihm das wichtigste im Leben. Er war sein Erstgeborener, der Sohn, auf den er stolz war wie auf keinen anderen.
Er hatte Raaks und Sevkin verloren, die ihm seine zweite Frau geschenkt hatte, aber obwohl ihr Verlust ihn hart getroffen hatte, war die Vorstellung, Cohen zu verlieren, noch einmal das Tausendfache schlimmer.
Cocoun und Lord Schavellen erhoben sich, ihre Stühle wurden zurückgeschoben, der ansonsten stille Raum wurde von dem Geräusch ratschender Stuhlbeine über Holzboden erfüllt. Langsamen Schrittes trotten sie davon, als habe ihr Auftrag keine Eile.
»Und findet ihn besser lebend«, rief er ihnen nach. Leise fügte er für sich selbst hinzu: »Oder ich hänge euch beide für eure Inkompetenz!«
Wenn Cohen nicht gefunden und zurückgebracht wurde, waren sie alle dem Untergang geweiht. Er war der einzige Mann, dem Rahff es zutraute, Nohva zu regieren. Vielleicht sogar den Krieg zu beenden.
Aber Rahff kannte seinen Sohn sehr gut und er hatte schon seit einiger Zeit – seit Sevkins Hinrichtung, um genau zu sein – bemerkt, dass Cohen nicht mehr der Mann war, zu dem Rahff ihn erzogen hatte.
Cohen hatte schon immer ein eigenes Verständnis für die Welt gehabt. Er war kein Dickkopf, nicht so wie er. Cohen war klug wie seine Mutter, beherrscht, sein Herz saß am rechten Fleck.
Er gehörte nicht auf diese Seite des Krieges, das hatte Rahff von Anfang an gewusst. Sein Sohn war nicht wie diese fanatischen Männer, nicht wie Schavellen und sein Sohn es waren, die dämliche, altmodische Gesetze ausnutzten, um ihre eigene kranke Vorstellung einer gestrickt getrennten Welt durchzusetzen. Cohen war jemand, der nach Gerechtigkeit trachtete, die er auf dieser Seite des Konflikts gewiss nicht fand.
Als Sevkin noch lebte, war Cohens Sinn für Gerechtigkeit kein Problem gewesen. Rahffs jüngster Sohn vermochte es wie kein anderer, Cohen … abzulenken. Ihn zu kontrollieren und zu manipulieren. Doch ohne Sevkin hatte Rahff Angst, dass er Cohen auf eine Weise verlieren konnte, die ihm das Herz brechen würde.
***
Ihre Schritte hallten laut durch die hohen Flure der königlichen Burg, während sie sich schleunigst von der Leibgarde entfernten, die vor dem Ratszimmer des Königs positioniert waren.
»Ich werde hier bei dem König bleiben«, beschloss Cocouns Vater, »du reitest nach Dargard zurück und mobilisierst Truppen.«
Cocoun hatte keine Lust, ausgerechnet für den Mann Rettung zu schicken, den er abgrundtief hasste. »Macht das doch selbst, Vater, ich habe andere, vergnüglichere Verpflichtungen.« Zum Beispiel, die Geburtenrate unter den Dienstbotinnen im Palast erheblich ansteigen zu lassen, dachte er lüstern. Nicht, dass sie ihm freiwillig zur Verfügung standen, das wäre ja langweilig.
Als sie sich außer Hör- und Sichtweite der Wachen befanden, packte der Lord Cocoun bei der Kapuze seines purpurfarbenen Umhangs und stieß ihn in eine kleine Nische in der Wand, in der ein Bild der Hure hing, die Rahff der Erste zu seiner Frau gemacht hatte, nachdem er die Burg zurückerlangt hatte. Ein grässliches, dürres Weib, dem selbst auf dem Gemälde die Falschheit in den schmalen, kleinen Augen stand.
Cocoun fuhr zu seinem Vater herum, der einen knochigen, alten Finger auf ihn richtete und ihm die dürre, lange Hakennase ins Blickfeld schob.
»Jetzt hör mir mal gut zu, mein Sohn«, zischte der Lord leise, »du tust, was ich dir sage, und zwar besser unverzüglich.«
Die Dringlichkeit in der Stimme seines alten, schwachen Vaters ließ Cocoun aufhorchen.
Der Lord leckte sich nervös über die trockenen, schmalen Lippen, als er etwas ruhiger aber nicht minder bedeutungsvoll fortfuhr: »Du musst deine besten Männer ausschicken. Der Blutdrache darf unter keinen Umständen überleben!«
Cocoun begann zu verstehen, trotzdem runzelte er fragend die Stirn. »Welchen Vorteil bringt dir sein Tod?«
Der Lord schlug Cocoun die flache Hand ins Gesicht, so das Cocouns Kopf leicht herumflog. Er war Schläge von seinem Vater gewöhnt, auch wenn sie ihn immer wütend machten, ließ er es über sich ergehen und sah dem Lord wieder kühl in die Augen.
»Denk einmal nach, Cocoun, und streich die Perversität, die dich deines Verstandes mehr als mir lieb ist beraubt, aus deinem Kopf!«
Der Lord sah sich über die Schulter, um sicher zu gehen, dass sie noch ungestört sprechen konnten, ehe er eindringlich weitersprach: »Der Blutdrache wird mehr als einmal in den heiligen Schriften unserer Kirche erwähnt. Er ist ein Symbol für die Einigkeit der Völker Nohvas. Verstehst du nicht? Er ist das Glied, das alles zusammenfügen kann! Wenn er in Erscheinung tritt, werden sich sogar die Angehörigen der menschlichen Kirche – nicht nur die unterdrückten Luzianer – gegen die wenden, die eine strikte Trennung der Religionen und Völker anstreben. Sie werden sich gegen uns wenden! Er darf nicht überleben!«
Ein bösartiges Lächeln breitete sich auf Cocouns Lippen aus, als er zu begreifen begann.
»Vater«, sagte er selbstzufrieden, »Ihr müsst lernen, Euch deutlicher auszudrücken. Wenn es ums Töten geht, braucht Ihr mich gewiss nicht zweimal bitten. Ich werde sofort meine besten Krieger kontaktieren. So schwer kann es ja nicht sein, einen Drachen zu töten.«
Sie würden ihn im Schlaf überraschen, wenn er noch in Menschengestalt war, überlegte sich Cocoun. Zu schade, dass er nicht selbst mitkommen konnte, aber er war einfach zu wertvoll für solch eine niedere Aufgabe. Wozu sollten sonst die ganzen Bastarde gut sein, die in die Armee gezwungen wurden? Sollten sie sich mal als nützlich erweisen.
Der Lord entspannte sich etwas und trat von seinem Sohn zurück. Er nickte einmal bestimmend und bedeutete Cocoun, sich unverzüglich auf den Weg zu machen.
Mit einem hinterlistigen Lächeln verließ Cocoun die Burg und beauftragte seine Diener, alles für die Abreise vorzubereiten.
Während er sich zu den Gemächern seiner Gattin begab – wobei er zugeben musste, dass er öfter bei ihren Zofen gelegen hatte als bei ihr – dachte er daran, dass er gleich noch eine weitere Bedrohung aus der Welt schaffen konnte.
Cohen.
Dieser dreckige, kleine Bastard war ihm seit ihrer frühen Kindheit ein Dorn im Auge. Dabei waren sie eigentlich einst gute Freunde gewesen. Aber dann musste Cohen ja ausgerechnet zu diesem Mann heranwachsen, der allein aufgrund seiner verwegenen Ausstrahlung auf Frauen wirkte wie Licht auf Motten.
Natürlich galt Cocoun weiterhin als schönster Mann der Ebenen, zudem war er wohlhabend und würde bald der Lord der Hauptstadt werden. Aber trotzdem hatte Cohen immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wenn sie zusammen waren.
Des Königs Bastard. Vielleicht lag es einfach nur daran, dass er ein Bastard war und die Frauen sich zu Verbotenen hingezogen fühlten. Oder es lag daran, dass er – auch wenn er nur ein Bastard war – ein Sohn des Königs war. Möglicherweise hatte es auch etwas mit seiner stillen, unergründlichen Art zu tun. Er wirkte unnahbar auf jeden, der ihn nicht kannte, und je mehr er schwieg, je mehr strengten sich die Frauen an, ihm zu gefallen.
Читать дальше