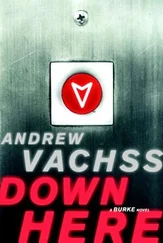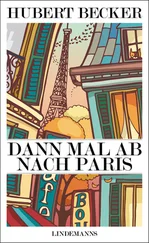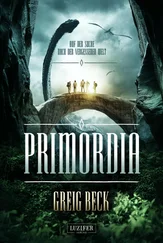Vorgeschriebenes Leben, das heißt auch: nur nicht auffallen.
Mitlaufen, Maul halten, Friede, Freude, Eierkuchen und immer schön freundlich grüßen, denn schließlich kennt hier jeder Jeden in dieser kleinen Stadt im schönen Havelland. Wer hat den tollsten Garten, wo gibt es Ersatzteile, wer darf nach Jahren des Wartens einen FDGB-Ferienplatz in Anspruch nehmen? Medaillenverteilung, singen im Chor, Brigadefeiern, und wer kriegt wieder ein Westpaket? Neid!
Das war der Alltag.
,,Bück-dich-Ware“ war die Ware unter dem Ladentisch, die nicht für Jeden gedacht war und „Geb ich dir, dann gibst du mir“ hieß tauschen bei jeder Gelegenheit.
Ja, tauschen. bestechen und anstehen, jeden Tag und immer und überall.
Sozialistischer Alltag. Sich freuen, wenn es dann im Konsum nicht nur Kohl. Kartoffeln und Zwiebeln gab, sondern auch Tomaten und Gurken oder vielleicht sogar Apfelsinen. Ein kleines ostdeutsches Städtchen in dem wir wohnten, mit einer Hauptstraße und nur wenigen Geschäften, in deren kargen Fensterauslagen kaum etwas lag, für das es sich lohnte, anzuhalten und hineinzuschauen.
Normaler DDR-Alltag, nichts Besonderes.
Früh aufstehen, unter Zeitdruck zur Arbeit rennen und dann zeitig ins Bett fallen, damit man am nächsten Morgen wieder gewissenhaft und pünktlich seinen sozialistischen Gang gehen kann. Brav, Genossen. weiter so. Über Langeweile kann doch wirklich keiner klagen, oder? Alles zum Wohle des Volkes und seiner sozialistischen Ideale.
Und doch umhüllt meine kleine, eigentlich unscheinbare Heimatstadt ein Hauch von Charme, in den ich mich verliebte, schon damals. als ich im Alter von zwanzig Jahren hierher zog. Dieses Städtchen liegt unweit eines traumhaft schönen Wald- und Wiesengebietes an der Havel. Viele kleine und große Seen, die mit ihrem klaren, türkisfarbenen Wasser jeden Freizeit- und Erholungssuchenden gern zum Baden einladen, findet man hier. Ein richtiges Naherholungsgebiet für das Arbeiter- und Bauernvolk. Viele Nachbarn und Freunde haben sich hier mit viel Fleiß ihren eigenen kleinen Bungalow gebaut. Nach getaner Arbeit trifft man sich zum gemeinsamen Würstchengrillen und Steakbraten. Und so manches Bier zischt durch durstige Kehlen. Hier wird gebadet und geangelt und gemeinsam mit den Nachbarn gefeiert.
Nach einigen Bierchen und Schnäpschen erzählt einer dem anderen heimlich die neuesten Parteiwitze und man lacht über unnütze Spruchbänder an den Straßen und Häusern, die die Parteileute wieder einmal über den bröckelnden Putz der Fassaden plazierten. Was da steht, glaubt eh keiner. Planerfüllung hundert Prozent und mehr. Wenn alles so gut läuft, warum gibt es dann nichts Gescheites in den Geschäften zu kaufen? Diese Frage stellten sich alle. Hier lebt eine große und vor allem junge sozialistische Gemeinschaft friedlich nebeneinander und friedlich miteinander.
Ein verträumtes, unscheinbares Städtchen. Offene Türen, offene Herzen, aber auch alles geregelt, alles vorgeschrieben und sozialistisch kontrolliert. Nur nicht auffallen. Sozialistischer Alltag, und alle machen mit. Ein Verbund von Sprücheklopfern. Besserwissern, Duckmäusern, intelligenten und fleißigen Menschen, die den Alltag zu meistern wußten.
Hier gibt es die Gleichberechtigung der Frau. Hier darf sie nicht nur, hier muß sie als Werktätige mit ihren männlichen Kollegen und Genossen mithalten.
Kinderkrippen und Kindergärten waren für alle da und noch dazu so billig.
Einfach toll, einfach bequem, einfach sozialistisch. Den ganzen Tag für die Produktion da sein, aber leider nur wenig Zeit für die eigenen Kinder haben, denn die werden im Kindergarten oder im Schulhort abgeliefert, so sah es aus. Das sozialistische Leben war ein durchgeplanter Tag, voll mit unnötigen und langweiligen Versammlungen und Weiterbildungsveranstaltungen, die jeder arbeitenden Mutter die kostbare knappe Freizeit und den Rest an Nerven rauben.
Stillhalten, mitlaufen„ ja“ sagen, und bitte nicht aus der Reihe tanzen.
Sozialistisches Leben im Mittelstand und mit allgemeiner Herzlichkeit untereinander.
„Lisa, hallo, Lisa! Mensch, was ist los!“.
Ich zucke in meinem Sessel zusammen und gucke ungläubig in zwei große blaue Augen. Cordula, meine Zimmernachbarin, steht plötzlich vor mir. Es dauert ein paar Augenblicke, bis ich antworten kann.
„Was ist los? Wo bin ich?“
„He, Lisa, he. Wach auf! “
Sie nimmt mich in ihre Arme und rüttelt mich. Plötzlich heule ich los wie ein kleines Kind. Britta kommt hinzu und sieht Cordula fragend an. Die zuckt ungläubig mit den Schultern und reicht mir ein Taschentuch. Ich putze mir die Nase und fühle mich ein
bißchen verlegen. Britta reicht uns einen Teller mit belegten Broten. Greift zu, die Küche ist offen. Das Personal ist weg. Keiner da. Heute ist Selbstbedienung. Essen hält Leib und Seele zusammen. Ich nicke dankbar und greife mir ein Käsebrot.
Es ist kalt im Zimmer, und ich bin wieder allein, denn die beiden sind gegangen. Sie können mit mir nichts anfangen. Lisa Trauerkloß. Die Heizung ist an und klopft leise ihren eigenen Takt. Sie nervt mich gewaltig. Trotzdem, irgendwie kommt keine Wärme hier an. Ich hole meinen Schal aus dem alten Holzschrank und wickele mir den um den Kopf. Ich will jetzt schlafen und lege mich ins Bett. Aber ich finde keinen Schlaf. Verdammt, ich fühle mich doch so müde, so, als ob ich einen 10-km-Langlauf hinter mir hätte. Meine Gelenke schmerzen, und ich spüre alle meine Knochen. Rheuma. Wo sind die Tabletten? Ich krame im Nachtschrank und nehme eine. Schleppe mich wieder ins Bett und hoffe auf Schlaf. Lieber Gott, du dort oben, schicke mir doch endlich mal ein paar Minuten Schlaf. Ich beginne, Schäfchen zu zählen. Aber auch das nutzt nichts. Mein Gehirn macht nicht halt, es arbeitet ohne mein Zutun weiter. Ich will nicht. Nein, bitte nicht denken, nicht grübeln.
Was ist schiefgelaufen in den vergangenen Jahren? Was hat mich so kaputtgemacht? Wo ist unsere große Liebe geblieben? Bruno und Lisa, das Traumpaar. gibt es schon lange nicht mehr. Diese einmalige große Liebe hat sich aufgelöst. Sie ist ins Universum, ins Unbekannte entschwunden. Ich bin voller innerer Zerrissenheit und denke zurück an meine Ehejahre. Woher bloß kommt diese Wut, dieser Zorn, der schon körperlich weh tut? Diese Unzufriedenheit und Leere? Wo ist meine Lebensfreude hin? Ich denke an den letzten Winter 1988 zurück und suche eine Erklärung für meinen schlechten körperlichen Zustand und meine Mutlosigkeit.
Es ist noch stockduster draußen, kurz vor sechs Uhr morgens.
Bruno ist schon zur Frühschicht gegangen. Er hat es nicht weit. Nur fünfzehn Minuten Fußweg bis zur Fabrik. Unsere beiden Mädchen müssen zur Schule, wollen aber wieder einmal nicht aufstehen. Das verstehe ich gut, denn es geht mir genauso. Es ist noch so früh, besonders für Kathleen. Sie ist jetzt sieben Jahre alt und ein echter Morgenmuffel. Sabine ist vernünftiger und reifer. Sie überwindet sich schneller, denn sie geht gerne in die Schule. Müde sieht auch sie aus. Es ist viel zu früh für die beiden, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit im kalten Winter. Sabines lange Haare verdecken ihr hübsches Gesicht, als sie sich über das Waschhecken hängt und ausgiebig ihre Zähne putzt. Sie hat schöne, weiße Zähne und legt auf ihr Aussehen großen Wert. Ja, mit vierzehn Jahren darf man schon etwas eitel sein. Meine Große, sie ist so ein liebes Mädchen und eine gute Schülerin. Ich bin so stolz auf sie.
„Kathleen, bitte steh jetzt endlich auf. Du kommst zu spät zur Schule und ich zu spät in meinen Kindergarten.“
Ich mache in allen Räumen Licht an, und leise Musik klingt durch unsere kleine Wohnung im sechsten Stockwerk unseres 08/ l5-Betonplattenbauhauses, wo es keinen Fahrstuhl gibt.
Draußen ist es bitterkalt. Ich muß den Kindergarten aufschließen. Die ersten Kinder warten meist schon. Ihre Mütter müssen pünktlich in den Ställen sein, denn die Kühe und Schweine, Schafe und Pferde, die es dort in diesem kleinen Kleckerdorf, in dem ich arbeite, gibt, warten auf ihr Futter.
Читать дальше