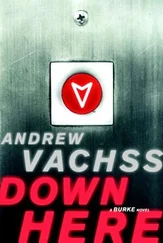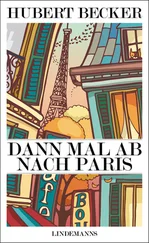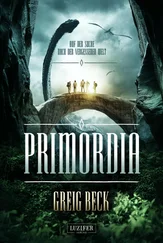In dieser Zeit, am 4. November 1989, beginne ich, Lisa Kleinschmidt aus einer Kleinstadt nahe der Stadt Brandenburg an der Havel, eine ärztlich verordnete Kur in der Kurklinik Meeresblick in Zingst auf der Halbinsel Darß.
Die Vorboten des nahenden Winters umgeben mich. Wo ist das Jahr geblieben? Nicht mehr lange, und es ist Weihnachten. Das Fest der Freude, das Fest der Familie.
Aber das hat für mich in diesem Augenblick des Alleinseins an Bedeutung verloren, so wie alles in meinem Leben. Behutsam öffne ich das Fenster meines kleinen Zimmers hier in der Kurklinik. Atme ganz tief die kühle, klare Meeresluft der Ostsee ein. Eine innere Ruhe und Entspannung macht sich leise in meinem Körper breit. Dieses Gefühl habe ich schon so lange nicht mehr gehabt. Sich auf sich selbst besinnen zu dürfen, einmal nicht nach den Regeln der anderen hin und her gestoßen zu werden, nicht benutzt oder gar ausgenutzt zu werden. Diese Ruhe tut mir gut. Sie streichelt mein trauriges, müdes Herz. Die kühle Nachtluft weht mir meine langen braunen Haare aus dem Gesicht, und ich schließe die Augen.
Lisa Kleinschmidt, was ist nur aus dir geworden? Wo ist deine Lebensfreude, deine Kraft, dein Witz, dein Lachen, deine Phantasie, deine unbeschwerte Begeisterung für Neues und Entdeckenswertes geblieben?
Ich brauche ein bißchen Kraft, das Fenster zu schließen. Es stöhnt von den vielen Jahre, die es hier nun schon in den Angeln hängt. Altes Fenster, altes Haus, alte Lisa. Ich bin siebenunddreißig Jahre alt, fühle mich aber um viele Jahre älter, müde und abgenutzt. Genau so wie diese klapprige, alte Kurklinik in der ich nun bin. Überall bröckelt der Putz ab. Zu viele haben darauf herumgetrampelt. Nichts wurde zum Erhalt getan.
Meine Tasse Tee steht noch auf dem Tisch. Jetzt ist er kalt. Ich war mit meinen Gedanken wieder einmal woanders, hatte sie vergessen. Ich vergesse im Moment so viele Dinge und stecke so richtig tief in einer Krise, und die sagt mir: »Macht doch alle, was ihr wollt«
Meine Lebensfreude ist dahin, und ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Wenn ich mich hier im Zimmer aufhängen würde, wäre alles vorbei und es wäre endlich Schluß. Eine innere Stimme sagt mir, mach es, und dann wieder, nein. Du hast zwei kleine Töchter, die dich brauchen. Aber brauchen sie mich wirklich? Ich habe nie genug Zeit für die beiden gehabt, bin immer nur im Dauerlauf von einem Termin zum anderen gehetzt. Sicherlich, ich habe mich um die beiden gekümmert, so gut es ging, und habe mein Bestes getan, aber meist immer nur unter Zeitdruck. Dafür ist Oma die Beste. Die hat immer genügend Zeit und erlaubt zudem auch alles. Sie macht sich nicht die Mühe, auch einmal nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Den Kindern ist es egal, welche Regeln das Leben schreibt. Hauptsache, sie haben ihren Spaß. Also versuchen sie immer wieder aufs Neue, diese Regeln zu brechen, um zu sehen, wie die Mama darauf reagiert. So, wie halt alle Kinder dies tun. Die Mama ist von Beruf Erzieherin, Kindergärtnerin, und müßte es eigentlich besser wissen. Aber wenn Mama Forderungen stellt, die für das Wohl der Kinder und ihrer Entwicklung gut und wichtig sind, dann ist sie meist wieder die Böse. Dann gehen sie zur Oma und beschweren sich. Keine guten Voraussetzungen für einen harmonischen Feierabend im Kreise der Familie. Schön wäre es, wenn dann wenigstens der Vater der Kinder mit am gleichen Strang ziehen würde. Aber Bruno will seiner Mutter nicht in den Rücken fallen und seine Ruhe haben. Er steht zwischen den Fronten und hält sich raus. Die Diskussionen zwischen uns bringen nichts ein, und irgendwann gebe ich ratlos und enttäuscht auf.
Macht doch alle, was ihr wollt.
Ich zucke zusammen, denn nebenan knallt eine Tür. Der Knall hallt laut durch den langen Korridor des Kurhauses und pflanzt sich fort von einem Ende zum anderen. Hier soll ich mich nun erholen? Kraft tanken für die liebe Familie und für das sozialistische Vaterland? Vier lange Wochen Kur, weit weg von meinem Zuhause. Der Gedanke frustriert mich, und ich schaue nach meinem Strickzeug. Stricken soll doch angeblich so entspannend sein. Gedankenverloren gleitet meine Zunge über meine trockenen Lippen. Hoffentlich hole ich mir hier keinen Herpes. Ich hocke mich im Schneidersitz auf mein Bett und stricke an dem Pullover, den ich meiner ältesten Tochter Sabine mitbringen möchte. Meine Finger wollen nicht so richtig, und es fallen mir zwei Maschen runter.
Auch das noch. Vielleicht sollte ich mir nun doch endlich mal eine Brille zulegen. Mein Kopf läßt mir keine Ruhe. Meine Gedanken gehen zurück, zurück auf soviel gelebtes Leben. Fast siebzehn Jahre Ehe, Ehe im Sozialismus. Bruno, meine erste große Liebe, mein Held, mein Traummann. Braune Haare, braune Augen, groß, sportlich, fleißig. Ein Muskelpaket mit tellergroßen Händen, in denen bequem ein Ball verschwinden kann. Brigadier in der großen Schmiede und Torwart im örtlichen Fußballverein. Er steht im Tor, im Tor und ich dahinter. Dieses Lied durfte natürlich auf unserer Hochzeitsfeier nicht fehlen. Der Topf hatte seinen Deckel gefunden. Wenn die Welt unsichtbar wird und du dich nur noch nach dem anderen sehnst, dann muß das die wahre Liebe sein. Mit Sternen in den Augen, weichen Knien und Blitz und Donner im Bauch. Nur er und ich, ich und mein Bruno. Alles wollten wir besser machen als die anderen und auch besser als unsere Eltern. Wir hatten uns, unsere Arbeit und unsere unendlich große Liebe zueinander, die uns Flügel verlieh. Wer uns sah, wußte, die zwei passen zusammen, sind wie füreinander gebacken. Zwei, die sich gefunden hatten. Unser sozialistisches Vaterland gab uns Frischvermählten zum Start in die Ehe 7000,- Mark Kredit. Um eine Rückzahlung mußten wir uns nicht kümmern, denn die konnten wir mit Hilfe zweier Kinder, die wir dann auch prompt in diese unsere sozialistische Welt setzten, ableisten. Zwei Wunschkinder, die unsere Liebe bereichern sollten, und auf die wir uns beide wahnsinnig freuten. Eine glückliche Mutter und ein stolzer Vater. Das Leben war schön für uns. Einfach, aber schön. Man paßte sich dem sozialistischen Alltag an, denn man konnte ja doch nichts ändern. Verliebte, die sich mit Tempo und Freude ins Lehen stürzen, brauchen nur sich selbst. Bruno in seiner Schmiede, und ich in meinem kleinen Kindergarten. Die Arbeit mit den Kindern füllte mich aus, machte mich glücklich. Leben im Sozialismus bedeutete aber auch für uns, unter einem Dach zu leben mit den Schwiegereltern, die zum Glück ein kleines Häuschen hatten. Eine eigene Wohnung zu bekommen war schwer, fast hoffnungslos. Also hieß es anmelden, warten, hoffen, einschränken und wieder hoffen.
Alltag im Sozialismus. Vier Jahre wohnen in einem Zimmer.
Zwanzig Quadratmeter für zwei Personen, und dann mit Baby. Vier lange Jahre warten auf die erste eigene kleine Wohnung, eine Zweizimmerwohnung mit Bad und Küche im modernen Neubaublock. Heiß begehrt, schwer herbeigewünscht und so dringend gebraucht. Sozialistischer Alltag. Einheitskuchen für alle und immer Arbeit für jeden, auch für diejenigen, die gar nicht wollten. Brigadefeiern. Weiterbildung, Gartenpflege. Fußballtraining. Handarbeiten. Kegelverein, Volksfeste. Bitten und betteln, rennen und tauschen, ranschaffen, was der sozialistische Einzelhandel nur zaghaft und häppchenweise unter der arbeitenden Bevölkerung verteilte.
Parteiversammlungen, Westfernsehen gucken und die große weite Welt da draußen mit großen Augen vom Fernsehsessel aus verfolgen. Einkaufen im Delikatladen mit Ostgeld zum Umtauschkurs eins zu fünf oder im Intershop, wenn man dann Westgeld hatte. Hier gab es alles, wirklich fast alles. Allein schon das Hinsehen und der ungewohnt berauschende Geruch von duftender Seife und parfümiertem Waschpulver gab den DDR-Hausfrauen das Gefühl, abseits zu stehen, und schürte die Wut im Bauch bei so vielen.
Читать дальше