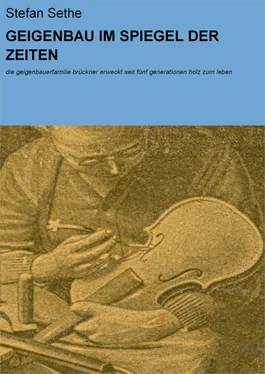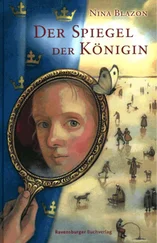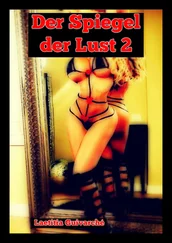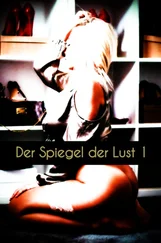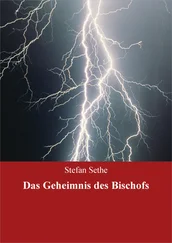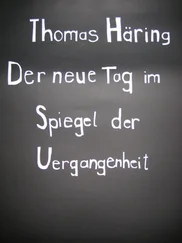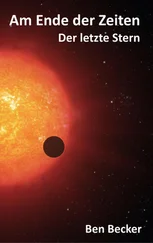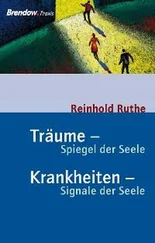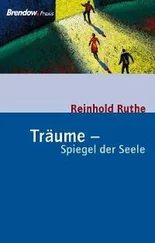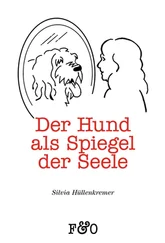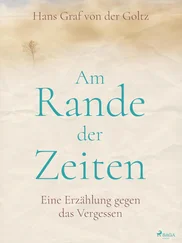Spätere Modellveränderung waren veränderten Aufführungsgewohnheiten geschuldet. Die Instrumente vor 1750 waren meist für kleinere Säle, schwächere Besaitung, elegantere Spielart und einen tieferen Kammerton gebaut worden. Veränderungen in der Aufführungspraxis, insbesondere die größeren Säle und Orchester, machten auch Veränderungen bei den Instrumenten erforderlich. Der Hals der Geigen wurde verlängert, der Steg erhöht, was wiederum eine größere Neigung des Halses erforderte. Diese Umwandlungen waren ca. 1800 beendet, und weitere 50 Jahre später waren auch nahezu alle früher gebauten Meistergeigen umgebaut worden, wobei man selbst vor den großen Namen wenig Respekt zeigte. Instrumente von Amati, Stradivari, Guarneri etc. gibt es nur noch ganz vereinzelt im musealen Originalzustand.
In dem Maß, wie sich eine gewisse Vereinheitlichung des Streichinstrumentenbaus durchsetzte, kam es gleichzeitig zu einer Dezentralisierung der Werkstätten. Neben Italien entwickelte sich in Frankreich ein eigener Geigenbau. Auch im süddeutschen Raum gab es hervorragende Geigenbaumeister. Berühmt wurden hier vor allem der 1618 geborene Tiroler Jakob Steiner. Gemessen an den Fälschungen, wobei in späteren Jahren seine nachgedruckten Geigenzettel in minderwertige Instrumente eingeklebt wurden, waren seine Instrumente sogar beliebter und berühmter als jene des nach ihm in Italien wirkenden Stradivari.
In Süddeutschland entwickelten sich anschließend regelrechte Stammsitze von Geigenbauern. Matthias Klotz war in Mittenwald der Begründer einer Dynastie von 36 Geigenbauern. Die Fichtls stellten 25 Berufskollegen.
Etwa Mitte des 17. Jahrhunderts beginnt die Geschichte des vogtländischen Geigenbaus. Protestantische Auswanderer aus Böhmen brachten den wichtigen, neuen Wirtschaftszweig nach Markneukirchen und Klingenthal. Am 6. März 1677 bestätigte Herzog Moritz von Sachsen die Gründung der ersten Geigenbauer-Innung von Markneukirchen, zu der sich zwölf ins Vogtland eingewanderte böhmische Exulanten zusammengeschlossen hatten. Um die Qualität und Integrität der neuen Geigenproduktion zu gewährleisten, stellte die Innung strenge Regeln auf: Bewerber mussten aufwendige Meisterstücke präsentieren, hohe Aufnahmebeiträge entrichten und einen Fürsprecher gewinnen, der ihre Bewerbung unterstützte.
Was zeichnet die vogtländische Violine aus? Kurz gesagt: Eine Typisierung ist nicht möglich. Eine einhellige Antwort zu geben ist schwierig, wenn nicht geradezu unmöglich, ein Schema zu nennen ausgeschlossen. Von Anfang an bauten die Geigenbauer des Vogtlandes nicht über einer Form, sondern schachtelten frei auf.
Auf dieser Erkenntnis fußend stellte Christine Kröhner in ihrer Diplomarbeit 1981 “ Vogtländische Geigen von den Anfängen bis etwa 1850. Untersuchungen zu ihrer Originalgestalt ” am Korpus der meisten Vogtländer zumindest eine Seitengleiche fest. Allerdings: „ Eine etwas oder stärker ausgezogene flache Oberbügelform ist schon nicht mehr als allgemeingültig zu betrachten. Die Vielfalt der vogtländischen Modelle ist auffällig. Zu den rein äußerlich erkennbaren Merkmalen der einzelnen Regelteile kommen die nicht ohne weiteres sichtbaren im Inneren der Violine. Bautechnische Kennzeichen, wie eingeschobene Oberzargen im Oberklotz oder Halsbefestigungen und -lagerungen haben ebenso wenig ihren Gemeinplatz. Die Eigentümlichkeiten in der Gestaltung - beispielsweise der Schnecke - sind bei den verschiedenen familiären Schulen unterschiedlich. Hinsichtlich der Wölbung gibt es flache und höhere Typen, etwa nach Jacob Stainer gehend. Vollkommen rundumlaufende Hohlkehlen zeichnen diese Modelle aus. Selbst die im oberen Drittel als Mulde gestalteten Seitenpartien des Wirbelkastens bleiben auf einzelne Familienschulen beschränkt.
Oftmals besteht eine deutliche Demarkationslinie zwischen den glatten unteren zwei Dritteln der äußeren Seitenwand und der soeben genannten Mulde. Die Schneckenformen sind mannigfaltig und selbst bei ein und demselben Geigenmacher verschieden ausgefallen.
Eine oft erwähnte, sog. gedrückte oder gequetschte Form der Schnecke, also keine gleichmäßige Rundung, kann nicht als gemein vogtländisch angesprochen werden. Gerade die Schnecken sind individuell geformt. Auch Größe und Position sind unterschiedlich. Breite Ohren – schmale Ohren, ausgeprägter Mittelgrad: Alles kommt vor. Schwach gekehlt - tiefer ausgestochen: Das sind ebenfalls individuelle Merkmale und keinesfalls fürs Vogtland generell gültige Normen. Was man vogtländischen Schnecken nachsagt, sind nach vorn unten nicht tief genug gekehlte, zeitig aufhörende Rinnen über dem eigentlichen Wirbelkasten. Aber dieses Merkmal besitzen andere Geigenbauschulen ebenso. Einfaches vogtländisches Ahornholz, kein Riegelahorn, und einheimische oder aus dem Böhmerwald stammende, engjährige Fichtendecken sind die meist verwendeten Materialien. Es gibt jedoch auch unregelmäßig eng geflammten Ahorn aus obervogtländischen Höhenlagen bis etwa 940 m NN (Kielberg 942 m, Aschberg 936 m). Hälse und Griffbretter aus wilden Obstbaumgehölzen, die Griffbretter furniert und/oder dunkel gebeizt, kommen vor. Als Standardausführungen können sie nicht gewertet werden. Dasselbe gilt von Drahtaufhängungen der Seitenhalter und deren Formen, wie das an alten Instrumenten gelegentlich zu beobachten ist.
Die Geigenmacher stellten sich ihre Beize und Lacke selbst her. Die gelbe Gründung mit Safran ist als typisch vogtländisch zu betrachten. Der Lack hat gelbe, goldgelbe oder in allen Nuancen vorkommende braune bis schwarzbraune Farbe und ist oftmals gar nicht so steif und spröde, wie er immer hingestellt wird. Schwarzbrauner Lack mit Drachenblutharzbeigaben feuert in der Abendsonne dunkelrot. Direkte hellrote Farbe kennt der Vogtländer nicht. Klangvorstellungen entsprachen dem jeweiligen Zeitgeschmack. Steilgewölbte Violinen mit schmaler Brust geben im allgemeinen näselnde Töne, oft als Flötentöne bezeichnet. Breitere Modelle in flacher Bauweise klingen weich und zärtlich. “
So unterschiedlich in der Form, so wechselvoll war auch die Geschichte des vogtländischen Geigenbaues. Nie war er frei von Problemen und Verwerfungen. Während der mittlerweile bald 400 Jahre, in denen im Vogtland Musikinstrumente gebaut wurden, genoss Markneukirchen nicht immer einen makellosen Ruf. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts sah sich Carl Wilhelm Heber veranlasst, in seinen Geigen einen zusätzlichen Zettel anzubringen:
„ Viel falsches nachgemacht
Sich da und dort schleicht ein,
Drum sieh mein Petschaft an
Willst nicht betrogen seyn.“
Mag auch der Vorwurf nicht berechtigt sein, im Vogtland seien mehr Geigen gefälscht und mit Faksimilezetteln versehen worden als überall sonst in den Geigenbauzentren, der Konkurrenzdruck war im südlichen Sachsen immer besonders hoch, das Arbeiten am Existenzminimum besonders häufig.
Zwischen Markneukirchen und Klingenthal entspann sich ein Jahrhunderte andauernder Geigenbauerkrieg. So durfte kein Geigenbauer im jeweils anderen Ort seine Instrumente anbieten oder gar verkaufen. Die Zahl der Geigenbauer entwickelte sich inflationär. Von 1750 bis 1850 verzehnfachte sich die Anzahl. Erst das Umschwenken auch auf andere Musikinstrumente brachte eine gewisse Entlastung an der Arbeitsfront. Die Geigenproduktion entwickelte sich dennoch ungebremst weiter.
Tafellieder
zum 200jährigen Bestehen der Geigenmacher-Innung
zu Markneukirchen
am 6. November 1877
1.
Nun wollen wir im dritten Lied
So mancherlei besprechen
Derweil die Andern mit Manier
Sich amüsir’n und zechen.
Und kommt auch buntes Zeug hinein,
Читать дальше