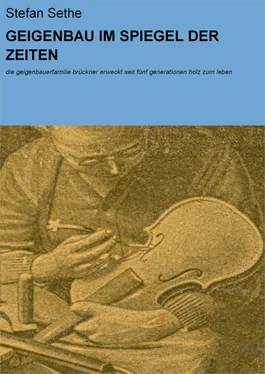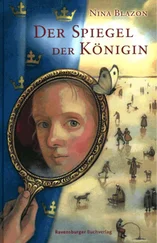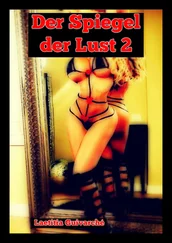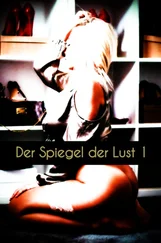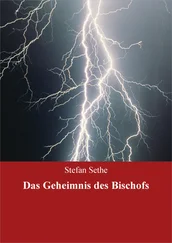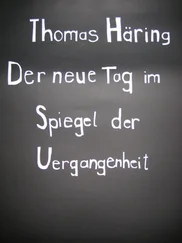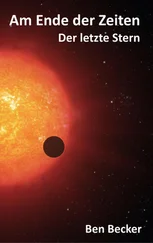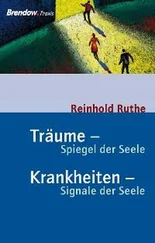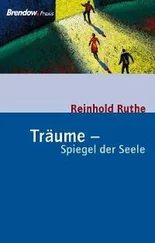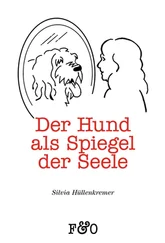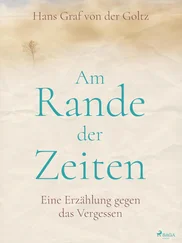Bis ins 18. Jahrhundert waren Volks- und Unterhaltungsmusiker sozial schlecht gestellte städtische Spielleute oder Spezialisten innerhalb der Dorfgesellschaft, welche u.a. auf Dorf- und Stadtfesten die nicht immer sehr geachteten Volksbelustigungen umrahmten. Es gab hier noch keine Arbeitsteiligkeit, nur mündliche Überlieferungen der Musik und eine wenig differenzierte Funktion des Musikmachens. Volksmusiker waren in den Alltag und die Abläufe des Kirchenjahrs eingebunden, übernahmen aber auch die Rolle des Informationsübermittlers, etwa durch den Moritaten- und Bänkelsang. Mit der Industrialisierung kam auch in der Unterhaltungsmusik die Nachfrage nach „professioneller“ Musik.
Die Erfindung des Notendrucks hatte dazu geführt, dass nunmehr auch das Bürgertum sich von der bisherigen Musikantenschar emanzipierte. Die spezifisch bürgerliche Salonmusik entwickelte sich im 19. Jahrhundert. Sie bestand größtenteils aus leichten Arrangements von Kunstmusik für die wohlhabenden Haushalte. Vor allem für das Klavier und kleine Hausmusikensembles wurden leicht spielbare und effektvolle Stücke komponiert. Sie dienten als Spielmaterial für den Musikunterricht. Carl Czernys „Schule der Geläufigkeit“ und andere Übungsmusik bildeten die Ausrüstung für den bürgerlichen Musiklehrer, der als neuer Berufszweig etablierte.
Das Virtuosentum im Konzertsaal belebte den Musikmarkt und schuf die ersten international bekannten Stars wie Niccolò Paganini und Franz Liszt Franz. Ein David Garrett, der zum Entsetzen aller Musikliebhaber meint, den Hummelflug von Rimski-Korsakow in einer Minute und fünf Sekunden spielen zu müssen, was 13 Noten pro Sekunde entspricht, und zeitweilig einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde sichert, braucht für seine zirzensischen Verrenkungen eine exzellente Violine und einen ebensolchen Bogen. Aber auch eine Anne-Sophie Mutter, die als Teenager schon künstlerisch ausgereifter war als es ein Garrett wohl je sein wird oder ein Paganini je war, braucht für ihre sensiblen Interpretationen ein qualitativ ausgereiftes Instrument. Beide spielen heute Geigen von Antonio Stradivari, jene legendären Streichinstrumente des Cremoneser Geigenbauers vom Anfang des 18ten Jahrhunderts, die heute für Millionenbeträge die Besitzer wechseln.
Deutlich wird bei etlichen, ein wenig an Da Vinci bzw. Dürer erinnernden mit geometrischen Kreisen angereicherten Geigenbau-Skizzen auch eine gewisse Mathematisierung der Geigenbaukunst. Zunehmend wurden physikalische Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt, wenngleich der Status der klanglichen Experimentalphysik erst in der Neuzeit überschritten wurde.
Demgegenüber wurde die Musik erst mit Aufkommen der gefühlsbetonten Romantik zu den Künsten gerechnet. Bei den antiken Pythagoreern galt sie noch als mathematische Wissenschaft, die in Bezug gesetzt wurde zur Ordnung des Kosmos.
Seit den ersten Zupfinstrumenten vor 6000 Jahren bis zum Höhepunkt des Geigenbaues im 18. Jahrhundert hatten tiefgreifende Entwicklungen stattgefunden:
Die Zupfinstrumente mutierten nach und nach zu ausdrucksstärkeren und variableren Streichinstrumenten. Nunmehr konnten Töne nicht mehr nur durch das Zupfen oder Schlagen der Saiten hervorgerufen werden. Das Streichen mit Bogenhaaren erzeugte wesentlich kompliziertere Schwingungen. Dazu waren bauliche Veränderungen notwendig. Um zu verhindern, dass die schwingenden Saiten auf den Resonanzkorpus oder das Griffbrett aufschlugen, war ein ausreichend hoher Steg erforderlich, die Befestigung der Saiten musste grundsätzlich verändert werden, und es wurde Platz geschaffen für den Bogenstrich.
Die Instrumentenbauer experimentierten mit verschiedenen Modellen, die man zum Teil heute nur noch in Museen findet. So gab es die für eine deutsche Zunge kaum aussprechbare Crwth in Irland und Wales, die schon bekanntere aber inzwischen auch fast ausgestorbene Fidel, den Rebec (der trotz des halbbirnenförmigen Korpus natürlich nichts mit jenem Fontane-Gedicht des Herrn von Ribbeck zu tun hat :-), die Giga als ähnlich strukturierte, französische Variante, und das fast zwei Meter lange, einsaitige Trumscheit.
Nach und nach verfeinerten und vereinheitlichten sich die Streichinstrumente. Der Steg bekam eine Wölbung und der Saitenabstand wurde größer, um das Streichen einzelner Saiten zu ermöglichen. Aus dem gleichen Grund wurde die „Taille“ verengt, womit dem Bogen ein größerer Aktionsradius eröffnet wurde. Die Saiten wurden dicker, der Bogen verstärkt. Es begannen Kräfte auf den Resonanzkorpus zu wirken, die eine Verstärkung im Inneren notwendig machten. Das war die Geburtsstunde eines kleinen Holzstäbchens unter dem Steg, der sogenannten Stimme, deren korrekter Sitz nunmehr einen ganz entscheidenden Einfluss haben sollte. Zur Stabilisierung der tiefen Saiten wurden Bassbalken eingepasst, selbst die Schalllöcher mussten neu geformt werden. Die Seitenwände (Zargen) wurden niedriger und mit dem Hinzufügen einer vierten Saite war vor 500 Jahren die Entwicklung zum heutigen Streichinstrument weitgehend abgeschlossen. Neuere Veränderungen betreffen vor allem das Zubehör, wie die Saiten, Halter, Stützen, und in allerneuster Zeit neue Materialien und elektronische Erweiterungen und Verbindungen.
Angesichts dieser Experimentierphase mit den neuen Streichinstrumenten verwundert es nicht, dass es anfangs noch keine speziellen Geigenbauer gab. Die frühen Meister fertigten Lauten, Gamben und experimentierten mit Violen und Violinen. Als erster Geigenbauer gilt mitunter Pietro Dardelli, ein Franziskanermönch aus Mantua. Auch Giambattista Rolini aus Pesaro wird genannt. Mit Sicherheit einer den Ersten war Zanetti da Montichiaro, von dem ein Geigenzettel von 1532 erhalten ist.
Mit dem Aufstieg der Amati-Familie in Cremona erfolgte eine gewisse Standardisierung der Streichinstrumente. Einen wichtigen Durchbruch brachte damals ein Auftrag vom französischen König zum Bau von Streichinstrumenten, erstmals auch der neuen Violine.
Mit da Salò begann um 1600 auch eine Tradition des Violabaus. Da Salòs Bratschen, die allerdings mittlerweile im Hinblick auf eine angenehmere Spielbarkeit meist verkleinert wurden, sind heute besonders begehrt.
Es dauerte nun nur noch 200 Jahre, bis auch die Brückners, um die es vorrangig in diesem Buch gehen soll, als Geigen- und Bratschenbauer ins Geschehen eingriffen
Mit Stradivari und seinen Zeitgenossen im weiteren Sinn erreichte der Streichinstrumentenbau in Italien eine gewisse Zentralisierung, Perfektionierung und seinen vorläufigen Höhepunkt.
Ohne im Detail auf die Streitfrage eingehen zu wollen, ob die Instrumente von Stradivari und seiner legendären Zeitgenossen wirklich so viel besser sind als die heutigen, zumindest haben anonymisierte Hörtests und Vergleiche dieses nicht bestätigen können (im Gegenteil, moderne Instrumente wurden zum Teil sogar besser beurteilt), kann festgestellt werden, dass sich die Violinen Stradivaris durch objektivierbare Merkmale auszeichnen: Sie tragen besonders gut im Bereich zwischen 2.000 und 4.000 Hertz, dem Klangbereich, in dem das menschliche Gehör am empfindlichsten ist. Dies führt dazu, dass selbst ein sehr leise gespielter Ton in einer großen Konzerthalle weithin hörbar ist, wenn er auf einer Stradivari gespielt wird. Andererseits haben die Geigen Stradivaris deutliche Defizite, wenn es darauf ankommt, dunklere, sonore Töne zu erzeugen.
Schwingungsanalysen zeigen, dass spezielle, asymmetrische Abweichungen der Materialstärke eine wichtige Rolle für den Klangcharakter spielen. Schließlich konnte Stradivari auf eine besondere Holzqualität zurückgreifen. Offenbar waren besondere klimatischen Verhältnisse in Europa während der sogenannten „Kleinen Eiszeit“ (16.-18.Jh.) dafür verantwortlich, dass zum Instrumentenbau Holzqualitäten verwendet werden konnten, die es heute nicht mehr gibt. Die geringeren Durchschnittstemperaturen führten zu verändertem Baumwachstum mit geringerem Jahrringabstand und reduziertem Spätholzanteil. Je weniger Spätholz pro Jahrring gebildet wird, desto geringer ist die Rohdichte, was sich auf die Klangqualität des Instrumentes günstig auswirken soll. Abgesehen von den Holz- und eventuell auch Lackeigenschaften verfügten Stradivari und sein Lehrmeister Amati oder auch Kollegen wie Guarneri etc. selbstverständlich über eine akribische Handwerkskunst, Voraussetzung für jedes Meisterinstrument.
Читать дальше