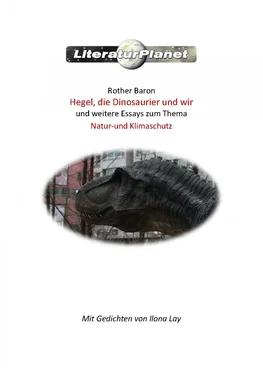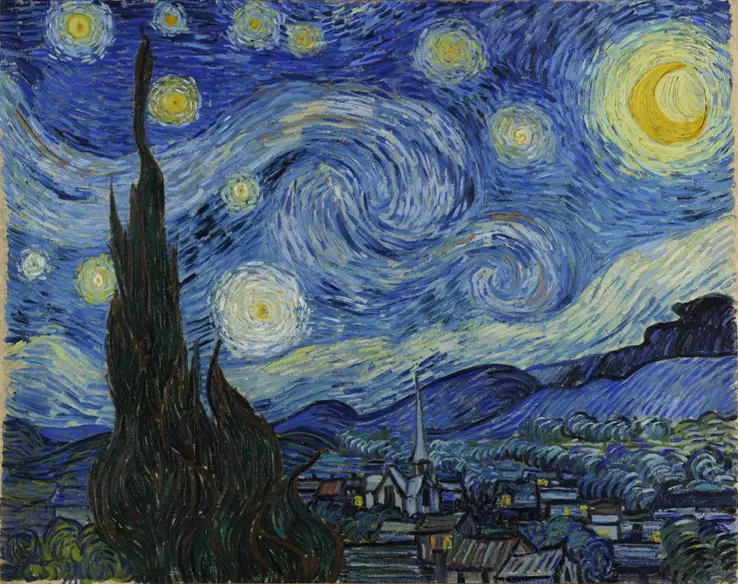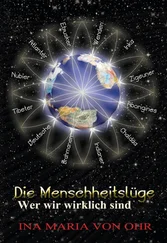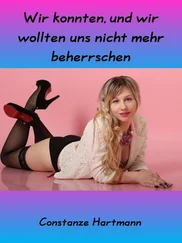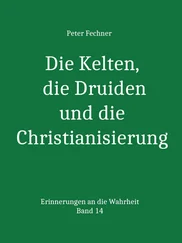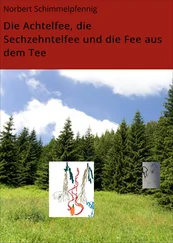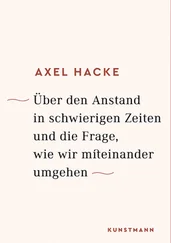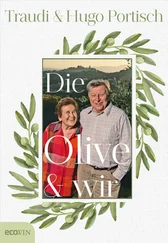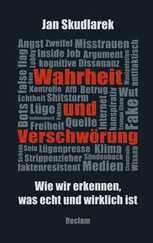[7] Dunkel, Monika / von Zepelin, Jenny: "Windräder können wir nicht recyceln." [Interview mit Herwart Wilms, Manager des Recyclingunternehmens Remondis]. In: Capital, 19. Januar 2017.
Kiosz, Margret: Friedhof der Rotorblätter. Warum die Entsorgung der Windradflügel so problematisch ist. In. Schleswig-Holsteinische Zeitung, 9. September 2018.
Körner, Jan: Rückbau bei Windrädern oft mangelhaft; NDR (Panorama 3), 23. Januar 2018.
[8] Lenzen-Schulte, Martina / Schenk, Maren: Infraschall: Der Schall, den man nicht hört. In: Deutsches Ärzteblatt 116 (2019), H. 6.
Mathys, Werner [ehemaliger Leiter des Bereichs Umwelthygiene/Umweltmedizin am Universitätsklinikum Münster]: Bewertung der gesundheitlichen Wirkungen von Infraschall auf den Menschen. Eine Zusammenstellung nationaler und internationaler Erfahrungen über die Wirkungen von Schall/Infraschall. Greven, Nov. 2019; als PDF im Netz abrufbar (auch über die Website von Vernunftkraft NRW).
[9] Göbel, Jörg / Purtul, Güven: Wenn für Windräder Wald gerodet wird; ARD (Frontal 21), 24. Juli 2018.
Richarz, Klaus: Windenergie im Lebensraum Wald. Gefahr für die Artenvielfalt. Situation und Handlungsbedarf. Hamburg 2016: Deutsche Wildtier Stiftung [als PDF-Dokument online abrufbar].
[10] Dubbers, Dirk / Stachel, Johanna / Uwer, Ulrich: Energiewende: Fakten, Missverständnisse, Lösungen – ein Kommentar aus der Physik, S. 1 (mit einem Schaubild des Bundeswirtschaftsministeriums). Physikalisches Institut der Universität Heidelberg, 4. September 2019; als PDF-Dokument im Netz verfügbar.
[11] Ebd., S. 3.
[12] Ebd., S. 2.
[13] Deutscher Forstwirtschaftsrat: Produkte rund um den Wald: Brennholz. Berlin, Forstwirtschaft-in-deutschland.de, ohne Datum (aufgerufen am 21. Januar 2020).
I. Klimaschutz und Naturschutz
Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels,
die den Natur- und Artenschutz außer Acht lassen, zerstören das, was sie zu schützen vorgeben.
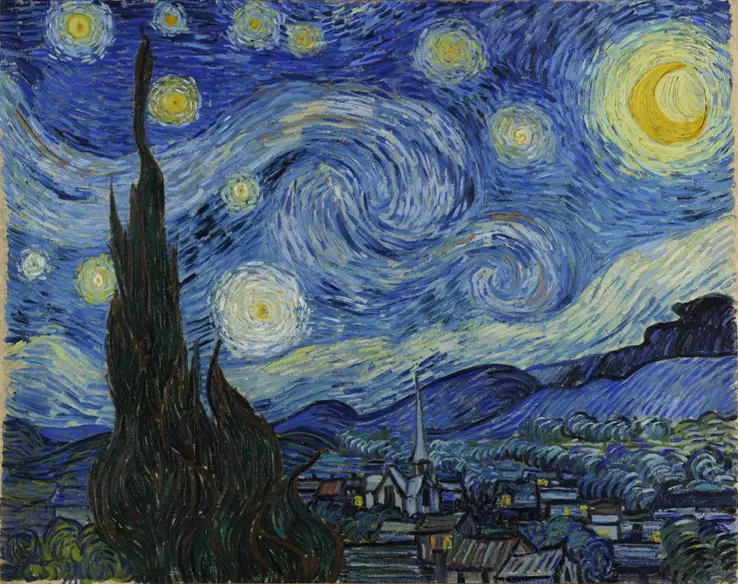
Vincent van Gogh: Sternklare Nacht (1889); Museum of Modern Art, New York
Der Wald ein Stoff ein Kapital
die Stämme mundgerecht zerstückt
der Mond von Scheinwerfern zerpflückt
auf Wüstenhängen bleich und kahl
das Land von Reifenfurchen wund
Schoß in den sich Pfeiler zwingen
Feld an dem Traktoren wringen
Moos das unter Teer verstummt
des Himmels Tränen säen Gift
Kelch der unsichtbar zerfällt
ein Schiff in unerkannter Drift
die Nacht ein Apfel ohne Kern
Traumfähre die an Stein zerschellt
und hinter Glas der Abendstern
Hegel, die Dinosaurier und wir
Warum Klimaschutz ohne Naturschutz zum Scheitern verurteilt ist
"Klimaschutz" – ein unlogischer Begriff
Naturschutz ist out. Heute schützen wir – klar – "das Klima". Dabei ist so viel von "Klimaschutz" die Rede, dass uns der unlogische oder zumindest ungenaue Charakter des Wortes gar nicht mehr auffällt.
Wenn wir von "Naturschutz" sprechen, haben wir etwas Konkretes vor Augen: bestimmte Tier- oder Pflanzenarten, Ökosysteme oder Biotope, in denen durch das Interagieren spezifischer Organismen einzigartige Lebenswelten entstehen. "Das Klima" lässt sich zwar auch auf eine Vielzahl einzelner, konkret fassbarer Elemente zurückführen. Dabei handelt es sich jedoch zum einen nicht um Lebewesen, sondern um Wirkmechanismen, durch die etwa Windverhältnisse, Temperaturschwankungen oder Meeresströmungen einander gegenseitig beeinflussen.
Zum anderen geht es uns, genau genommen, auch keineswegs darum, "das Klima" als solches zu schützen. Wäre dem so, so bräuchten wir keinerlei Anstrengungen zur Eindämmung des Klimawandels zu unternehmen. Denn auch wenn wir unsere "Klimaziele" verfehlen sollten, wird es weiterhin ein Klima geben. Nur wird dieses den Menschen dann eben nicht so zuträglich sein wie das bisherige Klima.
Der anthropozentrische Kern des Klimaschutzkonzepts
Wenn wir von "Klimaschutz" reden, meinen wir also in Wahrheit die Bewahrung eines Klimas, dass dem Fortbestehen der Menschheit förderlich ist. Das ist natürlich legitim. Schließlich ist der Kampf um das Überleben der eigenen Art eine der Hauptantriebskräfte der Evolution. Dennoch impliziert das Konzept des "Klimaschutzes" damit eine anthropozentrischere Herangehensweise an den Umweltschutz als der Naturschutz.
Zwar bebildern wir die Angst vor dem Weltuntergang, die der Klimawandel befeuert, auch immer wieder mit dadurch gefährdeten Tierarten und einzigartigen Ökosystemen, wie dem Eisbär oder Korallenriffen (mit dem australischen Great Barrier Reef als prominentestem Beispiel). Dennoch steht im Vordergrund der Bemühungen um Klimaschutz stets die Bewahrung der für den Menschen günstigen Umweltbedingungen.
Deshalb ist es bei diesem Paradigma zwar möglich, dass Umweltschutzmaßnahmen auch dem Erhalt einzelner Tier- und Pflanzenarten dienen. Es ist aber auch der umgekehrte Fall denkbar, dass der Klimaschutz den Naturschutz aussticht. So ist das deutsche Naturschutzgesetz explizit für die Errichtung der vermeintlich dem Klimaschutz dienenden Windkraftanlagen aufgeweicht worden.
Beim Naturschutzparadigma ist die Denkrichtung dagegen genau umgekehrt. Die Schutzmaßnahmen setzen hier nicht am Menschen und den ihm förderlichen Umweltbedingungen an, sondern an der Natur, als dem übergeordneten Ganzen, zu dem auch der Mensch gehört. Der Grundgedanke ist: Was der Natur dient, dient langfristig auch dem Menschen, weil er ein Teil der Natur ist.
Klimaschutz kontra Naturschutz?
Die Fokussierung auf den Klimaschutz ist damit einerseits, angesichts der konkreten Bedrohung der menschlichen Lebensumwelt durch den Klimawandel, verständlich. Andererseits birgt dieser Paradigmenwechsel die Gefahr in sich, dass wir durch einseitig auf den Menschen und seine Lebensbedürfnisse bezogene Maßnahmen im Endeffekt sogar zu einer Beschleunigung des Klimawandels beitragen.
Dies gilt zum einen unmittelbar in all jenen Fällen, in denen – wie etwa beim Bau von Windkraftanlagen oder der Förderung von Rohstoffen, die für die Batterien zum Betrieb von E-Autos benötigt werden – Natur zerstört wird, um das Klima zu schützen. Die dadurch entstehenden Umweltschäden (Rückgang der Artenvielfalt, Austrocknung von Böden, Beschädigung der als Kohlendioxidspeicher benötigten Wälder) können sich allesamt direkt in für uns ungünstiger Weise auf die Entwicklung des Klimas auswirken.
Zum anderen führt die Ersetzung des Naturschutz- durch den Klimaschutzgedanken aber auch dazu, dass wir das Gespür für das komplexe Interaktionsgefüge verlieren, das naturhaftes Leben auszeichnet. Wenn aber das Denken in Kategorien von Ökosystemen oder symbiotischen Beziehungen, wie sie uns der Naturschutz gelehrt hat, in den Hintergrund tritt, verlernen wir auch die nötige Achtsamkeit im Umgang mit der Natur, die durch die Umweltschutzbewegungen des vergangenen Jahrhunderts stärker zur Geltung gebracht worden ist.
Im Schatten der "klimafreundlichen" Transformation der Wirtschaft können dann auch die ausbeuterisch-rücksichtslosen Formen des Umgangs mit der Natur, die gerade erst mühsam eingedämmt worden sind, wieder ungenierter praktiziert werden. Falls nötig, braucht man ja nur zu behaupten, dass dies im Namen des Klimaschutzes unerlässlich sei. Wenn vom "Green New Deal", einer "Versöhnung von Ökonomie und Ökologie" oder dem wachstumsfördernden Potenzial der neuen, "klimaschonenden" Technologien die Rede ist, bereitet das exakt einer solchen Entwicklung den Boden.
Die Menschen als Profiteure einer Klimakatastrophe
Читать дальше