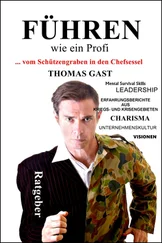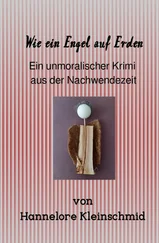Mendoza wollte seine Mitmenschen überzeugen, dass ihm gute Seelsorge am Herzen lag. Er wollte beweisen, dass die Kirche für ihre Belange eintrat, sie nicht alleine ließ. Aber dazu brauchte er enthusiastische, junge Priester, die bereit waren, gemeinsam mit ihren verirrten Schafen in den Dörfern ein einfaches Leben zu führen. Dazu brauchte es auch neue Gotteshäuser, allerdings keine pompösen Kirchen. Aber selbst Bescheidenes kostete Geld, zu viel, das er nicht hatte, auch nicht von der Mutterkirche bekam, und schon gar nicht vom herzlosen oligarchen Bürgertum. Die Bauern hatten ja sowieso nichts. Trotzdem sah er die einzige Lösung in engagierten Priestern, die mitten unter den Menschen leben wollten. Der Oberhirte hatte den unverrückbaren Glauben, dass für eine so gute und wichtige Sache Gottes Hilfe schon kommen würde. Das stärkte ihn.
Die Weihe seiner zwei Zöglinge hatte Mendoza nicht, wie üblich, in seiner mächtigen Kathedrale, sondern in der kleinen Kirche des Priesterseminars der Augustiner-Mönche in San José feiern wollen. Er bemühte sich ehrlich um die Nähe des Volkes und erhoffte sich mit der heutigen Zeremonie eifrigen Zuspruch durch die örtliche Gemeinde. Aber auf den Bänken verteilten sich nur ein paar Frauen und Kinder, die aus Neugierde gekommen waren, da sie eine Priesterweihe bisher noch nicht gesehen hatten. 'Sensatio est omnia'!
Der Regens und Leiter des Seminars stellte seine beiden Zöglinge allen Mitgliedern des Presbyteriums vor. So verlangte es das Weihsakrament.
Der Bischof, in seinen prächtigen Gewändern, rief zuerst laut »Cornelius« und dann »Mathieu«. Prompt schallte die Antwort der beiden jungen Männer mit kräftiger Stimme durch die Kirche: »Ad sum – hier bin ich.« Sie waren für die heilige Weihe bereit und schworen damit der wahren Kirche Gehorsam und ewige Treue.
Während Cornelius die Heiligenlitanai hörte, murmelt er gleichzeitig ein über das andere Mal inbrünstig sein eigenes ‚Pater noster’, um seine wieder aufsteigende Aufregung zu bekämpfen. Das Gebet half, das Blut in den Adern seiner Schläfen hörte auf zu pochen.
Endlich fühlte er die Hand seines Bischofs auf der kahlen Stelle seines Kopfes, wo man ihm die Haare zur Tonsur geschoren hatte. Das heilige Weihsakrament war vollzogen, was alle Mitglieder des Presbyteriums durch Handauflegen mit ihrem Segen bezeugten. Ein Schauer nach dem anderen durchfloss seinen Körper, was nicht alleine von der Kühle in der Kirche herrührte. Cornelius und Mathieu durften endlich aufstehen, ihre Hände wurden gesalbt, der Weihritus kam zu seinem festlichen Terminus. Damit lag ihr ganzes Leben in der Gemeinschaft der Kirche, einem Bund von Eingeweihten.
Zum ersten Mal wurde Cornelius das Messgewand übergezogen und die Stola um die Schultern gelegt. Behutsamen Schrittes, ja beinahe etwas unsicher, bewegte er sich zum Altar. Beide jungen Priester zelebrieren mit ihrem Bischof die erste Messe, am erhabensten die Heilige Eucharistie, feierlichste Handlung eines jeden Priesters. Cornelius war angekommen!
»Alle Türen stehen mir nun offen,« murmelte Cornelius auf Deutsch, mehr zu sich selbst, als für seine Umstehenden zu hören. Damit breitete sich in ihm weniger ein Gefühl der Erleichterung aus, als die geheime Erwartung eines geregelten Lebens. Für Cornelius stand unweigerlich fest, dass sich nun sein Leben ändern würde. In seiner exaltierten Stimmung wunderte er sich, was in aller Welt in den letzten sechs Monaten passiert war, das ihn so verändert hatte? Viel länger war es ja nicht her, dass er in diese fremde Stadt gekommen, er in diese, für ihn so ganz neue, so ganz andere Welt, aufgebrochen war.
In Gedanken fragte er sich: „So richtig Zeit zum Einleben gaben sie mir nicht im Seminar. Von den Menschen und diesem Land weiß ich so gut wie gar nichts. Wie kann ich mich da in einer Gemeinde, wo ich als Seelsorger wirken soll, zurechtfinden?“
Dabei war die Priesterausbildung ganz und gar nicht leicht. In den vergangenen Monaten reihte sich ein Examen an das andere, zuerst für die ‚Prima Tonsura et Minoribus Ordinibus’, dann für die ‚Subdiaconatu’ und letztendlich für die ‚Diaconatu et Presbyteratu’. Das konnte nur mit Disziplin erreicht werden. Zwischen dem Unterricht, den Stundengebeten, dem Studium der Bibel und der Heiligen Messe war kaum Zeit für die Mahlzeiten. So manches Mal wünschte er sich, dass er seinen Magen besser unter Kontrolle hätte und dieser weniger rebellisch sein würde. Sein Körper war noch nie 'sehr im Fleisch', aber die zurückliegenden Wochen hatten ihn noch hagerer gemacht. Die meisten Mahlzeiten begannen mit einer wässerigen Gemüsesuppe. Das Huhn war allerhöchstens darüber geflogen, sicherlich war keines darin gekocht worden. Danach lag auf dem Teller meistens Reis und Fisch. Schon das Frühstück fing damit an. Um das Beste daraus zu machen, wiederholte er in Gedanken immer wieder spöttisch die Litanei: „Fisch und Reis, Reis und Fisch. Mein ganzes Gehirn besteht nur noch aus Reis und Fisch“. Eigentlich hatte er erwartet, dass viele tropische Früchte Teil der Mahlzeiten sein würden, über die er so viel gelesen hatte - Ananas, Mango, Banane, Avocado, Kokosnuss. Nichts von alledem, nicht einmal einen Zuckerrohrsaft. Allerdings musste er eingestehen, es gab jeden Tag einen besonderen Genuss und darauf freute er sich immer wieder aufs Neue - eine Tasse Kaffee aus ganz schwarz gerösteten Bohnen, übergossen mit viel Milch. Eine Köstlichkeit, von der er schon auf der SS Athos von New York nach Aspenwall nicht genug bekommen konnte. Überhaupt, er dachte gerne an die lukullischen Mahlzeiten zurück, eingeladen von dem Franzosen, den er seit seiner Ankunft, durch seine Abgeschlossenheit, nicht wieder getroffen hatte.
Schon im Gymnasium, mehr noch während seines Theologiestudiums, lernte er und sprach fließend Latein; dazu kamen leidliche Kenntnisse in Altgriechisch und Hebräisch. Nicht umsonst hatte er Philologie studiert. Die neuen Sprachen liebte er freilich besonders, vor allem das Französische. In diesem Teil der Erde, den er zu seiner neuen Heimat gewählt hatte, sprach man aber Spanisch. Das war ein ganzes Stück von seinen bisherigen Sprachkenntnissen entfernt. Er hatte aber wesentlich weniger Probleme als Mathieu, der das wundervoll wohlklingende, spanische Zungen-R kaum rollen konnte, das Lispeln hinter den Zähnen und den Rachenlaut in der Kehle nicht richtig hervorbrachte. Sein Mitbruder aus Angers hatte mit der spanischen Aussprache einige Schwierigkeiten. Mathieus Muttersprache ließ diese zu weich klingen. Man lächelte hinter vorgehaltener Hand darüber, was ihn ärgerte. In seiner zukünftigen Gemeinde wollte er als Priester nicht zum Gespött werden.
»Du musst nur genau hinhören und den Leuten auf den Mund schauen. Nimm es leicht und hab nicht so viel Scheu!« versuchte Cornelius Mathieu immer wieder aufzumuntern.
Cornelius wusste freilich, wie leicht es ihm fiel neue Sprachen lernen. Mit Vokabeln brauchte er sich wenig herumzuärgern. „Die Grammatik verstehen und zuhören“, war seine bewährte Devise. Mehr war für ihn eigentlich nicht nötig. Mit Worten spielen und die Gedanken zu Papier bringen, das war alles. Er benutzte die Sprache zum Schreiben, nicht unbedingt zur Unterhaltung. Der direkte Kontakt mit Menschen war zweitrangig. Diese Bindung setzte er sparsam ein und nur, wenn absolut notwendig. Dabei war er ganz und gar nicht schüchtern, eher sich selbst genug. Mit Energie, und weil er wusste, dass seine selbst gewählte Isolation nicht richtig war, versuchte er diesen Hang zum Alleinsein immer wieder zu durchbrechen. Andere zu unterhalten war allerdings für Cornelius eine Tortur. Aus Langeweile wurde dann schnell Missvergnügen, und dagegen setzte er verletzenden Sarkasmus, was seine Mitmenschen unangenehm zu spüren bekamen. Er genoss die Verwirrung und Frustration, die er auslöste. Da konnte er sich so richtig hineinsteigern. Zwar wusste er wie unfair das war, dennoch benutzte er schamlos seine intellektuelle Überlegenheit, obwohl sein Verstand ihm sagte, dass ihn dieses Verhalten nicht weiter bringen würde. Es war ihm sehr wohl bewusst, dass er sich nur durch Menschenkenntnis in der Welt behaupten konnte. Also zwang er sich, auf seine Mitmenschen einzugehen, irgendwie mit ihnen in Berührung zu kommen. Häufig blieb es aber darauf beschränkt, im Gymnasium seinen Mitschülern Nachhilfestunden zu geben oder sich später an der Universität als Tutor anzubieten. Diese Kontakte gaben vor allem eine willkommene Gelegenheit, sein Taschengeld aufzubessern.
Читать дальше