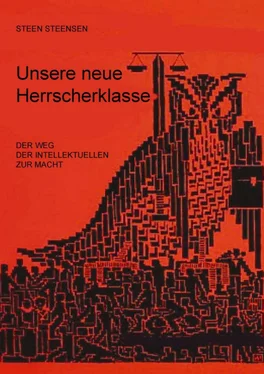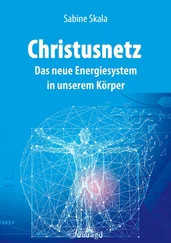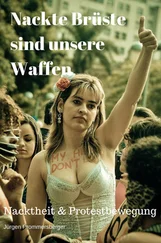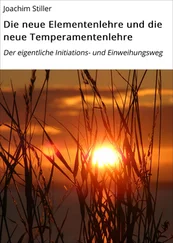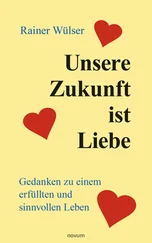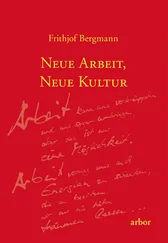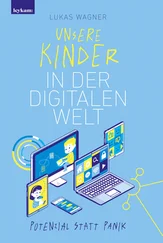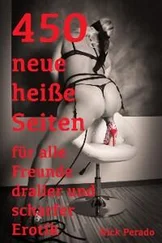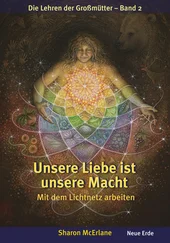Aber auch das Bürgertum war in Schichten geteilt. Die oberste Schicht bestand aus reichen Bankiers, Inhabern großer Handelshäuser, Großhändlern und wenigen, aber mächtigen Industriellen. Dieser Personenkreis war oftmals wohlhabender als der Adel, der Zugang zur etablierten Oberklasse blieb ihr allerdings versagt. Es sei daran erinnert, dass Frankreich innerhalb der europäischen Staaten eine beachtenswert starke ökonomische Position einnahm. Frankreich war in der Lage, durch den Besitz der Insel San Domingo die Hälfte des Weltzuckerverbrauchs zu decken. Erzeugnisse der französischen Möbel- und Textilfabrikation wurden in zahlreiche Länder exportiert. Die Seidenherstellung konnte sich als führend in der Welt bezeichnen. Der Bergbau und die Erzgewinnung befanden sich in einer Wachstumsperiode, die Ausgabe von Aktien und die Bankgeschäfte im Allgemeinen florierten. Es herrschten also günstige ökonomische Bedingungen für energische und unternehmungsfreudige Leute.
Die ideologische Begründung der gesellschaftlichen Position der besitzenden Klasse basierte auf ihrer adligen Herkunft. Das Bürgertum hingegen machte die persönliche Initiative zum Maßstab für die Aneignung beziehungsweise Verteilung von gesellschaftlichen Werten. Die aufsteigende Klasse machte sich die zu der Zeit modernsten philosophischen Ideen zu Eigen, insbesondere Rousseaus Gedanken von Freiheit und Gleichheit benutzten sie als Geschütze gegen die Privilegiengesellschaft. Auf diese Weise brachten die zukünftigen Herren das moralische Recht auf ihre Seite. Diese Transaktion ist ausschlaggebend für den Ausgang einer revolutionären Komödie.
Die finanzielle Krise des Reiches löste schließlich die Revolution aus. Die Plünderung der Staatskasse durch den Hofadel und die Unterstützung des nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges brachten den Staatsbankrott in gefährliche Nähe. Neue Steuern mussten erhoben werden, doch eine verschärfte Ausbeutung der Unterklasse war nicht mehr möglich. Deshalb musste die Steuerfreiheit der besitzenden Klasse unbedingt aufgehoben werden. Diese Notwendigkeit wurde von den adligen Finanzexperten anerkannt, nicht aber von deren Klassenbrüdern, die entsprechende Bestrebungen bekämpften. So brachten sie den ersten adligen Steuerreformer zu Fall. Dessen Nachfolger hatten jedoch keinen anderen Ausweg, als diejenige Klasse zum Steuerobjekt zu machen, die den größten Anteil an den gesellschaftlichen Werten besaß. Der oppositionelle Teil des Adelsstandes, insbesondere der niedere Adel, forderten deshalb die Einberufung der Generalstände, da laut Verfassung nur die Stände zum Erheben neuer Steuern berechtigt waren.
Die Stände bestanden aus dem Adel, dem Klerus und dem Dritten Stand, der die Interessen des Volkes repräsentieren sollte. Tatsächlich waren aber kaum die Vertreter des Volkes im Dritten Stand zu finden, sondern hauptsächlich Juristen, Ärzte, Beamte und andere wohlhabende Bürger. Auch einzelne Adlige und Geistliche hatten sich als eine Art Volkstribun dem Dritten Stand angeschlossen. Keine Arbeiter und nur wenige Bauern befanden sich in der sogenannten Volksvertretung. Der Dritte Stand wurde in Wirklichkeit von einem Mittelstand, der kommenden Mittelklasse, als Tarnung benutzt. Dies bewiesen die nachfolgenden Ereignisse, in denen der Dritte Stand in erster Linie die Klasse vertrat, welcher seine Repräsentanten angehörten.
Der aufsteigenden Klasse bot sich eine weitere Gelegenheit zur Durchsetzung ihrer Interessen, die sie geschickt ausnutzte. Bevor die Generalstände einberufen wurden, hatte der König das Volk aufgefordert, die herrschenden Zustände zu kritisieren und seine generellen Wünsche vorzutragen. Da die meisten Bauern weder schreiben noch lesen konnten, mussten sie die Formulierung ihrer Forderungen anderen überlassen. In dieser Situation erkannte das revoltierende Bürgertum eine einzigartige Chance. Der Mittelklasse gelang es, ihre eigenen Forderungen als diejenigen der Unterklasse zu maskieren.
Die französische Mittelklasse war sich von Anfang an darüber im Klaren, dass ein Bündnis mit der Unterklasse eine Notwendigkeit war. Obwohl die Oberklasse den Staatsapparat nicht mehr fest in der Hand hatte, war ihre Widerstandskraft doch nicht vollkommen gebrochen. Die Erwartungen, welche die Mittelklasse mit einer Allianz verbanden, waren auch nicht unbegründet.
Die Unterklasse fristete ein Dasein unter extrem schlechten Bedingungen. Zahlenmäßig dominierten die kleinen Handwerker in den Städten, die aufgrund ihrer mangelnden Schulbildung ebenso wie der recht kleine Stand von Fabrikarbeitern wenig Möglichkeiten hatten, sich im politischen Leben Geltung zu verschaffen. Die Bauern bildeten das ökonomische Zugtier der Gesellschaft. Einige waren leibeigen, die meisten Pachtbauern, die ihren Herren Pachtzinsen und dem Staat Steuern zahlten sowie zu umfassenden Frondiensten gezwungen wurden. Zur Unterklasse müssen auch die zahlreichen Tagelöhner und umherziehenden Bettler gerechnet werden. Diese Unterklasse hatte wenig zu verlieren und ausreichend Gründe zu revoltieren. Ihr niedriges kulturelles Niveau verhinderte jedoch, dass sie der Hinterlist der Mittelklasse Paroli bieten konnte. Die Erfolgsaussichten der von der Mittelklasse betriebenen Bündnispolitik wurden zudem durch den extrem strengen Winter 1788-89 und die vorausgehende schlechte Ernte begünstigt. Darüber hinaus verursachte das Handelsabkommen von 1786 mit England, das zur Senkung des Einfuhrzolls auf englische Industriewaren geführt hatte, die Stilllegung einer Anzahl von Fabriken und eine große Zahl von Arbeitslosen. Alle diese Umstände verstärkten die soziale Unruhe und machten die Unterklasse empfänglich für falsche Parolen und verräterische Versprechungen.
Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass die Oberklasse, der Adel, für alle einen Feind darstellte, den es zu bekämpfen galt, denn nur durch die vollständige Vernichtung dieser Klasse konnten bessere soziale Verhältnisse erreicht werden. Mit dauernden Angriffen auf die privilegierte Klasse, die als Feind des Volkes dargestellt wurde, versuchte die Mittelklasse, den Weg für das Bündnis mit der Unterklasse zu bahnen, was ihr letztendlich gelang.
Wie jede gute Propaganda, so waren diese Erklärungen zum Teil richtig. Der Untergang der privilegierten Klasse war ganz richtig eine notwendige Voraussetzung für die Erzielung besserer Verhältnisse. Die Mittelklasse vergaß aber darauf hinzuweisen, dass diese Voraussetzung allein nicht ausreichend war. Die Mittel- und die Unterklasse hatten nämlich nicht das gleiche Ziel. Die gemeinsamen Interessen bestanden nur solange, bis der Adel gestürzt war. Alle Mittelklassen streben nach der Führung, während sich die Unterklasse für die Gleichheit einsetzt. Diese Ziele sind unvereinbar.
Die Führer der Mittelklasse konnten trotzdem die Unterklasse mit revolutionären Parolen und Schlagworten blenden. Den Revolutionsmachern gelang es, der Unterklasse glaubhaft zu machen, dass es deren Sache war, für die sie kämpften. Sie benutzten die Sehnsüchte der Unterdrückten nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geschickt im Kampf gegen den Klassenfeind. Sie entwickelten eine bis dahin ungekannte Beredsamkeit. Die Redekunst der Sophisten und die rhetorischen Meisterwerke der römerischen Volkstribunen wirkten neben den oratorischen Ergüssen eines Mirabeaus, Morats, Dantons oder Robespierres wie trockene wissenschaftliche Vorträge. Man kann leicht den Eindruck bekommen, dass den Menschen die Sprache gegeben wurde, um ihre wahren Absichten verbergen zu können.
Es wäre falsch zu denken, dass die revolutionäre Klasse nicht nach Freiheit und Gleichheit strebte. Für sie bedeuteten diese Begriffe jedoch politische Rechte, während die Bauern und Arbeiter sie mit sozialen Reformen verbanden. Freiheit und Gleichheit sollten dazu beitragen, sie von den feudalen Bürden zu befreien. Es war natürlich die siegreiche Klasse, die über das Definitionsrechte verfügte.
Читать дальше