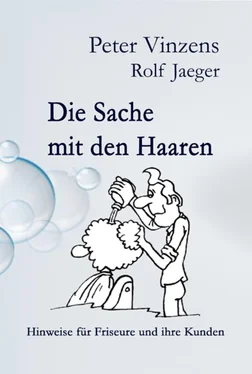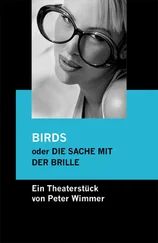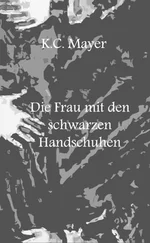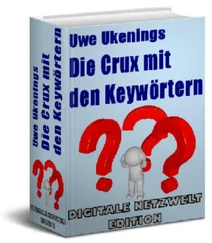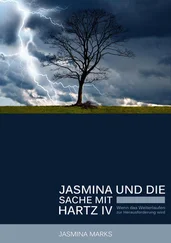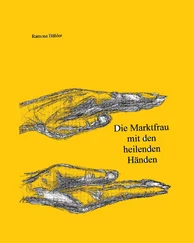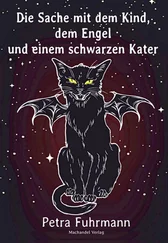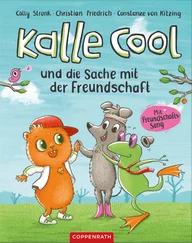In seinem Team Rolf Jaeger. Damals noch ein junger Kerl. Geboren 1954. Aufgewachsen in kinderreicher Familie. Zusammen waren sie acht. Noch heute, als Friseurmeister, erinnert er sich wie das damals war. Im kleinen Haus in der Frankfurter Vorstadt Bonames. Elvis Presley hatte damals die Bühnen der Welt erobert und hielt als „The King“ Publikumsrekorde. Ein Vorbild der Jugend. Ein Trendsetter. Und das Schreckgespenst der Erwachsenen. Rock‘n Roll war zur Weltanschauung geworden. „Halbstarke“ erschreckten das Establishment. Ihre Art sich zu geben, sich zu bewegen, sich zu kleiden und ihre Frisuren zu gestalten widersprach der biederen Art der Nachkriegseltern. Presley war ihre zentrale Figur, musikalisch, weltanschaulich, sozial. Scheinbar unabhängig.
In Berlin nahmen Rock‘n Roll-Fans die Waldbühne auseinander und Regierungsvertreter dachten darüber nach, wie schädlich diese Musik wohl für die Jugend sei. Fernsehen und Wochenschau berichteten. Der Kommerz aber hatte die Zielgruppe längst erkannt. Musik und Mode gehörten wieder einmal zusammen. Und zur Mode natürlich auch die Haartracht.
Rolfs ältere Brüder Eckart und Hans entdeckten Elvis als Vorbild. Und die Friseurindustrie lieferte das Stylingmittel dazu: Das Zauberwort hieß damals „Brisk“. Eine Frisiercreme die Haarwellen á la Elvis in Form hielten. Der „King“ hatte sie, James Dean hatte sie, eigentlich hatten sie sie alle. Diese Haarwelle.
Das Vertrackte war nur, dass diese schwungvolle Welle nicht von alleine hielt. „Brisk“, eine Art Pomade und gerade neu auf dem Markt, konnte da weiterhelfen. Wann immer eine Party angesagt war, Rolfs Brüder setzten den Erfolg bei den jungen Damen auf eben jenes Zaubermittel. Leider war es nur beim Friseur zu bekommen, es war teuer und außerdem natürlich auch schnell weg, denn es wurde eine ganze Menge gebraucht um die Welle haltbar zu machen. Manchmal kamen dann die Tuben durcheinander und die Brüder stritten darum, wer nun wessen „Brisk“ aufgebraucht hatte. Und draußen warteten die Mädchen. Im Badezimmer spielten sich Dramen ab, so wird gesagt.
Solche lautstarken Auseinandersetzungen prägten natürlich den kleinen Rolf. Trotzdem herrschte erst einmal Ratlosigkeit, als 1968 die Berufswahl anstand. In der Stadt, nur wenige Kilometer entfernt, prügelten sich Studenten, Hausbesetzer und Freidenker mit der Staatsmacht. Die Auseinandersetzung war heftig, schließlich ging es allen Beteiligten um die Veränderung der Gesellschaft, oder auch nicht. Einer, der später deutscher Außenminister werden sollte, wurde dabei fotografiert und hatte – eben später – einige Probleme Erklärungen für seine Renitenz abzugeben. Andere, die auf der Seite der Staatsmacht Knüppel schwingen ließen, brauchten dagegen niemals Erklärungen abgeben. Es kam also schon damals darauf an, auf welcher Seite des Knüppels man stand.
Rolf wurde Friseur. Nicht aus Überzeugung, eigentlich mehr durch Zufall. Sein Trainer im Sportverein von Bonames für Leichtathletik war Friseurmeister, brauchte einen Lehrling und gewann Rolf.
Ganz verwegene unter den Jung-Meistern bedienten ihre Kunden und Kundinnen schon damals gemeinsam. Die strikte Trennung der Geschlechter wurde von ihnen aufgehoben. Einige mussten diese Neuerung allerdings schnell wieder zurücknehmen. Damen und Herren gemeinsam in einem Raum, unter der Haube, über dem Waschbecken, mit Lockenwicklern im Haar, das war nicht im Sinne des rollengerechten Verhaltens. Trotzdem veränderte sich langsam die Architektur der Salons. Inseln bildeten sich heraus, es verschwanden die geschlossenen Kabinen, auf einmal wurden selbst wasserführende Becken fahrbar.
Rolfs Lehrbetrieb war für damalige Verhältnisse konservativ-fortschrittlich. Es fand eben das statt, was die Kundschaft noch so mitmachte. In Rolfs Erinnerung waren die Damen recht zickig und beschwerten sich wegen jeder Kleinigkeit bei seinem Chef. Das aber kann auch an seiner Erinnerung liegen.
Die Ausbildung war streng, aber nicht unmittelbar gut. Fielen Klammern auf die Erde, gab’s Krach. Wurden Haare nicht sogleich zusammengekehrt, gab’s Krach. Dauerte etwas zu lang, gab’s Krach. Spezielle Kurse, Fortbildung, Betrachtungen der aktuellen Mode dagegen waren ein Fremdwort. Es wurde gemacht, was der Friseur konnte, was er mochte und was immer schon so gemacht worden war. Noch hatte die Behandlung im Frisiersalon wenig Demokratisches an sich. Dem Kundenwunsch wurde bisweilen nur widerwillig nachgekommen.
In der Innenstadt Frankfurts war das Angebot anders. Wer das Geld und die Zeit hatte, wer eigene Vorstellungen verwirklicht sehen wollte, der fuhr die paar Kilometer mit der Straßenbahn hinein ins Getümmel. Beratung und Dienst am Kunden bekamen eine neue Qualität. Ein Meister, der die Idole und Vorbilder seiner Zeit nicht kannte, der nicht wusste was die Modemacher in Paris, Mailand und London vorhatten, der fiel sehr schnell wirtschaftlich hinten herunter. Sie begannen, sich auseinander zu entwickeln: die Haarabschneider und die Haargestalter. Hatten seit dem Krieg Haare häufig lediglich eine schlichte technische Funktion, bekamen sie nun in einer breiten Schicht der Bevölkerung die Aufgabe der eigenen Außendarstellung.
Elvis, Beatles, Stones, Bogart, die Monroe, selbst die Brüder Kennedy, sie wurden zu Idolen von Generationen, über Ländergrenzen hinweg. Ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihre Haartracht, ja sogar Bewegungen wurden kopiert und übernommen. Selbst die Stimme des deutschen Synchronsprechers Humphrey Bogarts wurde kopiert, um ebenso lässig wie Bogart zu erscheinen, obwohl diese Leihstimme nun wirklich nichts mit dem Original gemein hatte.
Es kam zur gegenseitigen Beeinflussung, ja zu einer Abhängigkeit zwischen Idol und Modeindustrie. Waren die Vorbilder im Modeangebot nicht wiederzufinden, dann lehnte die Jugend das Angebot ab. Gegebenenfalls griffen die jungen Damen und Herren lieber selbst zu Schere und Faden, um zum Beispiel in normale Hosen einen weiten Schlag einzubauen. Abba und andere hatten es schließlich vorgemacht. Natürlich lernte die Industrie – und mit ihnen Modemacher, Friseure, Kosmetiker – schnell diesem Trend zu folgen. Schließlich ging es um viel Geld.
Umgekehrt bestand auch die Abhängigkeit der „Stars“ vom Angebot der Modemacher: Kamen bei ihnen die aktuellen Trends in Ausstattung und Haartracht nicht vor, dann konnte es leicht zu Verwerfungen kommen. Die Fans waren verunsichert und orientierten sich anderweitig. Hilfe bot in diesem Zusammenhang die gedruckte Presse:
Lehrlinge und Mittelschüler kauften „Bravo“. Gymnasiasten und Studenten die Zeitschrift „Twen“. Das Bürgertum griff auf „Stern“, „Bunte“ und „Neue Revue“ zurück. Damen im mittleren Alter bevorzugten das „Burda“-Modeheft oder „Für Sie“. Ältere Damen bezogen ihre Informationen über die Königshäuser der Welt, und damit ihrer Idole und Vorbilder, aus dem „Grünen Blatt“. All diese Publikationen lagen natürlich auch in den Friseursalons Westdeutschlands und Berlins aus und prägten das Erscheinungsbild der jeweiligen Leserschaft. Und traf man auf einen besonders progressiven Haarkünstler, dann lag zu allerunterst im Stapel – wenn auch nur in der Warteecke der Herren - Hefners „Playboy“. Die Presselandschaft begann ihre Zielgruppen zu erkennen und sich spartenspezifisch zu orientieren. Das gemeinsame Interesse war erkannt.
Unter den Politikern befanden sich in den Sechzigern keine vorbildtauglichen Personen für Jugendliche. In den Parlamenten saßen – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – ältere Herren. Viele von ihnen waren nicht nur an Jahren alt, sondern auch im Kopf. Veränderungen waren ihnen zuwider. Vor Neuem hatten sie Angst. Und wenn sie denn jünger waren, dann hatten sie häufig auch Probleme mit ihren Parteioberen. Helmut Schmidt gehörte dazu, der junge Helmut Kohl, Walter Scheel. Als Vorbilder in Sachen Mode und Haartracht aber kamen sie ebenfalls nicht in Betracht. Sie waren ordentlich angezogen, ihre Haare ordentlich geschnitten. Ordentlich eben. Das war’s dann aber auch. Sie kamen alle aus der Tradition der Stahlhelmträger.
Читать дальше