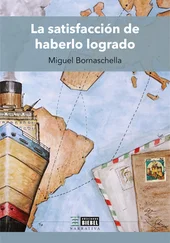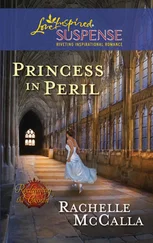Bei Katja und Kurt gab es immer Kaffee und Kuchen. Auch diese zwei Begriffe hätte man miteinander verbinden können, denn in ihrer unglaublich sauberen Wohnung wurde über Jahre hinweg aus einem geblümten Kaffeeservice, dessen Porzellan angenehm klirrte, ein dünner, wohlriechender Kaffee sowie, auf den dazugehörigen Tellern, selbst gemachter Käsekuchen und Schwarzwälder Kirschtorte serviert. Da ich schon in meiner frühen Kindheit Kaffee trinken durfte, wird meine Erinnerung an Kaffeeundkuchen nicht durch bröseligen Rührkakao oder lauwarme Milch getrübt.
Die Maske trat damals ungebeten zum Kaffeekränzchen hinzu, weil Reinhard, der alkoholkranke Volltrottel von Schwiegersohn im Katjaundkurt-Ensemble, bereits einige Biere getrunken hatte und es lustig fand, mich, das verschüchterte Kind, das auf keine seiner Witze reagiert hatte, aus der Reserve zu locken. Ich fiel damals in Ohnmacht, als sich die afrikanische Fratze plötzlich vor mir aufbaute. Ich will nicht lügen, aber ich glaube ich machte mir auch in die Hose. Ein plötzlicher, beißender Geruch mischt sich da in meine Erinnerung. Thematisiert wurde das später nie wieder. Reinhard hatte sich aber mit jener Aktion einen festen Platz als „Bad Guy“ in meiner späteren Fernsehshow gesichert.
***
Ein weiterer Dauerkandidat für diese Rolle war Kai-Uwe, ein Mitschüler aus meiner Grundschulzeit. Als ich ihn neulich abends gegoogelt habe, erfuhr ich, dass er bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist.
Bereits damals, in den ersten Jahren seiner misslungenen Schulkarriere, sah er wie ein Motorradfahrer aus. Er trug eine viel zu große Lederjacke, die irgendwie nach Hundekot roch, und ging grundsätzlich breitbeinig. Bevor sich Kai-Uwe Jahre später den Hals abfuhr, schikanierte er, zumindest in den vier Jahren, die ich ihn kannte, ordentlich seine Umwelt – und insbesondere mich. Was er in seinem jämmerlichen Leben danach tat, weiß ich nicht und es ist mir auch gänzlich egal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er nach der verkorksten Schulzeit, in der er bestimmt sein Taschengeld erst durch Mobbing aufbesserte und dann durch den Verkauf verschnittener Drogen, sein Leben damit verbrachte, illegale Motorradrennen in Tiefgaragen oder auf gesperrten Baugeländen zu organisieren. Bei einem solchen Rennen war er nämlich draufgegangen. Viel mehr, so bin ich mir sicher, ist bei ihm nicht passiert. Mit Frauen zum Beispiel kann Kai-Uwe nicht viel zu tun gehabt haben. Neben seiner stinkenden Lederjacke sorgte auch sein brutales und hässliches Gesicht dafür, dass sich ihm kein Mädchen näherte. Die Mädchen in der Grundschule jedenfalls hassten ihn und ermutigten mich dazu, dass ich mir nicht gefallen lassen sollte, was er mit mir machte.
Was das genau war, tut jetzt nichts zur Sache. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich das meiste auch vergessen. Eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben, weil sie seine späteren Auftritte in meinem 3,2,1-Klick-Setting begleitete. Ich komme noch darauf zurück.
Diese Szene illustriert nämlich noch einen weiteren Grund für die Abwesenheit von Glamour in meinem früheren Leben, nämlich meine bedingungslose Passivität, selbst im Angesicht der Gefahr.
Jahre später sieht mein Leben übrigens schon viel besser aus. Ich arbeite heute in Brüssel als erfolgreicher Entwicklungshelfer. Die Entwicklungshilfe mit der ich zu tun habe, ist aber nur eine Lightversion davon. Ich bin Projektleiter im Capacity Development, reise also nicht in Länder, die voller Malaria und stinkender Straßen sind, sondern in solche, die schon ein paar Dollar Bruttoinlandprodukt auf der hohen Kante haben und nur noch einige freundschaftliche Schubser von den modernen Kolonialstaaten brauchen, um auf der globalen Bühne mitmischen zu können. Das ist hochsensibel und gut bezahlt.
An Geld mangelt es mir nicht und das ist gut so, denn ich sehe nicht ein, warum ich ein bescheideneres Leben führen sollte. Ich habe Brüssel gewählt, weil es nicht so teuer ist wie London oder New York und eine höhere Anzahl an gut aussehenden Frauen bietet. Die Belgierinnen selbst sehen mit ihren ungeschminkten, sauberen Gesichtern und großen Brüsten schon lecker aus, werden allerdings mit der Zeit immer fetter und grimmiger. Der besondere Reiz jedoch entsteht durch die Mischung der ausländischen Frauen aus Europa und dem Rest der Welt. Da die meisten bei irgendwelchen unbedeutenden internationalen Organisationen für eine überschaubare Zeit arbeiten, verhalten sie sich alle, als seien sie mit einem ERASMUS-Stipendium im Auslandssemester. Für mich ist das die optimale Manövriermasse.
Ich bin nicht überarbeitet, weil mein Büro den Kleinkram übernimmt. Ich muss abends nicht zu Frau und Kind, sodass ich mich voll auf meine wesentlichen Interessen konzentrieren kann: Geselligkeit und Frauen.
***
Jetzt gehe ich zu Charlotte, oder eigentlich kann sie auch Catherine oder Carine heißen. Interessanterweise haben die flämischen Angehörigen der belgischen Kleinstaaterei ja trotzdem französisch klingende Namen, obwohl sie ihre wallonischen Ko-Patrioten ja am liebsten in der Hölle würden schmoren sehen – und umgekehrt. Jemand, der mit Nachnamen Verbruggen heißt, kann also durchaus aus Namur kommen, Rotwein trinken und, so erzählen es sich die Flamen, den ganzen Tag auf den Eingang seines Arbeitslosengeldes warten, während jemand der Lepont im Pass stehen hat, aus Gent stammen kann und sich pflichtbewusst den Allerwertesten abarbeitet, um das Land nach vorne zu bringen. Charlotte ist Flämin und wird dafür sogar bezahlt. Sie wohnt in St. Catherine, oder Sint-Katelijne, in der Brüsseler Innenstadt und erhält von der flämischen Gemeindeverwaltung, die diesen Stadtteil gern in den Händen des alten bildungsbürgerlichen und fleißigen Flamen wähnen würde, einen Zuschuss zu ihrer Miete. Ein Wallone oder, Gott bewahre, ein Angehöriger der deutschsprachigen Minderheit in Belgien, würde auf die Zuschussanfrage lediglich einen Tritt in die Eier bekommen.
***
Ich gehe über den ehemaligen Fischmarkt, der heute von Restaurants bevölkert wird, die ihre überteuerten Moules Frites anbieten. Die Häuser, in denen sie untergebracht sind, biegen sich in alle möglichen Richtungen. Die abgeblätterte Farbe der Fassaden leuchtet – Gelb und Blau und ab und zu ein wenig Rot. Die Farben des guten Wetters, das man hier fast nie zu Gesicht bekommt. Ist für mich kein Problem, diese Restaurantpreise zu bezahlen. Für den subventionierten Flamen, der hier, auch bei kaltem Wetter, gern unter dem Heizpilz sitzt, ebenfalls nicht. An einer Ecke werden frische Krabben und kalter Weißwein serviert. Die zwergwüchsige und rotgesichtige Nachbarschaft steht Schlange.
Meine heutige Sexpartnerin wohnt hinter der Kirche. Sie will, der Gegend angemessen, einen Sushi-Abend mit mir veranstalten. Auf die Implikationen, die das mit sich bringt, freue ich mich schon.
Ich habe in wenigen Jahren mit über hundert Frauen – über die genaue Zahl verfüge ich nicht –, deren Alter von 18 bis 50plus reichte und die aus allen möglichen Flecken dieser Erde stammten, geschlafen. Mit dunkelhäutigen Frauen konnte ich mich nie richtig anfreunden. Mit Asiatinnen und Osteuropäerinnen dafür umso mehr. Lateinamerikanerinnen zeigen kein Interesse an mir, wahrscheinlich, weil ich nicht gut tanzen kann. Nordamerikanerinnen sind mir zu fett. Aber eine ordentliche Belgierin passt zwischendurch immer rein.
***
„Salut, Jorge. Schön vorsichtig mit der Treppe, die Stufen sind sehr wacklig“, warnt sie mich, als ich in ihre Wohnung im obersten Stock eintrete. „Tut mir leid wegen des Geruchs im Treppenhaus“, entschuldigt sie sich weiter. „Es ist wirklich alles sehr alt.“ In der Tat ist die Wohnung auf den ersten Blick zweitklassig. Nachdem man die letzten Stufen, die bereits Teil der Wohnung sind, erklommen hat, starrt man auf eine verschimmelte Wand. Links und rechts setzt sich die Wohnung schlauchförmig fort. Wenige Türen sind sichtbar. An keiner Stelle scheint die Wohnung breiter als zwei Meter zu sein. „Mach dir keine Sorgen“, werfe ich mit warmer Stimme ein, während ich meine Schuhe ausziehe, „ich bin ja wegen dir gekommen.“ Der Satz könnte missverstanden werden, denke ich. Aber ich will gleich das Thema auf die Beziehung zwischen mir und ihr bringen. Und zwar auf die rein sexuelle Natur, die ich diese Beziehung annehmen lassen möchte. „Das ist süß von dir“, sagt sie. „Gib mir den Wein, ich stelle ihn in den Kühlschrank. Oh. Elsässer. Schön. Die Schuhe lass ruhig an. Ist ja nicht so warm.“ Ihre Entschuldigungen nerven mich, aber vielleicht entspannt sie sich nach ein paar Schlucken Wein. Während der Messe für Demokratiehilfe im Maghreb, auf der ich sie kennen gelernt habe, schien sie mir jedenfalls ziemlich versaut zu sein. „Danke, kein Problem. Zuhause ziehe ich die Schuhe ja auch aus. Ist gemütlicher.“ Außerdem habe ich mir nicht umsonst meine teuren und garantiert geruchsfreien Burlington-Socken übergestreift, denke ich weiter. Sie murmelt etwas Bestätigendes aus der Küche, die ebenfalls winzig klein zu sein scheint. Es läuft irgendwo ein Radio mit Pure FM. Good music makes good people . Neben meine Lederschuhe stelle ich meine Herrenhandtasche. Darin habe ich Unterwäsche zum Wechseln, Charlotte soll schließlich nicht sofort merken, dass ich vorhabe, hier zu übernachten. Und Herrenhandtaschen sind in Brüssel kein Ding, weil sowieso alle Männer schwul aussehen. Halstücher, ständiges gegenseitiges Abknutschen und Slim Cut so weit das Auge reicht, schaffen ein Setting, in dem ich meine metrosexuellen Talente voll zum Einsatz bringen kann. Darauf stehen nun mal wirklich die meisten europäischen Frauen. Und wenn es eine geile Niederländerin oder Polin doch mal klassisch männlich braucht, dann habe ich das nötige Repertoire dafür mindestens verbal drauf.
Читать дальше