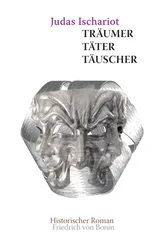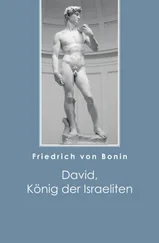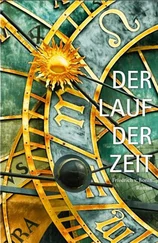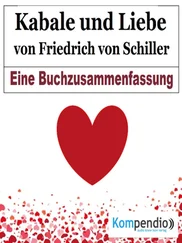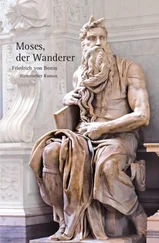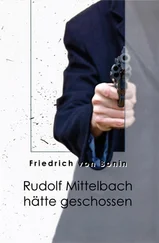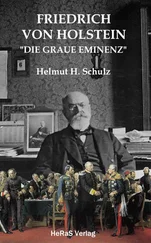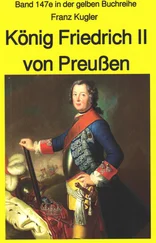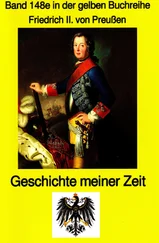Ich habe die Vereinbarung von Göllersdorf, wie sie genannt wurde, selbst geschrieben, von meinem Herrn diktiert. Darin bekam er alle Vollmachten, Truppen auszuheben, Kontributionen festzulegen, beliebige militärische Operationen durchzuführen und sogar eigenmächtig diplomatische Verhandlungen zu führen, mit wem er wollte.
Die Tinte war noch nicht trocken unter seiner Unterschrift, da begann er seine Vorbereitungen. Er hob Truppen aus in ungekannter Zahl, indem er hohen Sold versprach, und vertrieb als erstes die Sachsen, die sich mit schwedischer Unterstützung in Böhmen festgesetzt hatten. Unmittelbar danach zog er nach Nürnberg und schlug sein Lager vor der Stadt auf, die von den Schweden gehalten wurde. Nürnberg und seine Umgebung hatten nun zwei Heere zu unterhalten, die Stadt litt unter den Armeen in ihrer Nähe, Seuchen und Krankheit taten ein Übriges, bald war Nürnberg entvölkert, wer noch lebte, floh.
Zwei Tage dauerte die Schlacht in der Nähe der Stadt, zwei Tage dröhnten die Kanonen, zwei Tage metzelten sie sich, dann gaben die Schweden die Schlacht auf und zogen ab. Der Nimbus des unbesiegbaren Gustav Adolf war gebrochen, durch meinen Herrn, den General Albrecht von Wallenstein.
5.
Beide Heere zogen nun nach Norden. Noch eine Schlacht schlugen sie, Wallenstein und Gustav Adolf, die Schlacht bei Lützen, in der der schwedische König an einer Kugel starb.
„Ich glaube nicht, dass der Tod ihres Königs sie zum Aufgeben bringen wird“, sagte Wallenstein in einer Beratung mit seinen Generalen, „die Herren werden sehen, der Oxenstierna gibt nicht nach, ich kenne ihn.“
Axel von Oxenstierna, schwedischer Kanzler zu Lebzeiten Gustav Adolfs, hatte nach der Schlacht von Lützen die Führung der Schweden übernommen und zog mit seinem Heer, schlimmer raubend und mordend als vorher, durch Norddeutschland.
Gustav Adolf war tot, die kaiserlichen Waffen mindestens ungeschlagen, aber dennoch: die Strapazen und Aufregungen waren an dem Herzog von Friedland nicht spurlos vorübergegangen.
Er hatte sich in der Schlacht von Lützen noch einmal aufgeschwungen. Seit Jahren verschlimmerte sich sein Leiden, eine schwere Gicht, die sein Leibarzt Seni wissenschaftlich Podagra nannte. Tage-, sogar wochenlang war er an sein Lager gefesselt, er konnte nicht aufstehen. Wenn er sich seinen Truppen zeigen wollte oder musste, wurde er in einer Sänfte getragen. Schon Wochen vor der Schlacht bei Lützen litt er, war bettlägerig. Die Schlacht selbst leitete er von einer Sänfte aus, musste so mit ansehen, wie die Schweden seinen rechten Flügel zerschlugen und kein Entsatz kam, weil sein General, der Graf von Pappenheim, nicht rechtzeitig eingriff.
Da erhob er sich von der Sänfte, ließ sich unter schlimmen Schmerzen auf ein Pferd heben und zeigte sich an dem gefährdeten rechten Flügel seinen Soldaten, sie zum Kampf und zum Aushalten anfeuernd. Dass die Schlacht nicht ganz verloren ging, lag allerdings mehr daran, dass Pappenheim doch noch rechtzeitig eintraf. Er rettete Wallenstein ein ehrenvolles Unentschieden in dem Treffen.
Nach der Schlacht ließ sich der Generalissimus zwei Wochen lang nicht sehen. Ich wurde zweimal zu ihm gerufen, beide Male war sein Leibarzt Seni bei ihm.
Der Herzog war gezeichnet von den schwersten Schmerzen. Sein Gesicht war verzerrt, schweißgebadet diktierte er mir kurze Briefe, um mich dann wieder hinaus zu winken. Düster und drohend war das Gesicht beide Male, versunken in seiner eigenen Welt des Schmerzes.
Er sei jetzt dem Seni vollständig hörig, munkelte man in seiner Umgebung. Wenn der ihn nicht behandele, treibe man Astrologie. Wallenstein sollte verfangen sein in düsteren Prophezeiungen über sein Ende, das ihm Seni als sehr blutig dargestellt habe, so hieß es.
Ich war zu den letzten Sitzungen nicht mehr eingeladen worden, er vertraute mir noch, das wusste ich, aber er glaubte mir wohl endlich, dass ich die Zukunft nicht voraussagen konnte. Der einzige, den er außer Seni zu sich ließ, war sein alter Kammerdiener Jean, der mir aber nichts erzählte.
„Zu traurig ist das, was ich sehe“, antwortete er auf meine Fragen, „als dass ich darüber reden könnte.“
Dann, nach zwei Wochen, wurde ich erneut vor ihn gerufen. Ich traf seinen Arzt bei ihm an, den dunklen, kleinen Italiener, der mich misstrauisch ansah, als wollte ich ihm seinen Patienten entfremden oder mich wieder in ihre Sitzungen drängen. Seni war immer, wenn ich ihn in diesen Tagen sah, in seinen weiten schwarzen Mantel gehüllt, das Gesicht immer noch bartlos, die Stirn niedrig, mit dichten, kohlschwarzen Brauen über den stechenden Augen.
Den ganzen Tag diktierte mein Herr mir und zwischendurch fragte er mich auch, wie es draußen, beim Heer, aussah.
„Der Kaiser wird mich entlassen“, vertraute er mir an, „er hat mir immer misstraut und jetzt, da ich so krank bin, kann ich nicht nach Wien reisen, um meinen Widersachern zu begegnen. Er wird auf sie hören und mich entlassen. Wer wird seine Schuld bei mir bezahlen?“
Immer wieder sprach er davon, er sei alt und krank und werde im Alter arm sein und nicht mehr wissen, wo er wohnen und was er essen solle.
Ich tröstete ihn, wo ich konnte, aber dann warf er mich hinaus, er wolle mit dem Arzt astrologische Sitzungen abhalten, sagte er mir, dabei hätte ich nichts zu suchen.
6.
„Man muss Frieden machen mit ihm“, sagte Wallenstein immer wieder und nahm Kontakt zu Oxenstierna auf. Hin und her gingen Boten zwischen den Schweden und meinem Herrn, aber nie brachten sie Schriftliches, nie Konkretes, beide Parteien trauten sich nicht über Lippenbekenntnisse hinaus.
„Herr Hans Georg von Arnim ist da und wünscht seine Fürstliche Gnaden zu sprechen“, meldete der Kammerdiener. Der General hatte sich auf sein Herzogtum in Gitschin begeben. Er diktierte mir gerade einen Brief an den Kaiser, den ich noch heute mit Boten auf den Weg bringen sollte mit Bitten um Geldmittel. Er sei, so hatte er mir diktiert, nicht mehr in der Lage, die erheblichen Beträge vorzustrecken, die fürstliche Kasse sei erschöpft, weil sie die bis heute entstandenen Ausgaben vorfinanziert habe. Sehr häufig hatte ich derartige Briefe zu schreiben, aber der Kaiser in Wien war in ständigen Geldnöten. Seine Schuld bei dem Herzog von Friedland wuchs ins Unermessliche.
„Arnim?“, sinnierte der Herzog, „ich kenne ihn, er war General unter meinem Kommando, das ist allerdings Jahre her.“
Er hatte üble Schmerzen heute, die Gicht plagte ihn erneut. Die Anfälle kamen jetzt immer häufiger, Wallenstein klagte nicht mehr, aber ich sah, wie er litt, zuweilen krümmte sich der ganze Körper unter den Anfällen. Mich, seinen Vertrauten, konnte er diese Krankheit sehen lassen, er bemühte sich aber, sie vor Fremden geheim zu halten. Ich erwartete daher, dass er den Besucher wegschicken würde, zumal es spät abends war.
„Schicke ihn herein“, sagte er stattdessen, und, zu mir gewandt: „Ich will doch sehen, was der Herr bringt, er ficht jetzt unter Oxenstierna, soviel ich weiß. Was mag er wollen?“
Jean führte einen groß gewachsenen Mann herein, in voller Montur, den Säbel umgeschnallt, die schwere Reiterpistole am Gürtel. Sein Gesicht war unter dem dichten, braunen Vollbart fast nicht zu sehen, aber die großen blauen Augen blitzten herausfordernd.
„Danke, Fürstliche Gnaden, dass Sie mich noch empfangen. Ich hatte gehofft, dass Sie sich meiner erinnern und die späte Abendstunde meinen Besuch nicht hindern würde, zumal der Anlass sich besser für den Abend eignet.“
Er verbeugte sich tief vor dem General.
„Arnim, tatsächlich, Sie sind es, kommen Sie herein und nehmen Sie Platz. Rheidt, mein Schreiber“, stellte er mich vor, „Rheidt, besorgen Sie dem Herrn ein Glas Wein und nehmen mit uns hier Platz.“
Ich gab den Befehl an den Kammerdiener weiter. Kurze Zeit später standen drei Pokale für uns auf dem Tisch, mit dem gelben Tokaier gefüllt, der auf den Ländereien des Generals gekeltert wurde.
Читать дальше