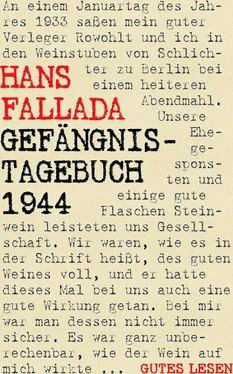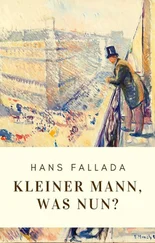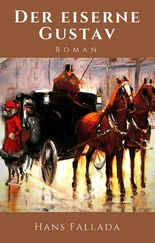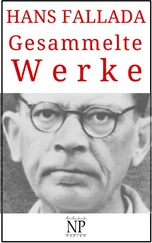Der Anblick eines Gendarmen gab mir also – in Erinnerung jener Verordnung – ein gewisses Gefühl der Sicherheit: es würde doch wenigstens einigermaßen »legal« zugehen. (Binnen jetzt und zwei Stunden würde ich erfahren, wie es mit dieser »Legalität« aussah.) Der Gendarm sagte zu mir ganz höflich: »Wir müssen eine Haussuchung bei Ihnen abhalten, Herr Fallada, es liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Geben Sie mir Ihre Schlüssel!«
»Bitte sehr!« antwortete ich und gab sie ihm. Ich war beruhigt über den höflichen Ton, hütete mich aber, nach dem Inhalt der Anzeige zu fragen. »Wer viel fragt, bekommt viel Antwort« oder gar keine, und das gilt besonders in dem Umgang mit Gerichtspersonen und allem, was mit ihnen zusammenhängt.
Wir gingen in das Haus hinein, ein stattlicher Aufmarsch, mein kleiner Sohn, der mucksmäuschenstill mit großen blauen Augen allen Vorgängen gefolgt war, und der Teddy noch immer an meiner Hand.
Einen Augenblick sah im Erdgeschoß Frau Sponar aus einer Tür hinaus, die Augen dieser bösen Frau glühten, ich hatte ein ungemütliches Gefühl, als sie mich so ansah. Und mit diesem Gefühl hatte ich, ohne es noch zu wissen, recht: sie glaubte, mich zum letzten Mal in ihrem Leben zu sehen. Wir stiegen die Treppe hinauf, und in der Küche sah ich meine Frau wirtschaften, sie war ein wenig bleich, aber das Geschirr, mit dem sie wirtschaftete, klirrte nicht. Ich schickte ihr den Jungen hinein, der Gendarm sagte: »Es ist Ihnen verboten, mit Ihrer Frau oder sonst irgend jemandem vorläufig in Verbindung zu treten.« Ich neigte den Kopf. »Und nun zeigen Sie uns zuerst, wo Sie Ihre Briefschaften aufbewahren!« Ich tat es.
Ich bin immer stolz auf die Ordnung gewesen, in der ich meine Privat-Angelegenheiten gehalten habe, meine doppelte Buchführung würde keinem bilanzsicheren Buchhalter zu Schande gereichen, und meine Korrespondenz ist schön übersichtlich alphabetisch nach Empfängern in Ordnern gesammelt. Ich schloß den Schrank mit ihr auf. Die erste Mappe, die sie herausnahmen, war nicht die mit dem A, sondern die mit dem S. ›Aha!‹ dachte ich. ›Dieser Besuch in der Morgenstunde hängt mit Herrn von Salomon zusammen! Wer weiß, was dieser Abenteurer mit dem so kommunistischen Bruder wieder ausgefressen hat, und mich bringt er dadurch auch ins Gedränge!‹
Aber sie fanden nicht einen Brief von oder an Herrn von Salomon, der war nur eine Plauderbekanntschaft.
Aber das entmutigte sie nicht, wenn es sie im ersten Augenblick auch enttäuschte. Sie gingen Mappe für Mappe durch, und als sie damit fertig waren, nahmen sie meine Bücher vor. Jedes Buch wurde gründlich durchgeschüttelt, sehr zum Schaden der Bucheinbände. Da ich damals noch nicht sehr viele aber doch schon eine ganze Reihe von Büchern hatte, dauerte das eine ganze Weile. Ab und zu liefen sie zu ihrem goldgeschmückten Führer und zeigten ihm ein Buch, das ihnen besonders auffiel, etwa das Erinnerungsbuch von Max Hölz: »Vom weißen Kreuz zur roten Fahne« oder Marx’ »Kapital« oder das Heft »Radikaler Geist«. Aber der Führer schüttelte den Kopf: solche Kleinigkeiten interessierten ihn nicht, es ging ihm um Größeres. Mit Recht nahm ich das für ein schlechtes Zeichen – dieser verdammte Herr von Salomon, sicher hatte er wieder irgendeinen kleinen Putsch in Vorbereitung, war überwacht gewesen und so sein Besuch bei mir entdeckt worden. Nun, immerhin, bei mir würden sie nichts finden! Übrigens beteiligte sich der Gendarm nicht an dieser Haussuchung, er sah nur, ziemlich gelangweilt, zu und ließ die Braunhemden allein toben. Als einziges Ergebnis der einstündigen Untersuchung legten sie mir schließlich einen Zettel vor, den sie in meiner Arbeitsmappe zum »Blechnapf« gefunden hatten. Auf dem Zettel stand neben einer kleinen Zeichnung das Wort »Maschinengewehr«.
»Was haben Sie mit einem Maschinengewehr zu tun?« wurde ich gefragt. »Und was soll diese Zeichnung bedeuten?« Alle hatten sich um mich versammelt und hörten gespannt zu. Auf ihren Gesichtern lag Schadenfreude und Neugier, sie glaubten schon, sie hätten mich. »Meine Herren«, sagte ich lächelnd, »ich arbeite, wie Sie aus der Manuskriptmappe da sehen können, an einem Roman über das Schicksal der Strafgefangenen. Dafür habe ich manches Material über das Leben in den Gefängnissen gesammelt. Dazu gehört auch dieses ›Maschinengewehr‹. Dieses Maschinengewehr ist gar kein Maschinengewehr, sondern es sind, wie Sie aus der Zeichnung sehen können, acht Gefangene, die einen neunten, der sich etwa durch Klauerei mißliebig gemacht hat, in eine Decke gehüllt haben und nun auf eine besondere Art verprügeln wollen. So etwas nennt man im Kittchen Maschinengewehr …« Ich sah sie strahlend an. Aber ich begegnete in ihren Gesichtern nur offenem Unglauben, und ihr Führer fuhr mich wütend an: »Das sind ja alles faule Ausreden! Mit solchen Lügen können Sie uns doch nicht dumm machen! Gestehen Sie auf der Stelle, wo Sie das Maschinengewehr vergraben haben, oder ich ziehe andere Saiten auf. Ich fange mit Ihnen das Schwerste an, Mann!« Er sah mich drohend an. Mir fiel schwer auf ’s Herz, daß ich kein Beweismittel mehr besaß, wenn diese Herren nicht glauben wollten . Ich war ganz in ihre Hand gegeben, meine Unschuld interessierte sie nicht, da sie mich für schuldig halten wollten. In diesem Augenblick der Not kam nun Hilfe von da, wo ich sie am wenigsten erwartet hätte: von einem derben, schlägerhaft aussehenden Mann im brauen Hemd. »Doch«, rief er. »Das stimmt. Wir haben selber mal einen im Schlafsaal so vertrimmt, da sagten wir auch Maschinengewehr dazu …« Er brach ab, auf einen Blick seines Führers hin. Der fand es wohl nicht ganz richtig, das Vorleben eines braven SA-Kämpfers in Gegenwart eines solchen Außenseiters wie ich zu erörtern. »Es ist gut«, sagte der Führer dann mürrisch und schob den Zettel in den Aufschlag seines Uniformärmels zu eventueller weiterer Verwendung. »Ich werde diese Sache noch später überprüfen. Jetzt werden wir erst die anderen Räume durchsuchen.« Sie taten es gründlich, aber nicht mit übermäßiger Geschicklichkeit. Mit einigem Vergnügen stellte ich fest, daß ein Hausbesuch, den wir hatten, eine jüdische Dame, ohne allzu große Mühe sich den Herren von Zimmer zu Zimmer entziehen konnte; sie bekamen sie überhaupt nicht zu Gesicht, obwohl meine paar Zimmer doch eigentlich von SA wimmelten. Einmal sah ich die Dame in einem Winkel auf dem Balkon sitzen. Ich nickte ihr mit den Augen zu, und sie nickte lächelnd zurück: ich war doch froh, daß sie nicht entdeckt wurde, ihretwegen und auch ein wenig meinetwegen. Eine Jüdin im Hause wäre doch wieder eine zusätzliche Belastung gewesen.
Auch die Durchsuchung der übrigen Räume gab nicht das geringste Belastende: in mürrischem Schweigen wurde auf den Boden gestiegen und dort eine Durchsuchung unserer leeren Koffer und Kisten vorgenommen. Ich stand an dem einen Bodenfenster, am nächsten standen der SA-Führer und der Gendarm im Gespräch. Plötzlich hörte ich den Gendarm entschieden sagen: »Es hat sich nicht der geringste Anhalt ergeben. Ich kann den Mann nicht verhaften.«
Der Führer sagte hitzig: »Aber es ist so – wir haben die bestimmtesten Nachrichten. Sie müssen ihn festnehmen.«
Der Gendarm stülpte sich den Tschako auf den Schädel und zog an seinem Koppel. »Ich kann es nicht und ich tue es nicht«, sagte er wieder mit Entschiedenheit. »Dann nehme ich ihn eben fest!« rief der SA-Führer giftig. »Tun Sie, was Sie wollen. Aber ich habe damit nichts zu tun!« antwortete der Gendarm und verließ den Bodenraum. Mit ihm ging die »Legalität« aus dem Hause, so also sah es mit der Befolgung der Göringschen Verordnungen aus! Bis zu dieser Minute hatte ich das Ganze noch für ein etwas lästiges, aber doch auch belustigendes Spiel angesehen: die Brüder konnten mir gar nichts wollen! Ich war unschuldig. Jetzt begriff ich, daß es darauf gar nicht ankam, wenn sie mir ernstlich an den Kragen wollten. Ich begriff, daß ich wirklich in Gefahr war, und daß es für mich besser sein würde, das Ganze nicht als eine »Lappalie« anzusehen. Ich würde vielleicht all meine Kraft und meinen Mut brauchen, um heil aus dieser Affäre herauszukommen!
Читать дальше